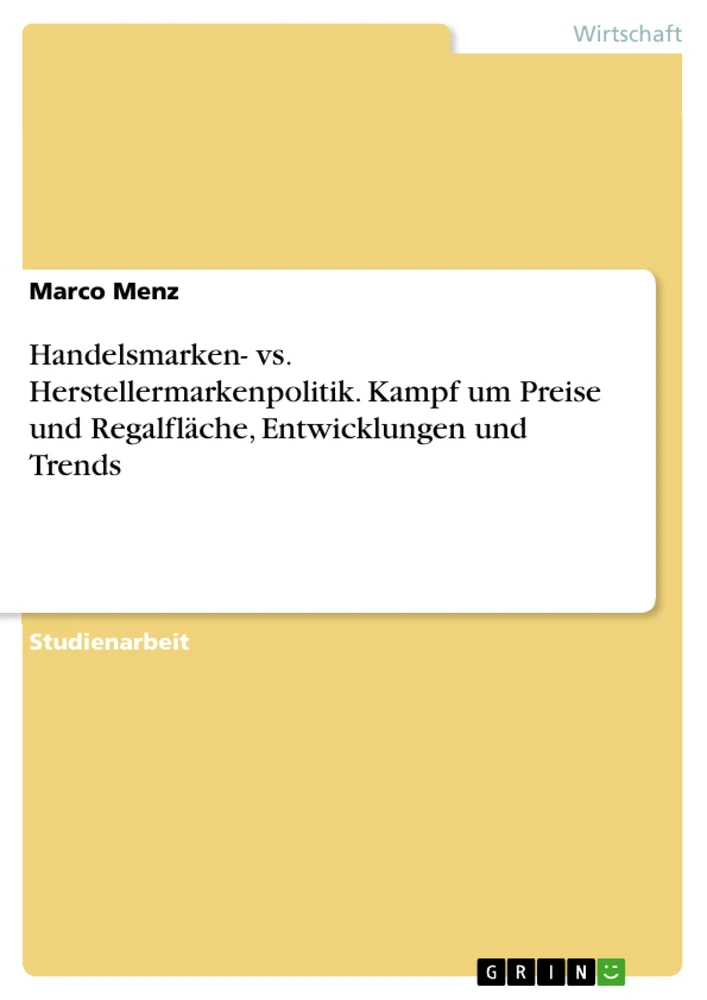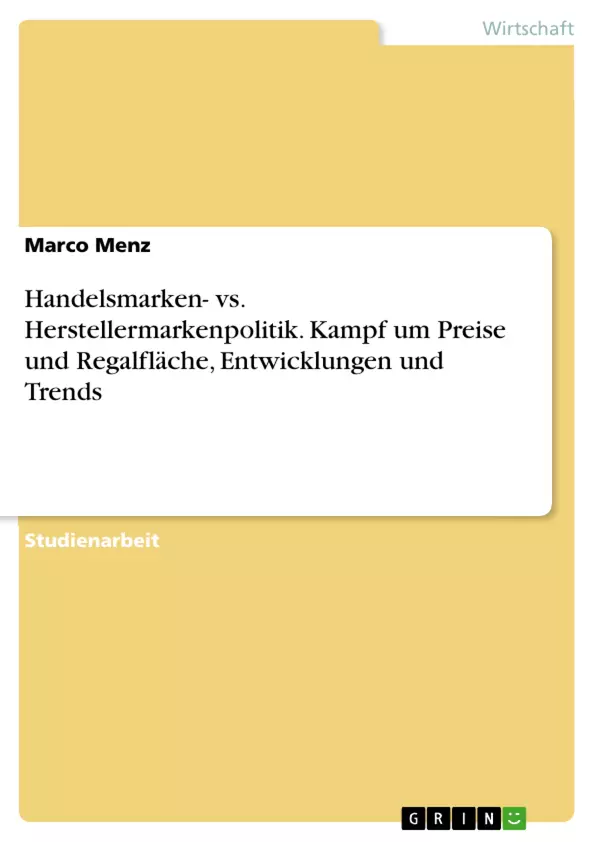Immer mehr Verbraucher greifen zu Handelsmarken. Während der Handel sein Angebot an Eigenmarken stetig weiter ausbaut, geraten sowohl große, als auch kleine Herstellerunternehmen immer mehr unter Druck und somit in schlechtere Verhandlungspositionen. Im Rahmen der Arbeit soll der Konflikt, der durch die vermehrte Aufnahme von Handelsmarken in die Sortimente der Handelsunternehmen einhergeht, näher beleuchtet und der Ursprung dieser Entwicklung erläutert werden.
Dabei soll zunächst die Terminologie des Themenbereiches erklärt werden und die verschiedenen Formen von Handelsmarken vorgestellt werden. Im Abschnitt 2 sollen Ziele und Motive der Handels- und Herstellerunternehmen vorgestellt und näher erläutert werden. Anschließend werden Entwicklungen und Trends im Bereich der Entwicklung von Handelsmarken aus Sicht der Verbraucher vorgestellt und näher auf deren Marktanteilswachstum, sowie dessen Nebeneffekte eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Grundlagen
- 1.1 Definition und Abgrenzung
- 1.2 Erscheinungsformen von Handelsmarken
- 1.2.1 Gattungsmarken / „No Names“ / Labels / „Weiße Ware“
- 1.2.2 die klassischen Handelsmarken
- 1.2.3 Premium-Handelsmarken
- 2 Ziele und Motive bei der Führung und Herstellung von Handelsmarken
- 2.1 Ziele und Motive hinter der Handelsmarkenpolitik
- 2.1.1 Renditesicherung
- 2.1.2 Profilierung und Differenzierung von konkurrierenden Handelsunternehmen
- 2.1.3 Sortimentsoptimierung
- 2.1.4 Reduktion der Herstellermacht und Stärkung der eigenen Verhandlungsposition
- 2.1.5 Verbesserte Organisationsanbindung
- 2.2 Handelsmarken aus Sicht der Produzenten
- 3 Entwicklungen und Trends
- 3.1 Kampf um Marktanteile, Durchsetzungsstarke Bereiche
- 3.2 zunehmende Akzeptanz durch die Verbraucher
- 3.3 Nebeneffekte des Zuwachses von Handelsmarken
- 3.3.1 Auswirkungen auf die Artikelvielfalt und Preise
- 3.3.2 Auswirkungen auf die Innovationsentwicklung
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Handelsmarken und Herstellermarken im Kontext des Wettbewerbs um Preisgestaltung und Regalfläche. Ziel ist es, die Entwicklung und die Trends im Bereich der Handelsmarken zu beleuchten und die Motive sowohl der Handelsunternehmen als auch der Hersteller zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die verschiedenen Formen von Handelsmarken, die Auswirkungen auf den Markt und die zunehmende Akzeptanz dieser Marken durch die Verbraucher.
- Definition und Abgrenzung von Handels- und Herstellermarken
- Ziele und Motive der Handelsmarkenpolitik
- Entwicklung und Trends im Markt für Handelsmarken
- Auswirkungen des Handelsmarkenwachstums auf Preisgestaltung und Innovation
- Veränderung der Verhandlungspositionen zwischen Handel und Herstellern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Thematik. Es definiert und grenzt die Begriffe „Marke“, „Handelsmarke“, „Herstellermarke“ und „Markenpolitik“ voneinander ab. Die Arbeit differenziert zwischen einer klassischen, merkmalsbezogenen und einer wirkungsbezogenen Sichtweise auf Marken. Die Definition von Handelsmarken wird anhand der Definition des Ausschusses für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft erläutert und die Unterschiede zu Herstellermarken hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der verschiedenen Perspektiven auf Marken, sowohl von der Unternehmensperspektive als auch aus Sicht der Konsumenten, um den weiteren Verlauf der Arbeit zu fundieren.
2 Ziele und Motive bei der Führung und Herstellung von Handelsmarken: Dieses Kapitel beleuchtet die Ziele und Beweggründe hinter der Handelsmarkenpolitik aus der Sicht der Handelsunternehmen. Es werden verschiedene Motive wie Renditesicherung, Profilierung am Markt, Sortimentsoptimierung und die Reduktion der Herstellermacht diskutiert. Die Stärkung der eigenen Verhandlungsposition durch den Aufbau von Handelsmarken spielt eine zentrale Rolle. Zusätzlich wird die Perspektive der Produzenten auf die Herstellung von Handelsmarken betrachtet. Die Kapitel verdeutlicht, wie Handelsmarken ein strategisches Instrument für Handelsunternehmen sind, um ihre Marktposition zu verbessern und ihre Abhängigkeit von Herstellern zu verringern.
3 Entwicklungen und Trends: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklungen und Trends im Bereich der Handelsmarken. Es beschreibt den Kampf um Marktanteile, wobei besonders erfolgreiche Bereiche hervorgehoben werden. Die zunehmende Akzeptanz von Handelsmarken durch die Verbraucher wird untersucht und die damit verbundenen Nebeneffekte, wie Auswirkungen auf die Artikelvielfalt und Preise sowie die Innovationsentwicklung, werden detailliert dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der dynamischen Entwicklung des Handelsmarkenmarktes und dessen Einfluss auf den gesamten Markt für Konsumgüter.
Schlüsselwörter
Handelsmarken, Herstellermarken, Markenpolitik, Marktanteile, Preisgestaltung, Regalfläche, Verbraucherakzeptanz, Innovationsentwicklung, Renditesicherung, Verhandlungsposition, Sortimentsoptimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Handelsmarken vs. Herstellermarken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wettbewerb zwischen Handelsmarken und Herstellermarken, insbesondere hinsichtlich Preisgestaltung und Regalplatz. Sie analysiert die Entwicklung und Trends im Bereich der Handelsmarken und die Motive der beteiligten Akteure (Handelsunternehmen und Hersteller).
Welche Arten von Handelsmarken werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Gattungsmarken/„No Names“/Labels/„Weiße Ware“, klassischen Handelsmarken und Premium-Handelsmarken. Diese werden im Detail definiert und abgegrenzt.
Welche Ziele verfolgen Handelsunternehmen mit Handelsmarken?
Handelsunternehmen verfolgen mit Handelsmarken verschiedene Ziele: Renditesicherung, Profilierung und Differenzierung von Wettbewerbern, Sortimentsoptimierung, Reduktion der Herstellermacht und Stärkung der eigenen Verhandlungsposition sowie verbesserte Organisationsanbindung.
Wie sehen die Entwicklungen und Trends im Handelsmarkenmarkt aus?
Der Markt zeigt einen Kampf um Marktanteile, wobei einige Bereiche besonders erfolgreich sind. Die Verbraucherakzeptanz von Handelsmarken steigt stetig. Dies hat Auswirkungen auf die Artikelvielfalt, Preise und die Innovationsentwicklung.
Welche Auswirkungen hat das Wachstum von Handelsmarken auf den Markt?
Das Wachstum von Handelsmarken beeinflusst die Preisgestaltung, die Artikelvielfalt und die Innovationsentwicklung. Es verändert auch die Verhandlungspositionen zwischen Handel und Herstellern, da Handelsunternehmen durch eigene Marken unabhängiger werden.
Wie werden Handelsmarken definiert und von Herstellermarken abgegrenzt?
Die Arbeit bietet eine detaillierte Definition von Handelsmarken und Herstellermarken und grenzt diese anhand verschiedener Kriterien voneinander ab. Sie berücksichtigt sowohl merkmalsbezogene als auch wirkungsbezogene Sichtweisen auf Marken.
Welche Motive haben Hersteller bei der Produktion von Handelsmarken?
Die Arbeit beleuchtet die Perspektive der Produzenten und untersucht ihre Motive für die Herstellung von Handelsmarken. Dies wird im Kontext der strategischen Entscheidungen von Handelsunternehmen betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung und Grundlagen, Ziele und Motive bei der Führung und Herstellung von Handelsmarken, Entwicklungen und Trends, sowie Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Handelsmarken, Herstellermarken, Markenpolitik, Marktanteile, Preisgestaltung, Regalfläche, Verbraucherakzeptanz, Innovationsentwicklung, Renditesicherung, Verhandlungsposition, Sortimentsoptimierung.
- Citation du texte
- Marco Menz (Auteur), 2016, Handelsmarken- vs. Herstellermarkenpolitik. Kampf um Preise und Regalfläche, Entwicklungen und Trends, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338709