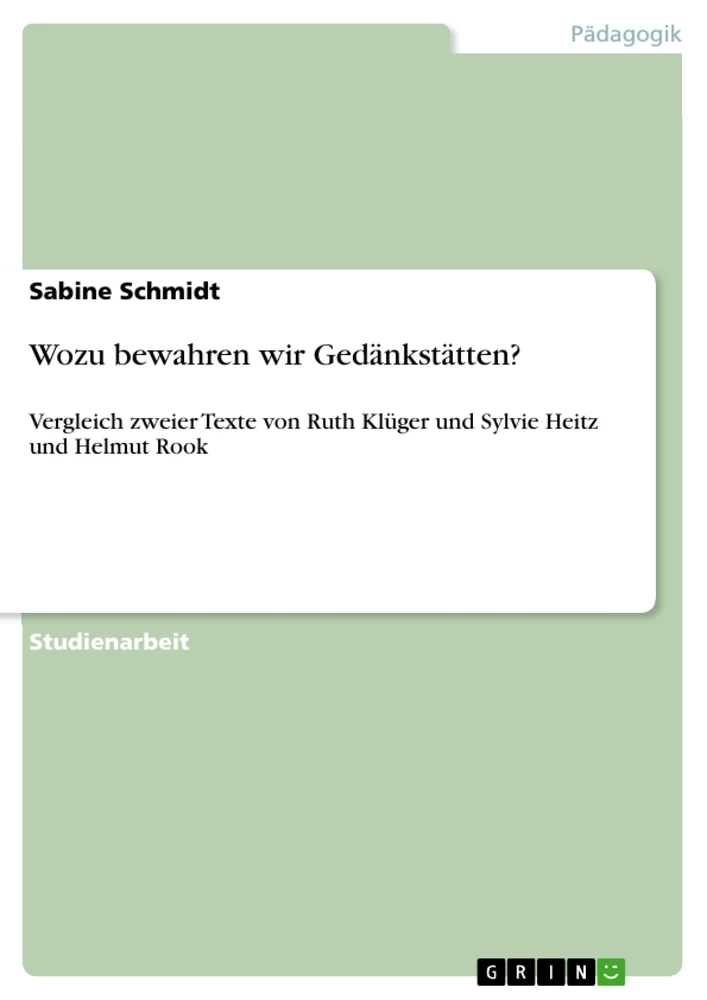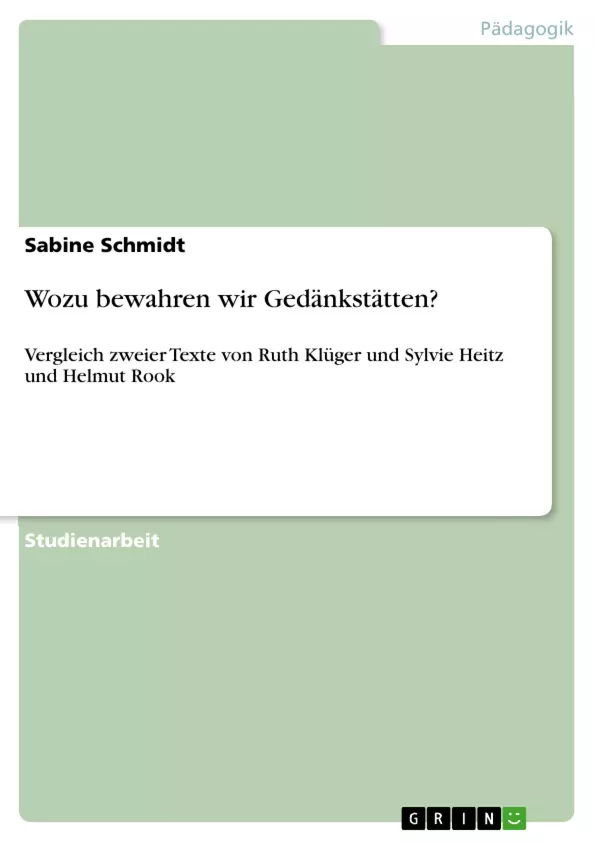In dieser Ausarbeitung wird die Autobiographie „Weiter leben“ von Ruth Klüger mit einer Veranstaltung aus der Gedenkstättenpädagogik verglichen, um aufzuzeigen, ob Ruth Klüger eine solche Form der geschichtlichen Auseinandersetzung von der Nachkriegsgeneration überhaupt erwarten kann. Schwerpunktmäßig bezieht die Autorin sich hierbei auf das Kapitel „die Lager“, um darlegen zu können, in wie fern beziehungsweise ob eine geschichtliche Auseinandersetzung bezüglich der deutschen Vergangenheit mit der Bewahrung von Gedenkstätten ermöglicht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Bewahrung der Gedenkstätten. Wozu nur?
- Mit Ruth Klügers Autobiographie zu: „Weiter leben. Eine Jugend“
- Die Veranstaltung „Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht“
- Ruth Klüger
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung setzt sich zum Ziel, die Autobiographie „Weiter leben. Eine Jugend“ von Ruth Klüger mit einer Veranstaltung aus der Gedenkstättenpädagogik zu vergleichen. Dabei soll untersucht werden, ob Ruth Klüger eine solche Form der geschichtlichen Auseinandersetzung von der Nachkriegsgeneration überhaupt erwarten kann. Der Fokus liegt dabei auf dem Kapitel „Die Lager“ aus Klügers Buch, um zu beleuchten, inwieweit oder ob eine geschichtliche Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit durch die Bewahrung von Gedenkstätten ermöglicht wird.
- Die Bedeutung der persönlichen Erfahrung im Umgang mit der NS-Vergangenheit
- Die Kritik an der „Museumskultur“ von KZ-Gedenkstätten
- Die Rolle von Gedenkstätten im historisch-politischen Unterricht
- Die Frage nach der Vermittlung von Geschichte und der Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Überlebenden und Nachgeborenen auf die NS-Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Die Lager“ in Ruth Klügers Autobiographie „Weiter leben. Eine Jugend“ stellt die kritische Sichtweise der Autorin auf die Bewahrung von KZ-Gedenkstätten dar. Klüger argumentiert, dass die heutigen Gedenkstätten den Schrecken der Vergangenheit nicht authentisch vermitteln können und eher ein Gefühl der Distanz und Entfremdung erzeugen. Sie kritisiert insbesondere die „Sakralisierung“ und die „kathartische Verdrängung“ des Holocausts in der Museumskultur.
Im Text „Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht“ von Sylvia Heitz und Helmut Rook wird ein Seminar für Studenten vorgestellt, das einen fünftägigen Gedenkstättenbesuch im Buchenwald beinhaltet. Die Autoren betonen die Bedeutung von Gedenkstätten als Lernorte, die den Studierenden einen Raum zur intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte bieten. Sie sehen in der pädagogischen Begleitung und der gezielten Nutzung von Quellen eine Möglichkeit, ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein und ein demokratisches Engagement zu fördern.
Schlüsselwörter
Gedenkstätten, Holocaust, NS-Vergangenheit, Erinnerungskultur, Geschichtsbewusstsein, Geschichtsdidaktik, KZ-Lager, Autobiographie, Gedenkstättenpädagogik, politische Bildung, Lernort, Quellenarbeit, demokratisches Engagement, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Wie beurteilt Ruth Klüger KZ-Gedenkstätten?
In ihrer Autobiographie „Weiter leben“ kritisiert Klüger die „Museumskultur“ von Gedenkstätten. Sie meint, dass diese den tatsächlichen Schrecken oft nicht authentisch vermitteln können und eine künstliche Distanz schaffen.
Was ist das Ziel der Gedenkstättenpädagogik?
Gedenkstättenpädagogik will durch die Auseinandersetzung mit historischen Orten und Quellen ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein fördern und demokratisches Engagement stärken.
Was meint Klüger mit der „Sakralisierung“ des Holocausts?
Sie kritisiert, dass der Holocaust oft wie ein religiöses Dogma behandelt wird, was eine kritische, menschliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eher erschwert als fördert.
Können Gedenkstättenbesuche im Unterricht wirksam sein?
Die Arbeit vergleicht Klügers Skepsis mit pädagogischen Ansätzen, die Gedenkstätten als wichtige Lernorte sehen, sofern sie intensiv vor- und nachbereitet werden.
Warum ist die Perspektive der Überlebenden für Nachgeborene schwierig?
Überlebende wie Klüger haben eine andere emotionale Wahrheit. Nachgeborene neigen oft zu einer „kathartischen Verdrängung“, indem sie Gedenkstätten besuchen, um sich moralisch entlastet zu fühlen.
- Arbeit zitieren
- Sabine Schmidt (Autor:in), 2015, Wozu bewahren wir Gedänkstätten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337878