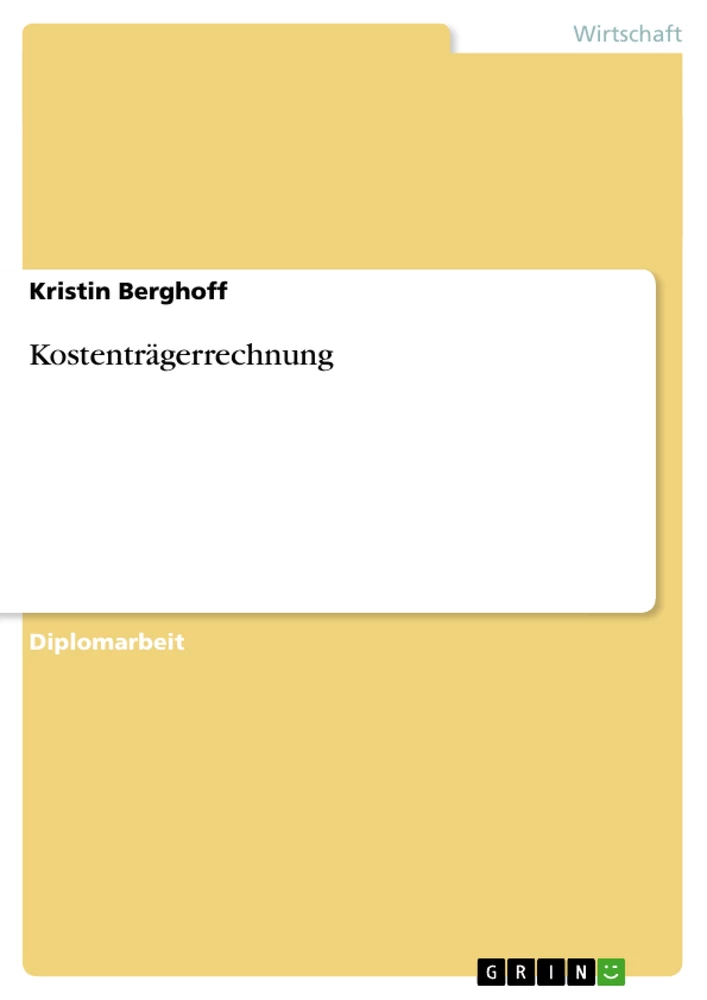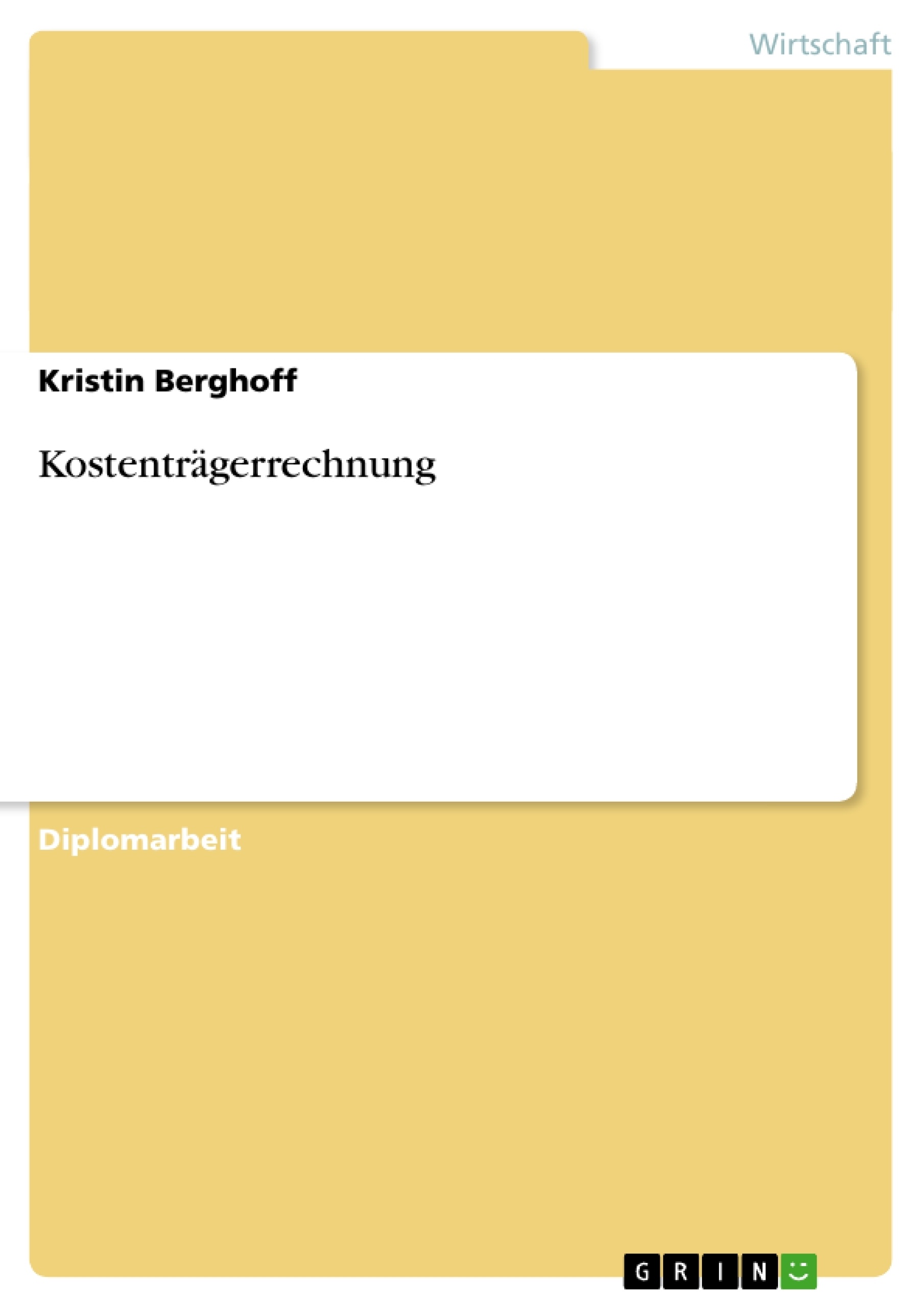Die Kosten- und Erlösrechnung ist neben der Bilanzrechnung, der Investitionsrechnung und der Finanzrechnung ein Teilgebiet des betrieblichen Rechnungswesens. Sie wird auch als internes Rechnungswesen bezeichnet und ist deshalb für die Unternehmensführung und -steuerung von großer Bedeutung, um z.B. dem betriebswirtschaftlichen Ziel der Gewinnmaximierung Rechnung zu tragen. Der Gewinn ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen Erlösen und Kosten, die somit Bestandteil der Kosten- und Erlösrechnung sind.
Eine weitere Aufgabe der Kosten- und Erlösrechnung ist die Versorgung der Unternehmensbereiche mit qualitativen Informationen. Dazu zieht sie nicht nur Vergangenheitswerte, wie z.B. die Normalkosten, als Grundlage heran, sondern auch zukünftig erwartete Größen (Plankosten).
Kosten können in ihrer Abhängigkeit von der Beschäftigung oder in ihrer Zurechenbarkeit zu den Kostenträgern gliedert werden. Daraus folgt, dass Kosten variabeln (beschäftigungsabhängige Kosten) oder fixen (beschäftigungsunabhängige Kosten) Charakter besitzen, sowie in Einzelkosten (einem Kostenträger direkt zurechenbare Kosten) oder Gemeinkosten (einem Kostenträger nicht direkt zurechenbar) eingeteilt werden können. Eine speziellere Einteilung der Kosten kann erfolgen in Stückkosten (Kosten einer Leistungseinheit) und Gesamtkosten (Kosten einer Gesamtheit, z.B. einer Abteilung), primäre Kosten (entstanden durch Faktoren, die vom Beschaffungsmarkt bezogen wurden) und sekundäre Kosten (entstanden durch den Verbrauch von innerbetrieblichen Leistungen).
Eine weitere Kostenart stellen die Sondereinzelkosten dar. Sie sind eine Unterform der Einzelkosten und lassen sich i.d.R. nur je Auftrag und nicht je Stück erfassen. Sondereinzelkosten gibt es in der Fertigung z.B. in Form von Modellen, Spezialwerkzeuge, Lizenzen und im Vertrieb z.B. in Form von Verpackungsmaterial, Frachten, Provisionen und auftragsbezogener Werbung.
In der Literatur wird häufig statt von Kosten- und Erlösrechnung von Kosten- und Leistungsrechnung gesprochen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff Erlös mit dem Begriff Leistung gleichgesetzt. Dabei ist der Erlös der monetäre Gegenwert der Leistung, den der Käufer zahlt. Die Leistung wird als Güterentstehung bezeichnet, bei der die Herstellung von Produkten dem Unternehmenszweck entspricht und innerhalb einer Abrechnungsperiode erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Grundlagen der Kostenträgerrechnung
- 2.1 Einordnung der Kostenträgerrechnung in die Kostenrechnung
- 2.2 Kostenträger
- 2.3 Aufgaben der Kostenträgerrechnung
- 3. Kostenträgerstückrechnung
- 3.1 Aufgaben der Kostenträgerstückrechnung
- 3.2 Einteilung nach dem Kalkulationszeitpunkt
- 3.2.1 Vorkalkulation
- 3.2.2 Zwischenkalkulation
- 3.2.3 Nachkalkulation
- 3.3 Einteilung nach dem Kalkulationsverfahren
- 3.3.1 Übersicht
- 3.3.2 Divisionskalkulation
- 3.3.2.1 Grundlagen der Divisionskalkulation
- 3.3.2.2 Einstufige Divisionskalkulation
- 3.3.2.3 Zweistufige Divisionskalkulation
- 3.3.2.4 Mehrstufige Divisionskalkulation
- 3.3.2.4.1 Kennzeichen der mehrstufigen Divisionskalkulation
- 3.3.2.4.2 Durchwälzmethode
- 3.3.2.4.3 Veredelungskalkulation
- 3.3.3 Äquivalenzziffernkalkulation
- 3.3.3.1 Grundlagen der Äquivalenzziffernkalkulation
- 3.3.3.2 Einstufige Äquivalenzziffernkalkulation
- 3.3.3.3 Mehrstufige Äquivalenzziffernkalkulation
- 3.3.4 Zuschlagskalkulation
- 3.3.4.1 Grundlagen der Zuschlagskalkulation
- 3.3.4.2 Summarische Zuschlagskalkulation
- 3.3.4.3 Differenzierende Zuschlagskalkulation
- 3.3.5 Maschinenstundensatzkalkulation
- 3.3.6 Kuppelkalkulation
- 3.3.6.1 Grundlagen der Kuppelkalkulation
- 3.3.6.2 Restwertrechnung
- 3.3.6.3 Verteilungsrechnung
- 4. Kostenträgerzeitrechnung
- 4.1 Aufgaben der Kostenträgerzeitrechnung
- 4.2 Gesamtkostenverfahren
- 4.3 Umsatzkostenverfahren
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Kostenträgerrechnung und ihren verschiedenen Verfahren. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Grundlagen und Methoden der Kostenträgerrechnung zu vermitteln und die verschiedenen Kalkulationsverfahren im Detail zu analysieren.
- Einordnung der Kostenträgerrechnung in die Kostenrechnung
- Verschiedene Verfahren der Kostenträgerstückrechnung (Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation, Kuppelkalkulation)
- Kostenträgerzeitrechnung (Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren)
- Anwendungsbereiche und Limitationen der verschiedenen Verfahren
- Vergleich und Gegenüberstellung der verschiedenen Kalkulationsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Kostenträgerrechnung ein und beschreibt die Bedeutung der Kostenrechnung für Unternehmen. Es legt den Grundstein für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel, indem es den Kontext und die Relevanz der Kostenträgerrechnung im betriebswirtschaftlichen Umfeld verdeutlicht. Die Einführung schafft eine Brücke zwischen den allgemeinen Prinzipien der Kostenrechnung und der spezifischen Anwendung in der Kostenträgerrechnung.
2. Grundlagen der Kostenträgerrechnung: Dieses Kapitel erläutert die fundamentalen Konzepte der Kostenträgerrechnung, beginnend mit ihrer Einordnung innerhalb des Systems der Kostenrechnung. Es definiert den Begriff „Kostenträger“ präzise und beschreibt dessen unterschiedliche Ausprägungen und Merkmale. Schließlich werden die zentralen Aufgaben der Kostenträgerrechnung im Detail dargelegt, welche die Grundlage für die folgenden Abschnitte bilden. Die Kapitelteile schaffen ein fundiertes Verständnis der theoretischen Basis der Kostenträgerrechnung.
3. Kostenträgerstückrechnung: Dieses Kapitel widmet sich ausführlich den verschiedenen Verfahren der Kostenträgerstückrechnung. Es werden die Aufgaben dieser Rechnungsart detailliert dargestellt und eine systematische Einteilung nach Kalkulationszeitpunkt (Vorkalkulation, Zwischenkalkulation, Nachkalkulation) und Kalkulationsverfahren (Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation, Kuppelkalkulation) vorgenommen. Jedes Verfahren wird mit seinen Grundlagen, Vor- und Nachteilen eingehend analysiert und an Beispielen illustriert, um ein tiefes Verständnis der jeweiligen Methode und ihrer Anwendbarkeit zu ermöglichen. Die Kapitelteile zeigen die Vielseitigkeit der Kostenträgerstückrechnung und helfen bei der Auswahl des passenden Verfahrens.
4. Kostenträgerzeitrechnung: Das Kapitel erläutert die Grundlagen der Kostenträgerzeitrechnung und konzentriert sich auf die beiden Hauptverfahren: das Gesamtkostenverfahren und das Umsatzkostenverfahren. Die jeweiligen Aufgaben und die spezifischen Merkmale beider Verfahren werden detailliert beschrieben und durch konkrete Beispiele veranschaulicht. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Verfahren werden herausgestellt, um die Auswahl des geeigneten Verfahrens je nach Unternehmens- und Branchenstruktur zu erleichtern. Es wird gezeigt, wie beide Verfahren zur Kostenkontrolle und -planung eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Kostenträgerrechnung, Kostenrechnung, Kalkulation, Kostenträgerstückrechnung, Kostenträgerzeitrechnung, Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation, Kuppelkalkulation, Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren, Kostenkontrolle, Kostenplanung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Kostenträgerrechnung
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Kostenträgerrechnung. Sie beinhaltet eine Einführung in das Thema, detaillierte Erklärungen zu den Grundlagen der Kostenträgerrechnung, eine eingehende Analyse verschiedener Verfahren der Kostenträgerstückrechnung (Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation, Kuppelkalkulation) und der Kostenträgerzeitrechnung (Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren), sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche Verfahren der Kostenträgerstückrechnung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ausführlich die Divisionskalkulation (einstufig, zweistufig, mehrstufig mit Durchwälzmethode und Veredelungskalkulation), die Äquivalenzziffernkalkulation (einstufig und mehrstufig), die Zuschlagskalkulation (summarisch und differenzierend), die Maschinenstundensatzkalkulation und die Kuppelkalkulation (mit Restwertrechnung und Verteilungsrechnung).
Welche Verfahren der Kostenträgerzeitrechnung werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt das Gesamtkostenverfahren und das Umsatzkostenverfahren der Kostenträgerzeitrechnung, inklusive ihrer jeweiligen Aufgaben und Merkmale.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: eine Einführung, die Grundlagen der Kostenträgerrechnung, die Kostenträgerstückrechnung mit ihren verschiedenen Verfahren, die Kostenträgerzeitrechnung und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel unterteilt, um die Themen detailliert zu behandeln.
Welche Ziele verfolgt die Diplomarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Grundlagen und Methoden der Kostenträgerrechnung zu vermitteln und die verschiedenen Kalkulationsverfahren im Detail zu analysieren. Sie soll die Anwendung und die Limitationen der verschiedenen Verfahren aufzeigen und einen Vergleich der Methoden ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kostenträgerrechnung, Kostenrechnung, Kalkulation, Kostenträgerstückrechnung, Kostenträgerzeitrechnung, Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation, Kuppelkalkulation, Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren, Kostenkontrolle, Kostenplanung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften und verwandter Fächer, die sich mit Kostenrechnung und insbesondere der Kostenträgerrechnung auseinandersetzen. Sie kann auch für Praktiker im Rechnungswesen von Nutzen sein.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kalkulationsverfahren?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kalkulationsverfahren (Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation, Kuppelkalkulation, Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren) finden Sie in Kapitel 3 und 4 der Diplomarbeit. Jedes Verfahren wird mit seinen Grundlagen, Vor- und Nachteilen und Beispielen erläutert.
Wie werden die verschiedenen Kalkulationsmethoden verglichen?
Die Diplomarbeit vergleicht und stellt die verschiedenen Kalkulationsmethoden gegenüber, um die Auswahl des passenden Verfahrens je nach Anwendungssituation zu erleichtern. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden hervorgehoben.
- Quote paper
- Kristin Berghoff (Author), 2004, Kostenträgerrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33667