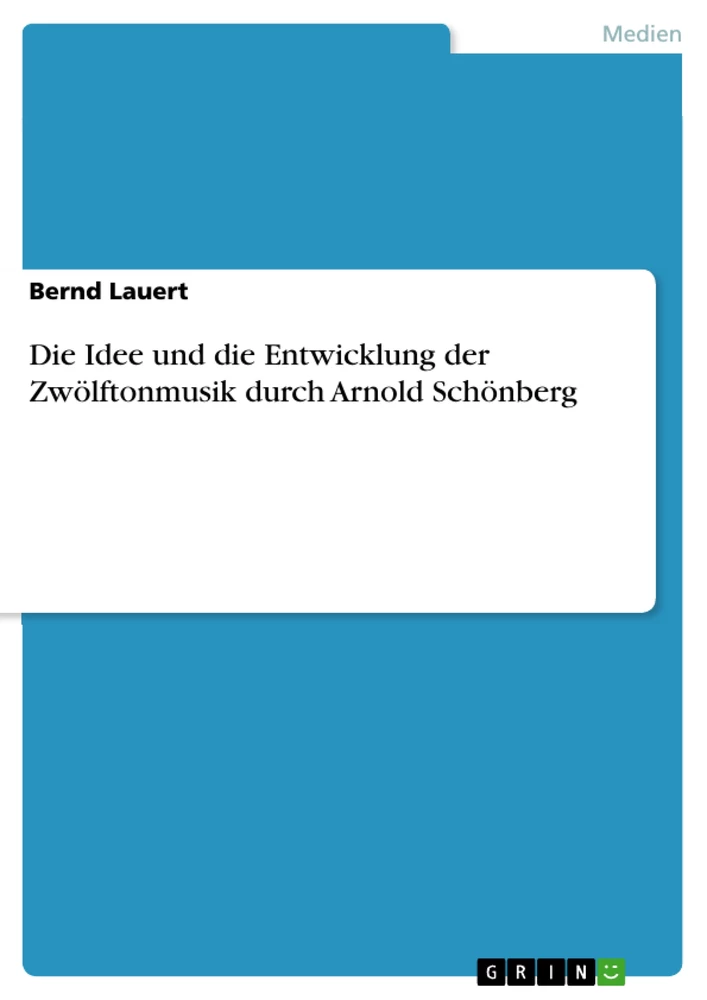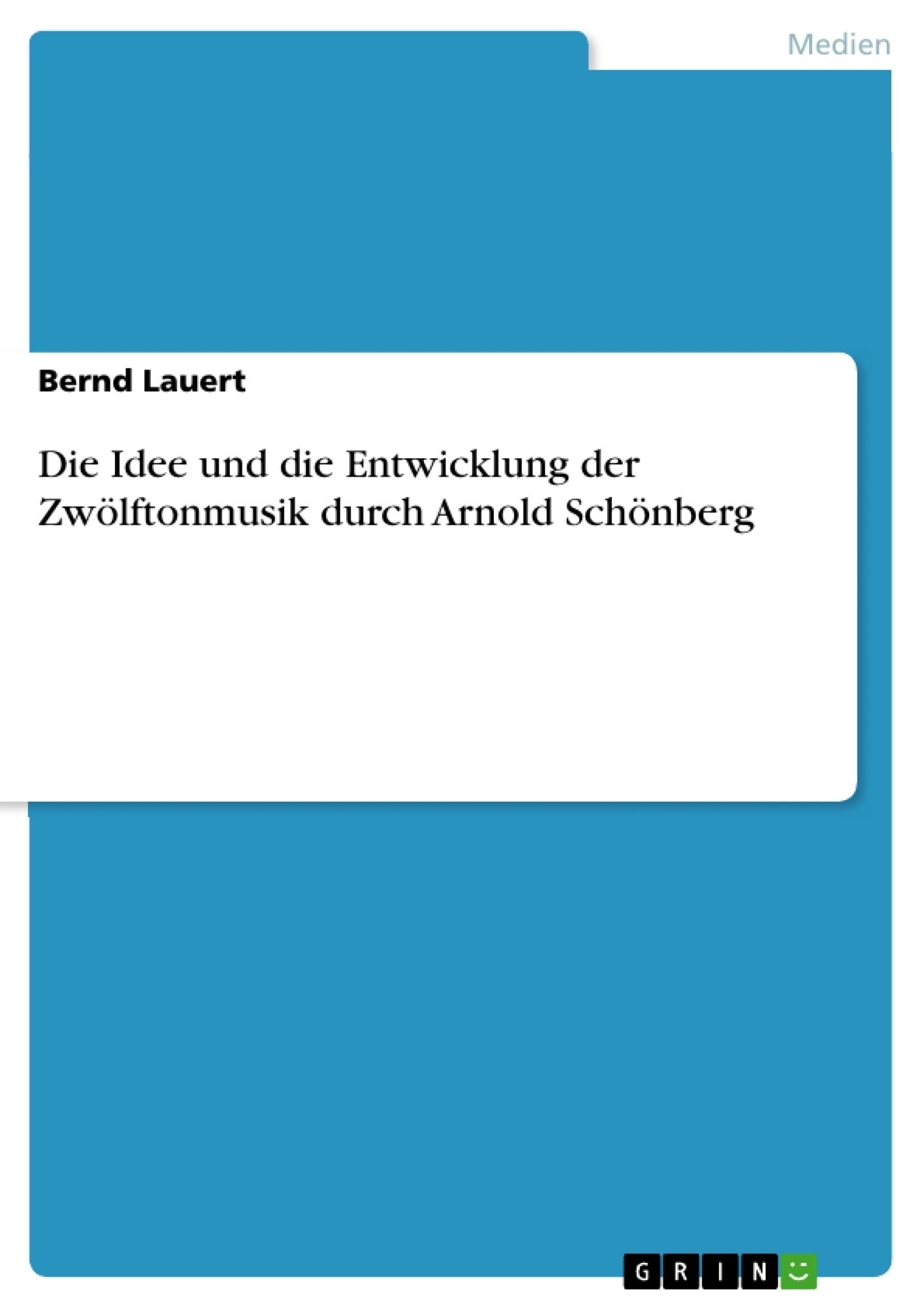Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Zwölftonmusik durch den Komponisten Arnold Schönberg (1874-1951).
Es wird außerdem darauf eingegangen, wie die Dissonanz sich emanzipierte und welchen Einfluss die Zwölftonmusik auf unsere heutige Musik hat.
Zwölftönigkeit als solche bedeutet, dass die Grundlage eines jeden Werkes eine unveränderliche Reihe aus Noten ist, die sämtliche Töne einer chromatischen Skala, ohne, dass sich einer dieser Töne wiederholt, enthält.
Diese Tendenzen zur Zwölftönigkeit innerhalb von Werken dieser Zeit, interpretierte Schönberg dahingehend, dass die Entwicklung zur Atonalität unbewusst geschieht und nicht nur aufgrund eines vorher aufgestellten Schemas, oder einer Technik erfolgt. Ein Ausspruch Schönbergs zu diesem Thema besagt auch, dass er die Zwölftonmusik nicht erfunden habe, sondern sie lediglich darauf wartete, entdeckt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Idee hinter der Zwölftonmusik
- Die Entwicklung der Zwölftonmusik
- Die Emanzipation der Dissonanz
- Wirkung der Zwölftonmusik auf die spätere Musik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Zwölftonmusik durch Arnold Schönberg. Sie beleuchtet Schönbergs Konzept der Zwölftonmusik, die damit verbundenen Herausforderungen und die Auswirkungen auf die Musik des 20. Jahrhunderts.
- Schönbergs Konzept der Zwölftonmusik und seine theoretischen Grundlagen
- Der Entwicklungsprozess der Zwölftontechnik und ihre Abgrenzung zur traditionellen Tonalität
- Die Rolle der Dissonanz und ihre Emanzipation in Schönbergs Werk
- Der Einfluss der Zwölftonmusik auf spätere musikalische Strömungen
- Der Vergleich zwischen Zwölftonmusik und der traditionellen Dur-Moll-Tonalität
Zusammenfassung der Kapitel
Idee hinter der Zwölftonmusik: Dieses Kapitel erörtert Schönbergs Ansatz zur Zwölftonmusik. Es wird die scheinbare Diskrepanz zwischen strengen Kompositionsregeln und künstlerischer Freiheit thematisiert. Schönbergs Suche nach einem Gleichgewicht zwischen intellektuellem Anspruch und musikalischer Intuition wird hervorgehoben, wobei die Bedeutung der Fantasie im kompositorischen Prozess betont wird. Der Vergleich mit der traditionellen Tonalität und die Analogie zur Grammatik in der Sprache verdeutlichen die Notwendigkeit einer Kompositionstechnik, um musikalische Ideen effektiv zu vermitteln. Der relative Charakter von Tonalität und die Versuche von Komponisten, neue Tonordnungen zu schaffen, werden als historischer Kontext für die Entstehung der Zwölftonmusik dargestellt.
Die Entwicklung der Zwölftonmusik: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Zwölftonmusik, ausgehend von den Versuchen im frühen 19. Jahrhundert, die traditionelle Tonalität zu überwinden. Die frühen Werke Schönbergs werden als Vorläufer der Zwölftontechnik betrachtet. Das Kapitel erläutert das Prinzip der Zwölftonreihe – eine unveränderliche Abfolge aller zwölf Töne der chromatischen Skala – und hebt Schönbergs Ansicht hervor, dass die Zwölftonmusik nicht erfunden, sondern entdeckt wurde. Die Entwicklung der Methode des Komponierens mit zwölf Tönen, ihre Abgrenzung von ähnlichen Ansätzen anderer Komponisten und der Unterschied zu der Dur-Moll-Tonalität im Bezug auf den strukturellen Überbau, werden detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf Schönbergs konsequentem Verzicht auf die Tonalität und den dadurch neu entstandenen Möglichkeiten der musikalischen Gestaltung.
Die Emanzipation der Dissonanz: Das Kapitel beleuchtet Schönbergs Auseinandersetzung mit dem Konzept der Dissonanz. Schönbergs Betrachtung der Dissonanz als entfernte Konsonanz und die daraus resultierende Relativierung des Unterschieds zwischen Konsonanz und Dissonanz werden ausführlich dargestellt. Die Gewöhnung des Publikums an Dissonanzen und der damit verbundene Wandel der musikalischen Wahrnehmung werden als zentrale Aspekte diskutiert. Die Emanzipation der Dissonanz als eines der Hauptziele Schönbergs und seiner Schüler wird hervorgehoben. Der Zusammenhang zwischen Dissonanz und Tonalität und die Erweiterung der kompositorischen Möglichkeiten durch die Emanzipation der Dissonanz werden analysiert.
Schlüsselwörter
Arnold Schönberg, Zwölftonmusik, Dodekaphonie, Tonalität, Atonalität, Dissonanz, Konsonanz, Komposition, Musik des 20. Jahrhunderts, Serielle Musik, Elektronische Musik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Zwölftonmusik nach Arnold Schönberg
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Zwölftonmusik, insbesondere im Kontext des Werks von Arnold Schönberg. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, den theoretischen Grundlagen und dem Einfluss der Zwölftonmusik auf die spätere Musikgeschichte.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen umfassen Schönbergs Konzept der Zwölftonmusik, die Entwicklung der Zwölftontechnik, die Emanzipation der Dissonanz, der Vergleich zur traditionellen Tonalität und der Einfluss der Zwölftonmusik auf spätere musikalische Strömungen. Das Dokument analysiert Schönbergs Ansatz, die Herausforderungen und die Auswirkungen seiner Kompositionsmethode auf die Musik des 20. Jahrhunderts.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es in ihnen?
Das Dokument enthält Kapitel zu folgenden Themen: "Idee hinter der Zwölftonmusik" (Schönbergs Ansatz, die scheinbare Diskrepanz zwischen strengen Regeln und künstlerischer Freiheit, der Vergleich mit traditioneller Tonalität); "Die Entwicklung der Zwölftonmusik" (Entwicklung der Zwölftontechnik, das Prinzip der Zwölftonreihe, Abgrenzung zu anderen Ansätzen); und "Die Emanzipation der Dissonanz" (Schönbergs Betrachtung der Dissonanz, der Wandel der musikalischen Wahrnehmung, die Erweiterung kompositorischer Möglichkeiten).
Wie wird Schönbergs Konzept der Zwölftonmusik dargestellt?
Schönbergs Konzept wird als Suche nach einem Gleichgewicht zwischen intellektuellem Anspruch und musikalischer Intuition beschrieben. Seine Zwölftontechnik wird als ein System dargestellt, das die traditionelle Tonalität bewusst vermeidet und neue Möglichkeiten der musikalischen Gestaltung eröffnet. Der Vergleich mit der Grammatik der Sprache wird verwendet, um die Notwendigkeit einer solchen Kompositionstechnik zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt die Dissonanz in Schönbergs Musik?
Die Emanzipation der Dissonanz ist ein zentrales Thema. Schönberg betrachtet Dissonanz als entfernte Konsonanz und relativiert den Unterschied zwischen beiden. Der Wandel der musikalischen Wahrnehmung durch die Gewöhnung an Dissonanzen wird als wichtiger Aspekt diskutiert. Die Dissonanz erweitert die kompositorischen Möglichkeiten und ist untrennbar mit der Zwölftontechnik verbunden.
Wie unterscheidet sich die Zwölftonmusik von der traditionellen Tonalität?
Die Zwölftonmusik verzichtet konsequent auf die traditionelle Dur-Moll-Tonalität. Sie basiert auf der Zwölftonreihe, einer unveränderlichen Abfolge aller zwölf Töne der chromatischen Skala. Dies führt zu neuen Möglichkeiten der musikalischen Gestaltung und einer anderen Art der musikalischen Struktur im Vergleich zur traditionellen Tonalität.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des Textes?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Arnold Schönberg, Zwölftonmusik, Dodekaphonie, Tonalität, Atonalität, Dissonanz, Konsonanz, Komposition, Musik des 20. Jahrhunderts, Serielle Musik, Elektronische Musik.
- Quote paper
- Bernd Lauert (Author), 2012, Die Idee und die Entwicklung der Zwölftonmusik durch Arnold Schönberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334687