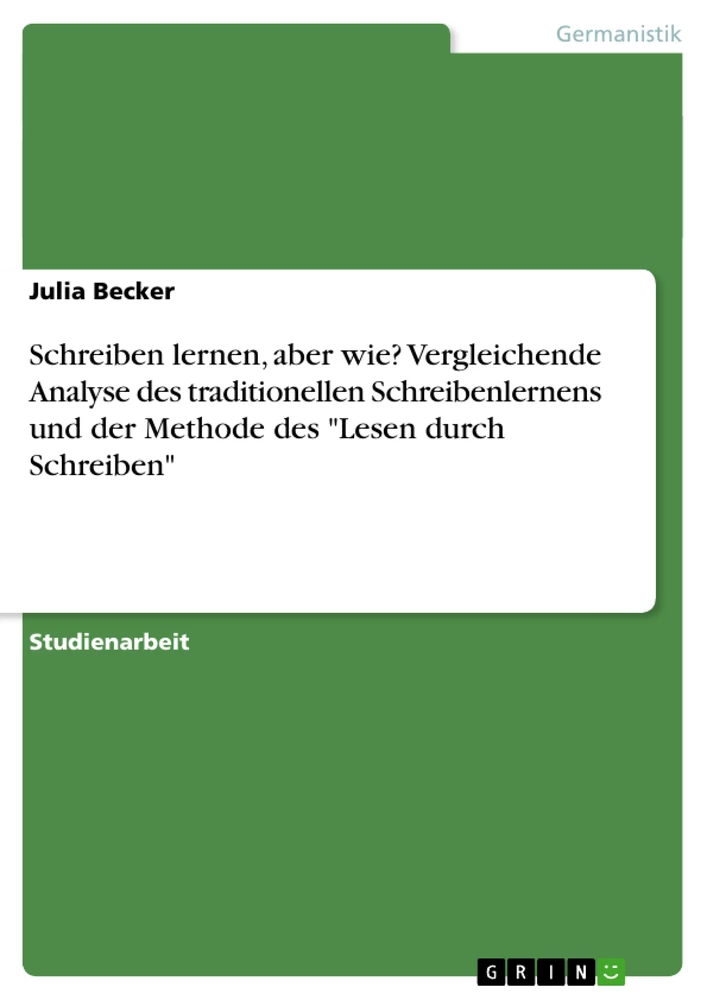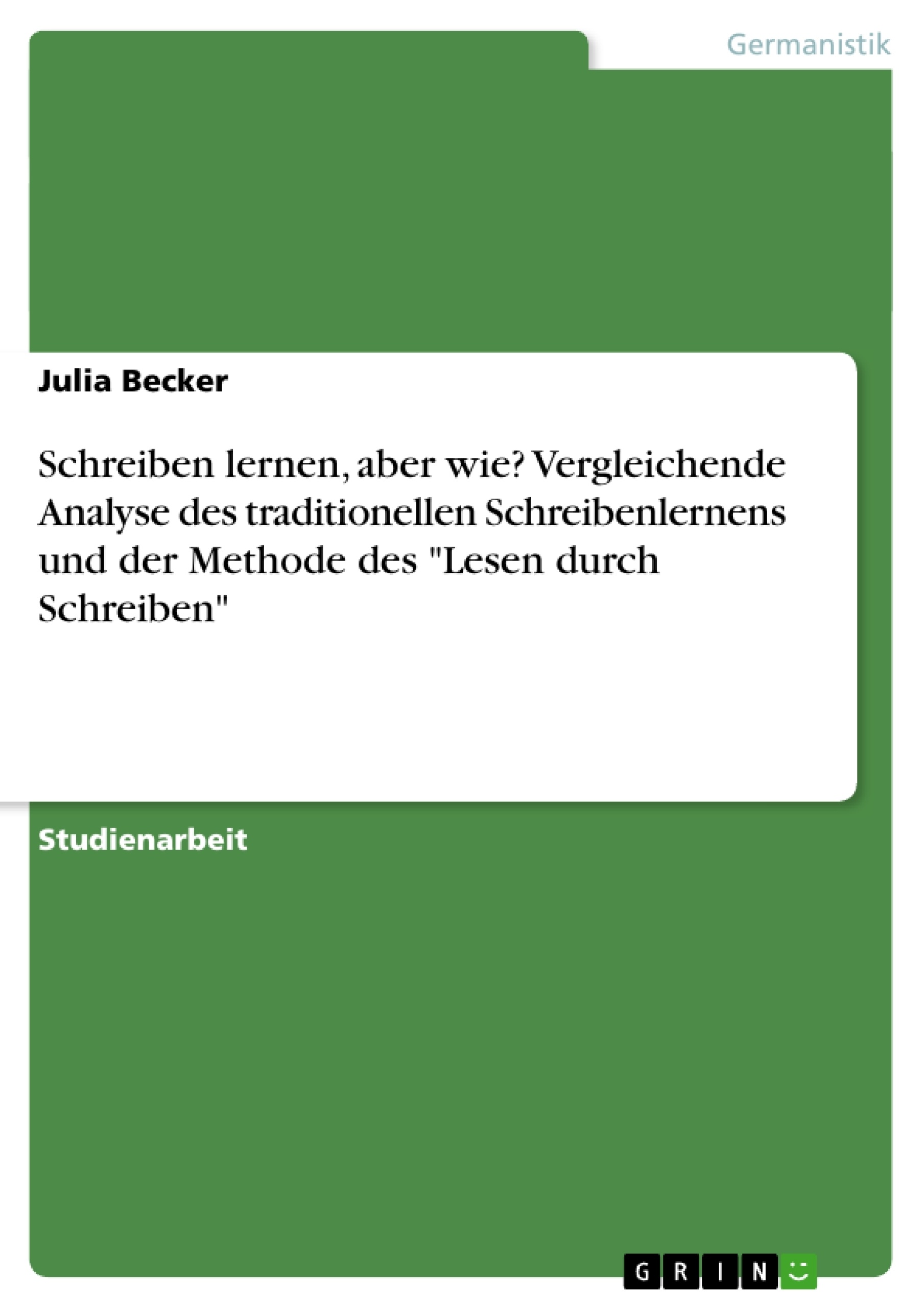Was wären wir ohne die Schrift?
Wie wichtig für uns die Schrift als Kommunikationsmittel in vielen Bereichen des täglichen Lebens und im Beruf ist, merken wir manchmal schon nicht mehr, weil sie bereits unbewusst und automatisch eingesetzt wird. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man den Schulanfängern am günstigsten die Schrift lehrt, damit auch sie später fähig sind, sich problemlos schriftlich zu äußern.
Bei dem allgemeinen Begriff „Schriftspracherwerb“ sind verschiedene Teilbereiche zu berücksichtigen. Dazu gehört zum einen die Feinmotorik, die der technischen Ausführung der Buchstaben dient. Zum anderen wird eine korrekte Rechtschreibung erwartet, die ebenfalls als Ziel des Schriftspracherwerbs gesetzt wird. Der Lehrplan für den Sprachunterricht sieht vor, dass mit dem Verlassen der Grundschule die Kinder fähig sein sollten, Texte zu entwickeln und zu differenzieren.
Das Problem, das sich mir zu diesem Thema stellt, ist die Frage nach der besten Methode, die Schrift zu lehren.
Dazu werde ich allgemein die Ziele des Schriftspracherwerbs und die beiden Möglichkeiten, die Schriftsprache zu lehren, herausstellen und näher auf ihre Vor- und Nachteile eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Autor
- III. Inhalt
- IV. Kapitel 1: Freude
- 4.1 Der Lehrer im Zentrum
- 4.2 Scheinbare Kinderzentriertheit
- 4.3 Radikaler Kurswechsel
- V. Kapitel 2: Erlebnis
- 5.1 Interesse, aber wie?
- 5.2 Wahlfreiheit und Stundenplan
- VI. Kapitel 3: Theoretiker
- 6.1 Gebundener Ansatz - gefesselte Kinder
- 6.2 Aufsätze als Erziehungsmittel
- VII. Kapitel 4: Erstes Schreiben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert kritisch den traditionellen Deutschunterricht und dessen Herangehensweise an das Schreibenlernen, insbesondere die Aufsatzdidaktik. Sie vergleicht diese mit dem Ansatz „Lesen durch Schreiben“ und untersucht, inwiefern die bestehenden Methoden den Bedürfnissen und Interessen der Schüler gerecht werden. Das Hauptziel ist es, die Stärken und Schwächen verschiedener Lehrmethoden aufzuzeigen und mögliche Verbesserungen aufzuzeigen.
- Kritik am lehrerzentrierten Unterricht
- Der Stellenwert von Schülerinteressen im Schreibprozess
- Analyse verschiedener didaktischer Ansätze
- Die Rolle des Spaßes und der Freude am Schreiben
- Der Einfluss von Lehrern und Lehrplänen auf die Schreibmotivation von Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Freude: Dieses Kapitel analysiert die Problematik des lehrerzentrierten Unterrichts im Deutschunterricht, besonders im Bereich des Schreibens. Sennlaub argumentiert, dass der Fokus auf wissenschaftlichen Methoden und Lehrplänen die Interessen der Kinder vernachlässigt und zu mangelnder Freude am Schreiben führt. Der Begriff der „scheinbaren Kinderzentriertheit“ wird eingeführt, um Methoden zu kritisieren, die zwar kinderorientiert erscheinen, aber letztendlich die Lehrziele des Lehrers in den Vordergrund stellen. Das Kapitel plädiert für einen radikalen Kurswechsel, bei dem die Schüler und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und der Spaß am Schreiben im Vordergrund steht. Historische Reformer des Deutschunterrichts werden als Vorbilder für einen schülerorientierten Ansatz genannt.
Kapitel 2: Erlebnis: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie man das Interesse der Schüler am Schreiben wecken kann. Es wird betont, dass Kinder nur dann gerne schreiben, wenn sie etwas mitteilen wollen, das sie bewegt. Der Lehrer soll Themen setzen, die die Kinder wirklich ansprechen und herausfordern. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass scheinbar passende Themen das wirkliche Interesse der Kinder nicht immer wecken können. Die Diskussion um „Schülerorientiertes Schreiben“ wird kritisch beleuchtet und als oft nur scheinbar schülerzentriert dargestellt.
Kapitel 3: Theoretiker: Kapitel 3 analysiert verschiedene theoretische Ansätze im Aufsatzunterricht. Es wird der „gebundene Ansatz“ kritisiert, der die Kinder in vorgegebene Strukturen zwingt und ihre Kreativität einschränkt. Aufsätze werden oft als Erziehungsmittel gesehen, was das Interesse der Schüler am Schreiben weiter mindert. Der Fokus liegt hier auf der Kritik an traditionellen Lehrmethoden und dem Aufzeigen der negativen Konsequenzen für die Schüler.
Kapitel 4: Erstes Schreiben: (Anmerkung: Ohne den vollständigen Text von Kapitel 4 ist eine detaillierte Zusammenfassung nicht möglich. Es wird empfohlen, den vollständigen Text bereitzustellen, um eine aussagekräftige Zusammenfassung zu erstellen.)
Schlüsselwörter
Lehrerzentrierter Unterricht, Schülerzentrierter Unterricht, Schreibdidaktik, Aufsatzerziehung, Interesse, Freude am Schreiben, Schülermotivation, Lesen durch Schreiben, Kinderbedürfnisse, Lehrmethoden, kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des traditionellen Deutschunterrichts und des Schreiblernens
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Arbeit analysiert kritisch den traditionellen Deutschunterricht und dessen Herangehensweise an das Schreibenlernen, insbesondere die Aufsatzdidaktik. Sie vergleicht diese mit dem Ansatz „Lesen durch Schreiben“ und untersucht, inwiefern die bestehenden Methoden den Bedürfnissen und Interessen der Schüler gerecht werden.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Hauptziel ist es, die Stärken und Schwächen verschiedener Lehrmethoden aufzuzeigen und mögliche Verbesserungen aufzuzeigen. Es werden die Kritik am lehrerzentrierten Unterricht, der Stellenwert von Schülerinteressen, verschiedene didaktische Ansätze, die Rolle des Spaßes und der Freude am Schreiben sowie der Einfluss von Lehrern und Lehrplänen auf die Schreibmotivation untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 ("Freude") analysiert die Problematik lehrerzentrierten Unterrichts und plädiert für einen radikalen Kurswechsel hin zu schülerorientierten Methoden. Kapitel 2 ("Erlebnis") befasst sich mit der Frage, wie Schülerinteresse am Schreiben geweckt werden kann, und kritisiert scheinbar schülerzentrierte Ansätze. Kapitel 3 ("Theoretiker") analysiert verschiedene theoretische Ansätze im Aufsatzunterricht und kritisiert den "gebundenen Ansatz". Kapitel 4 ("Erstes Schreiben") wird ohne detaillierte Zusammenfassung vorgestellt, da der vollständige Text fehlt.
Welche Kritikpunkte werden an traditionellen Methoden geäußert?
Die Arbeit kritisiert den lehrerzentrierten Unterricht, der die Interessen der Kinder vernachlässigt und zu mangelnder Freude am Schreiben führt. Der Fokus auf wissenschaftlichen Methoden und Lehrplänen wird als hinderlich für die Schülermotivation angesehen. Der "gebundene Ansatz" im Aufsatzunterricht wird als kreativitätshemmend kritisiert, ebenso wie die Verwendung von Aufsätzen als reine Erziehungsmittel.
Welche Alternativen oder Verbesserungsvorschläge werden genannt?
Die Arbeit plädiert für einen radikalen Kurswechsel hin zu einem schülerzentrierten Unterricht, in dem die Bedürfnisse und Interessen der Schüler im Mittelpunkt stehen und der Spaß am Schreiben im Vordergrund steht. Es wird betont, dass Schüler nur dann gerne schreiben, wenn sie etwas mitteilen wollen, das sie bewegt. Der Ansatz „Lesen durch Schreiben“ wird als Gegenmodell zum traditionellen Ansatz genannt, jedoch ohne detaillierte Erläuterung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Lehrerzentrierter Unterricht, Schülerzentrierter Unterricht, Schreibdidaktik, Aufsatzerziehung, Interesse, Freude am Schreiben, Schülermotivation, Lesen durch Schreiben, Kinderbedürfnisse, Lehrmethoden und kritische Analyse.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Die bereitgestellte Vorschau enthält nicht den vollständigen Text, insbesondere fehlt Kapitel 4. Um eine umfassendere Analyse zu ermöglichen, wird der vollständige Text benötigt.
- Quote paper
- Julia Becker (Author), 2003, Schreiben lernen, aber wie? Vergleichende Analyse des traditionellen Schreibenlernens und der Methode des "Lesen durch Schreiben", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33069