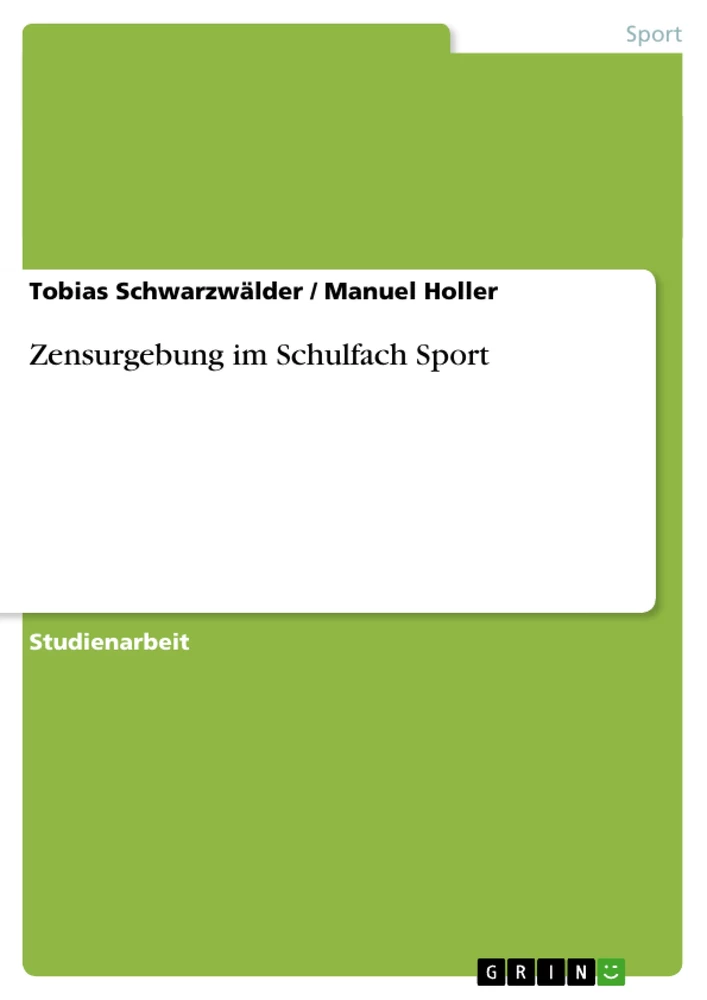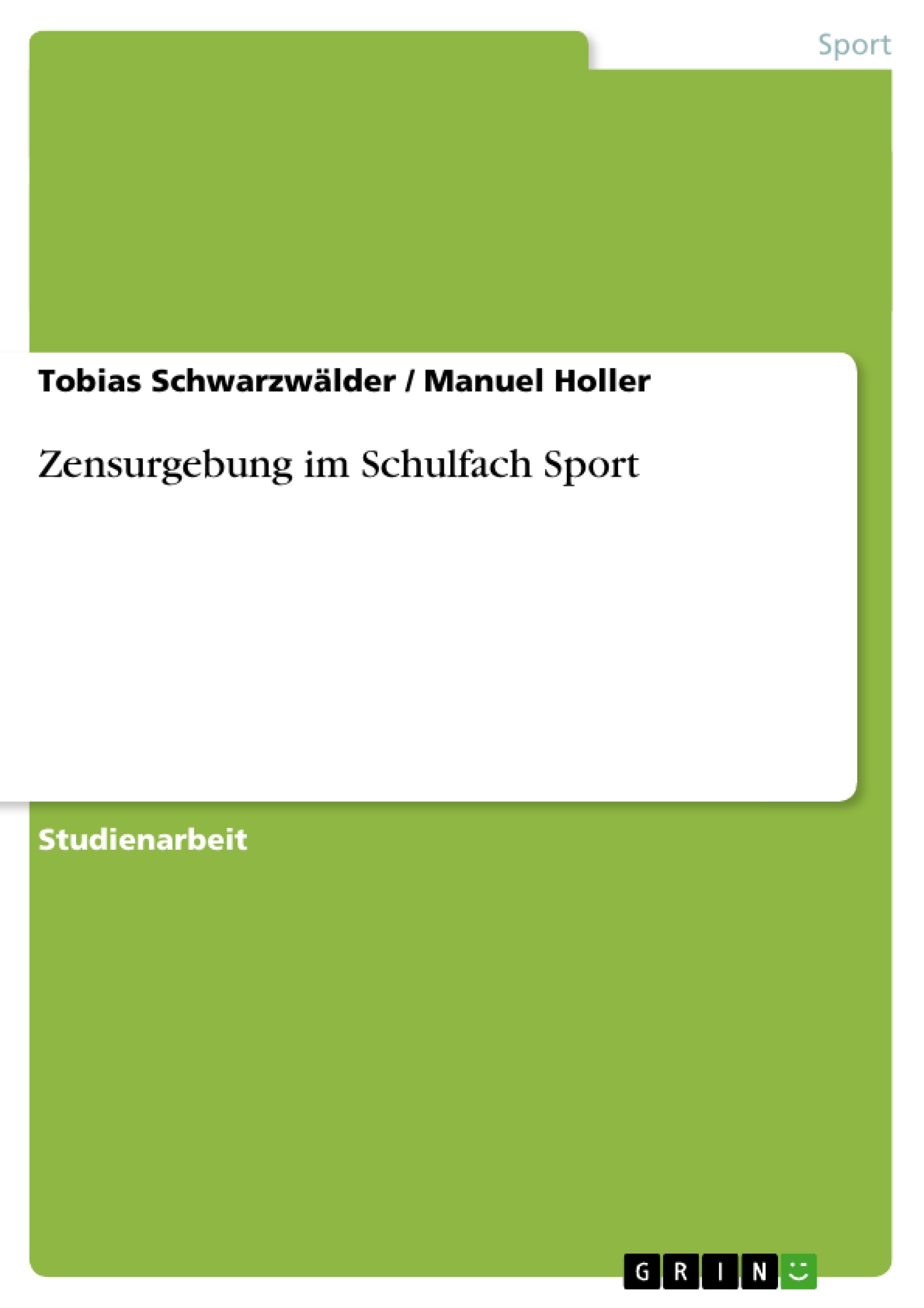Der Sportunterricht ist ein Unterrichtsfach wie jedes andere Fach auch. Es ist zum Beispiel in den Sekundarstufen der Primarstufe und der Sekundarstufe verankert und wird in der Regel durch fachlich ausgebildete Lehrkräfte erteilt. In Bezug auf die Benotung hat der Schulsport schon lange sein Monopol aufgeben müssen. In fast allen 16 Bundesländern ist die Sportzensur mittlerweile versetzungsrelevant und seit Mitte der 70er Jahre ist Sport als Abitursfach gleichberechtigt etabliert (vgl. Tillmann, 2001, S.45). Hierdurch steigen natürlich auch die Erwartungen der Schüler und Eltern für die Notengebung. Sie fordern eine „angemessene und gerechte“ Sportnote. Aber der Sportunterricht ist aufgrund seiner besonderen Inhaltlichkeit ein separat zu betrachtendes Unterrichtsfach.
Der „Gegenstand“ von Sport ist nun mal der eigene Körper und seine Bewegungen. In der Aneignung und Weiterentwicklung motorischer Kompetenzen ist das Schulfach Sport einzigartig (vgl. Tillmann, 2001, S.45). Und in Anbetracht dessen resultiert daraus die Problematik bei der Zensurgebung im Schulfach Sport. Es wird nicht die Aufgabenlösung- wie in anderen Fächern- auf Papier gebracht, sondern das Ziel soll ein gekonnter, ästhetisch aussehender Bewegungsablauf sein.
Die Besonderheit des Faches Sport liegt in der Möglichkeit, die Schülerleistungen exakt zu messen. Viele Sportarten zeichnen sich dadurch aus, dass die individuell erbrachten Ergebnisse präzise angegeben werden können (Bsp. Leichtathletik). Da aber die genetischen und hierdurch resultierenden anthropometrischen Merkmale eine sehr relevante Rolle spielen, entsteht eine Ungerechtigkeit gegenüber den „kleineren und schwächeren“ Schülern. Deshalb spielt im Schulsport die Einbeziehung von „Verhaltensbewertungen eine viel größere Rolle als in allen anderen Fächern“ (Tillmann, 2001, S.45).
Durch diese Eigenheiten des Schulfaches Sport und seiner Zensurgebung resultieren etliche Fragen.
Im Folgenden werden nun die- für die Autoren- relevantesten Fragen aufgelistet:
· Wie setzt sich die Sportnote zusammen?
· Welche Kriterien sind involviert?
· Welcher Zusammenhang besteht in Bezug auf den Leistungszuwachs?
· Welche sozialen und individuellen Kriterien haben eine entscheidende Gewichtung?
· Kann man überhaupt eine „faire“ Zensurengebung erreichen?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Wissenswertes über die Zensur (-gebung)
- Historische Entwicklung
- Terminologische Überlegung
- Zensurgebung
- Zusammensetzung
- Motorische Leistungen
- Individueller Lernzuwachs
- Soziales und sportliches Verhalten
- Funktionen der Zensur
- Orientierungs- und Berichtsfunktion
- Pädagogische Funktion
- Zusammensetzung
- Die pädagogisch-ethischen Überlegungen
- Transfer Leistung - Zensur
- Fehlerquellen in der Beurteilung
- Der logische Fehler
- Der Halo-Effekt
- Perseverationstendenz
- Reihungseffekt
- Kontrasteffekt
- Beurteilungstendenzen
- Projektionsfehler
- Der „Wissen-um-die-Folgen-Fehler“
- Der Pygmalion-Effekt
- Geschlechtsspezifische Probleme
- Sinn der Sportnote
- Die Sportnote ist sinnvoll und notwendig
- Die Sportnote ist sinnlos und unnötig
- Optimierung einer „objektiven“ Leistungsbewertung
- Beispiel: Zensurgebung im Schulhandball
- Vorbemerkungen
- Pädagogisch-psychologische Überlegungen
- Gruppeneinfluss
- Der Halo-Effekt
- Der Pygmalion-Effekt
- Fehler im strukturellen Bereich
- Was soll in der Zensur involviert sein?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Zensurgebung im Schulfach Sport. Ziel ist es, die Zusammensetzung der Sportnote, die involvierten Kriterien und die pädagogisch-ethischen Herausforderungen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert Beurteilungsfehler und diskutiert die kontroverse Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit von Sportnoten.
- Zusammensetzung und Funktionen von Sportnoten
- Pädagogisch-ethische Implikationen der Leistungsbeurteilung im Sport
- Analyse von Beurteilungsfehlern
- Diskussion der Notwendigkeit von Sportnoten
- Beispielhafte Betrachtung der Zensurgebung im Schulhandball
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die unvermeidliche Rolle der Leistungsbewertung im Schulkontext und fokussiert auf die Herausforderungen der Leistungsfeststellung im Schulsport. Es hebt die Absicht hervor, den Leser zum Nachdenken über eine "moralisch-ethisch-faire" Sportzensur anzuregen, ohne konkrete Handlungsanweisungen für Sportlehrer zu geben.
Einleitung: Die Einleitung stellt den Sportunterricht als reguläres Schulfach dar, dessen Benotung seit den 1970er Jahren versetzungsrelevant und im Abitur etabliert ist. Sie hebt die Besonderheit des Sportunterrichts hervor, in dem die individuelle Leistung nicht nur durch Ergebnisse, sondern auch durch Bewegungsabläufe und Verhalten bewertet wird. Die Problematik der Zensurgebung im Schulsport aufgrund der Berücksichtigung individueller körperlicher Merkmale und der Einbeziehung von Verhaltensbewertungen wird herausgestellt.
Wissenswertes über die Zensur (-gebung): Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Ursprung des Begriffs „Zensur“ im alten Rom und seine Entwicklung. Es thematisiert den Begriff der „Leistungsbeurteilung“ und legt die Grundlage für das Verständnis der Zensurgebung im Kontext des Schulsportes.
Zensurgebung: Dieses Kapitel beschreibt die Zusammensetzung der Sportnote, indem es motorische Leistungen, individuellen Lernzuwachs und soziales sowie sportliches Verhalten als wesentliche Bewertungskriterien identifiziert. Die Funktionen der Zensur, insbesondere die Orientierungs- und Berichtsfunktion sowie die pädagogische Funktion, werden erklärt.
Die pädagogisch-ethischen Überlegungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Übertragung von Leistungen in Zensuren und analysiert verschiedene Fehlerquellen in der Beurteilung, wie den Halo-Effekt, Perseverationstendenzen und weitere kognitive Verzerrungen. Es diskutiert geschlechtsspezifische Probleme und die kontroverse Frage nach dem Sinn der Sportnote, indem es die Positionen „sinnvoll und notwendig“ und „sinnlos und unnötig“ gegenüberstellt. Die Optimierung einer „objektiven“ Leistungsbewertung wird angesprochen.
Beispiel: Zensurgebung im Schulhandball: Dieses Kapitel bietet einen konkreten Einblick in die Zensurgebung im Schulhandball. Es verbindet die zuvor diskutierten theoretischen Überlegungen mit der Praxis und untersucht die Rolle von Gruppeneinflüssen, dem Halo-Effekt, dem Pygmalion-Effekt und weiteren strukturellen Fehlerquellen bei der Bewertung.
Schlüsselwörter
Zensurgebung, Schulsport, Leistungsbeurteilung, Sportnote, pädagogisch-ethische Überlegungen, Beurteilungsfehler, Objektivität, Fairness, Schulhandball, Motorik, Sozialverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Zensurgebung im Schulsport
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Zensurgebung im Schulfach Sport. Sie beleuchtet die Zusammensetzung der Sportnote, die involvierten Kriterien und die pädagogisch-ethischen Herausforderungen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert Beurteilungsfehler, diskutiert die kontroverse Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit von Sportnoten und bietet einen beispielhaften Einblick in die Zensurgebung im Schulhandball.
Welche Aspekte der Sportnote werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Zusammensetzung der Sportnote (motorische Leistungen, individueller Lernzuwachs, soziales und sportliches Verhalten), ihre Funktionen (Orientierungs- und Berichtsfunktion, pädagogische Funktion) und die damit verbundenen pädagogisch-ethischen Implikationen.
Welche Beurteilungsfehler werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Fehlerquellen in der Beurteilung, wie den Halo-Effekt, Perseverationstendenzen, den Reihungseffekt, den Kontrasteffekt, Beurteilungstendenzen, Projektionsfehler, den „Wissen-um-die-Folgen-Fehler“ und den Pygmalion-Effekt. Im Kontext des Schulhandballs werden zusätzlich Gruppeneinflüsse und strukturelle Fehlerquellen betrachtet.
Wird die Notwendigkeit von Sportnoten diskutiert?
Ja, die Arbeit diskutiert die kontroverse Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit von Sportnoten, indem sie die Positionen „sinnvoll und notwendig“ und „sinnlos und unnötig“ gegenüberstellt.
Wie wird die Zensurgebung im Schulhandball betrachtet?
Die Arbeit bietet einen konkreten Einblick in die Zensurgebung im Schulhandball, indem sie die zuvor diskutierten theoretischen Überlegungen mit der Praxis verbindet und die Rolle von Gruppeneinflüssen, dem Halo-Effekt, dem Pygmalion-Effekt und weiteren strukturellen Fehlerquellen bei der Bewertung untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zensurgebung, Schulsport, Leistungsbeurteilung, Sportnote, pädagogisch-ethische Überlegungen, Beurteilungsfehler, Objektivität, Fairness, Schulhandball, Motorik, Sozialverhalten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Vorwort, Einleitung, Wissenswertes über die Zensur, Zensurgebung, pädagogisch-ethische Überlegungen, Zensurgebung im Schulhandball und Resümee. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Gibt die Arbeit konkrete Handlungsanweisungen für Sportlehrer?
Nein, die Arbeit regt zum Nachdenken über eine "moralisch-ethisch-faire" Sportzensur an, gibt aber keine konkreten Handlungsanweisungen für Sportlehrer.
Welche historische Perspektive bietet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Ursprung des Begriffs „Zensur“ im alten Rom und seine Entwicklung bis hin zur Anwendung im Kontext des Schulsportes.
- Citation du texte
- Tobias Schwarzwälder (Auteur), Manuel Holler (Auteur), 2004, Zensurgebung im Schulfach Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32858