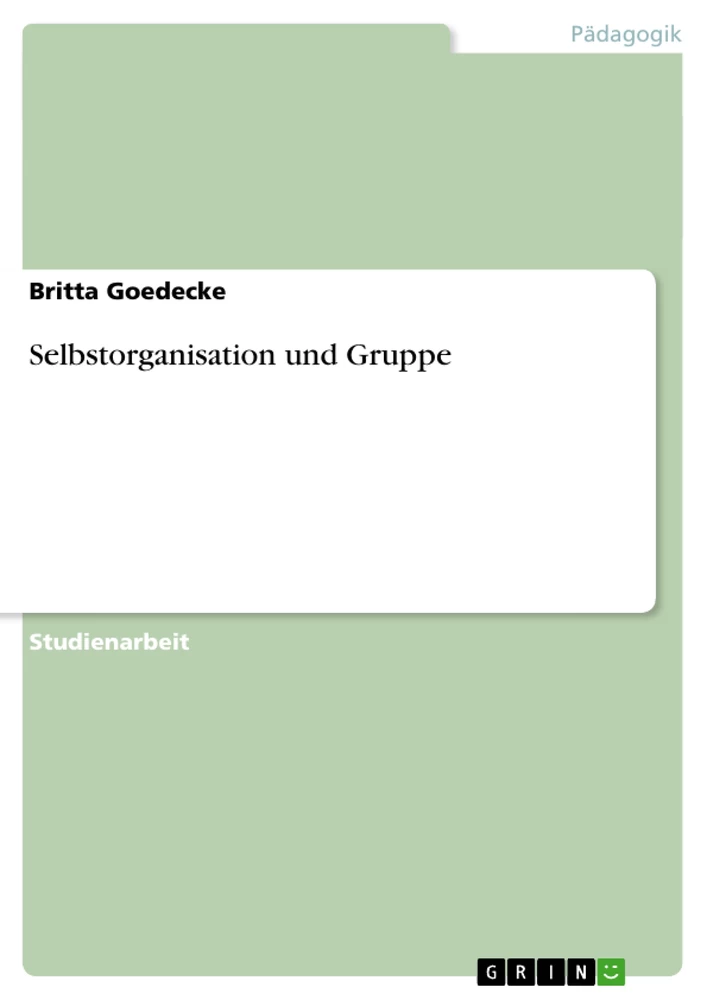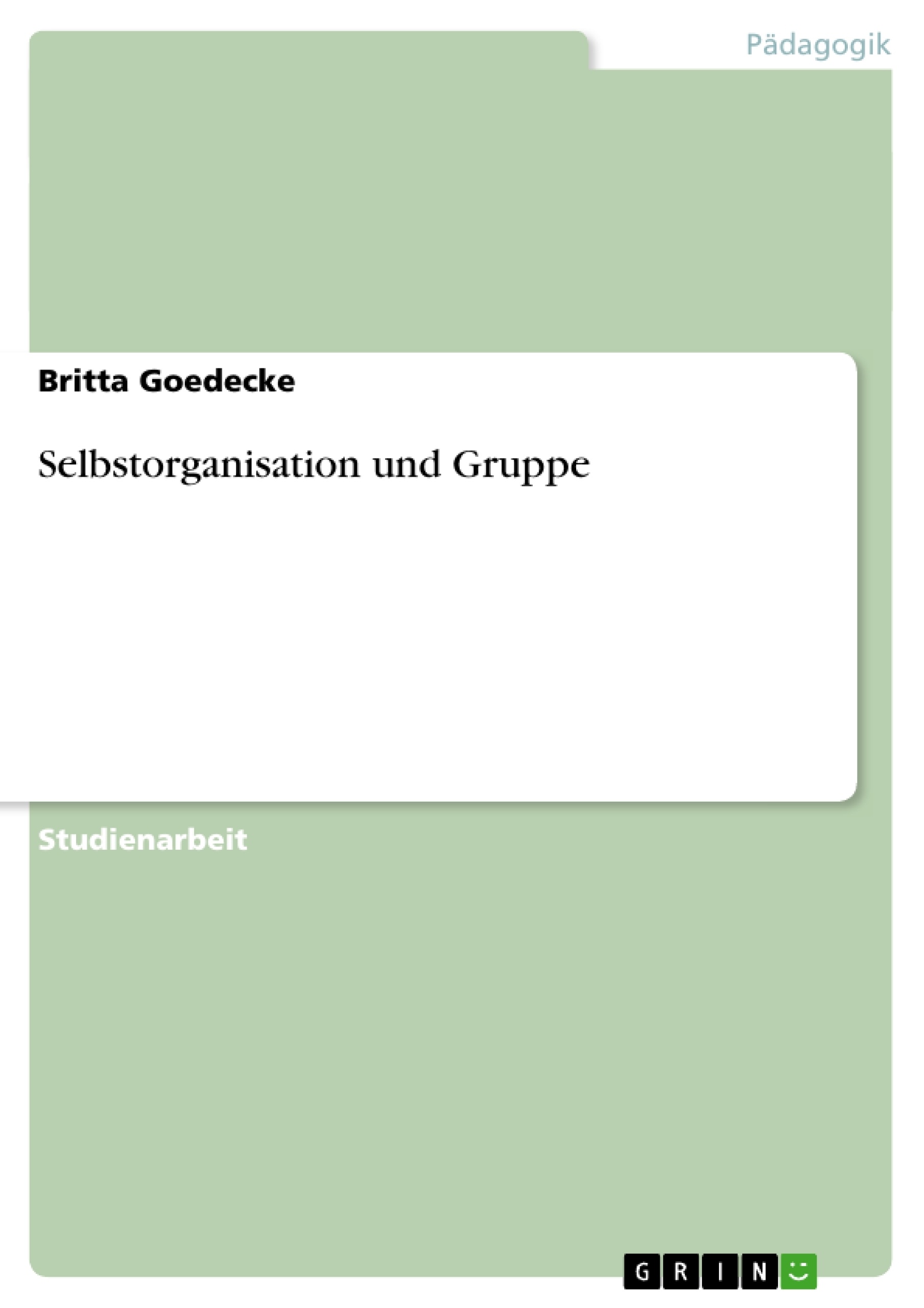Seit den 70er Jahren ist eine Entwicklung zu beobachten, in der sich Gruppen aus den unterschiedlichsten Bereichen, vom gesundheitlichen Bereich über die Politik bis hin zu Wohngemeinschaften und Betrieben, verselbstständigen. Kontrolle und Abhängigkeit werden abgelehnt, der Wunsch nach individueller Gestaltungsfreiheit wird laut. Es bildeten sich Selbsthilfegruppen, Initiativen und Bewegungen die den Anspruch haben „Lebensbereiche, die der eigenen Verfügbarkeit verlorengegangen bzw. entzogen sind, (wieder) selbst in die Hand zu nehmen.“1 Merkmale sozialer Selbsthilfe2:
· Autonomie: Handeln aufgrund selbstbestimmter Vereinigungen von Bürgern, nicht veranlasst und geleitet von einer Organisations zentrale
· Selbstgestaltung: Handeln als freiwilliges Mitgestalten, nicht nur Mitbestimmung gesellschaftlicher Tatbestände- sei es als Ergänzung, sei es als Reform von oder als Alternative zu bestehenden Sozialstrukturen.
· Solidarität (Sozialengagement): Handeln nicht nur für sich, sondern auch für andere bzw. für ein größeres Gemeinsames, ein Gemeinwohl mit dem Ziel einer alternativen Lebensordnung, einer solidarischen statt der bestehenden Herrschaftsgesellschaft.
· Betroffenheit: Handeln in einem überschaubaren, von den Handelnden kompetent mitgestaltbaren gesellschaftlichen Nahbereich in der Lebens- oder Arbeitswelt.
Bei der Gründung selbstorganisierter Gruppen ist die Hoffnung vorhanden, im Gegensatz zu fremdbestimmten Gruppen, das Funktionen und Strukturen von selbst entstehen, ohne, dass hierfür gesorgt werden muss. Doch auch in sozialen Systemen, die unabhängig von deren Umwelt agieren müssen Entscheidungen getroffen werden, die unter bestimmten Regeln der Zusammenarbeit stehen. Es müssen nach wie vor Beziehungen zur Umwelt aufrecht erhalten werden, die unter Umständen relevant sind (z.B. für die Werbung von neuen Mitgliedern). Frei von Fremdbestimmung, entwickeln sich Zwänge innerhalb des Systems. Die individuelle Autonomie ist nicht mehr gegeben, wenn das System als ganzes autonom handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Selbstorganisation
- Zum Begriff der Selbstorganisation
- Das Systemverständnis Schattenhofers
- evolvierende Systeme – konservative Systeme
- selbstorganisierte Systeme
- strukturell offen
- operational geschlossen
- Selbstreferentialität
- Entwicklungs- und Veränderungsprozesse
- Ordnung durch Störung
- Ordnung durch Fluktuation
- Modellvorstellungen versus Realität
- Das Untersuchungsmodell
- Die zwei Ebenen
- Die erste Ebene: Der Entwicklungsprozess, oder: was passiert?
- Das „Feste“: Kontinuität und Bewahrung der Identität
- Das „Bewegliche“: Der Entwicklungsprozess, die dynamische Perspektive
- Die zweite Ebene: Die Ebene der Selbststeuerung
- Reflexion
- Leitung
- Gruppeneigene Modelle der Gruppe
- Methodisches
- Die Methodik
- Bedingungen für die Auswahl der Methode
- Die Methode
- Die Auswahl der teilnehmenden Gruppen
- Die Auswertung der Daten
- Die Ergebnisse
- Ergebnisse: Reflexion
- Ergebnisse: Leitung
- Ergebnisse: Gruppeneigene Modelle
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Selbstorganisationsprozessen in Gruppen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen, wobei der Fokus auf die Steuerungsprozesse gelegt wird. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis der Dynamik und Herausforderungen von selbstorganisierten Gruppen zu erlangen.
- Das Systemverständnis von Selbstorganisation im Kontext von Gruppen
- Die Unterscheidung zwischen evolvierenden und konservativen Systemen
- Die Bedeutung von Selbstreferentialität in selbstorganisierten Systemen
- Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in selbstorganisierten Gruppen
- Die Rolle von Reflexion, Leitung und gruppeneigenen Modellen in der Selbststeuerung von Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet den Begriff der Selbstorganisation und seine Entwicklung in den 70er Jahren. Er beschreibt die Entstehung von Selbsthilfegruppen, Initiativen und Bewegungen, die sich für Autonomie und Selbstgestaltung einsetzten. Der zweite Teil analysiert das Systemverständnis von Karl Schattenhofer und stellt die Unterscheidung zwischen evolvierenden und konservativen Systemen dar. Er erklärt die Merkmale von selbstorganisierten Systemen, wie strukturelle Offenheit, operationale Geschlossenheit und Selbstreferentialität. Weiterhin werden die Entwicklungsprozesse in selbstorganisierten Gruppen im Kontext von Ordnung durch Störung und Fluktuation beleuchtet. Das dritte Kapitel behandelt das Untersuchungsmodell, das sich auf zwei Ebenen konzentriert: den Entwicklungsprozess und die Ebene der Selbststeuerung. Es erläutert die beiden Ebenen und ihre spezifischen Merkmale. Das vierte Kapitel widmet sich den methodischen Aspekten der Untersuchung und erklärt die Bedingungen für die Auswahl der Methode, die Methode selbst, die Auswahl der teilnehmenden Gruppen und die Auswertung der Daten.
Schlüsselwörter
Selbstorganisation, Gruppe, Selbststeuerung, Systemverständnis, Schattenhofer, evolvierende Systeme, konservative Systeme, Selbstreferentialität, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse, Reflexion, Leitung, gruppeneigene Modelle, Methodik, Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Merkmale sozialer Selbsthilfe?
Zentrale Merkmale sind Autonomie (selbstbestimmtes Handeln), Selbstgestaltung, Solidarität für das Gemeinwohl und die persönliche Betroffenheit der Mitglieder.
Was versteht Schattenhofer unter Selbstreferentialität?
Selbstreferentialität bedeutet, dass ein System seine Operationen und Entscheidungen auf sich selbst bezieht und so seine eigene Identität und Struktur unabhängig von der Umwelt erhält.
Können selbstorganisierte Gruppen völlig frei von Zwängen sein?
Nein, oft entwickeln sich innerhalb des Systems neue Zwänge und Regeln der Zusammenarbeit, die die individuelle Autonomie zugunsten des Gesamtgefüges einschränken können.
Welche Rolle spielt die Leitung in einer selbstorganisierten Gruppe?
Auch in autonomen Gruppen sind Steuerungsfunktionen wie Reflexion und Koordination notwendig, wobei die Leitung oft kollektiv oder situativ wahrgenommen wird.
Was bedeutet 'Ordnung durch Fluktuation'?
Es beschreibt den Prozess, bei dem kleine Veränderungen oder Störungen innerhalb der Gruppe zu einer neuen, stabileren Organisationsform führen können.
- Quote paper
- Britta Goedecke (Author), 2003, Selbstorganisation und Gruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32362