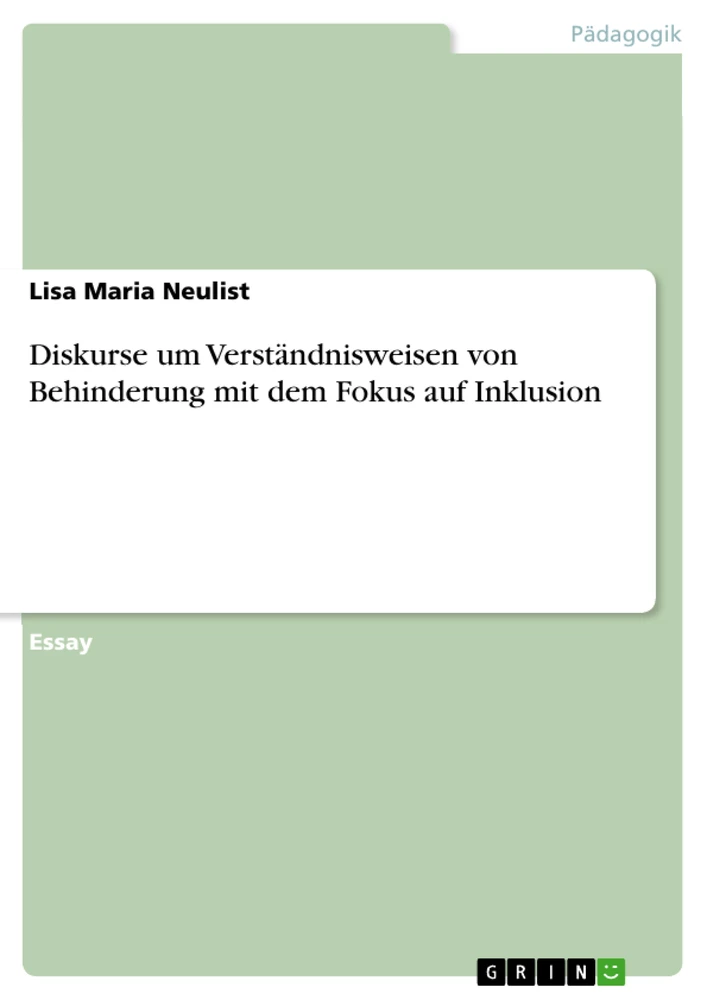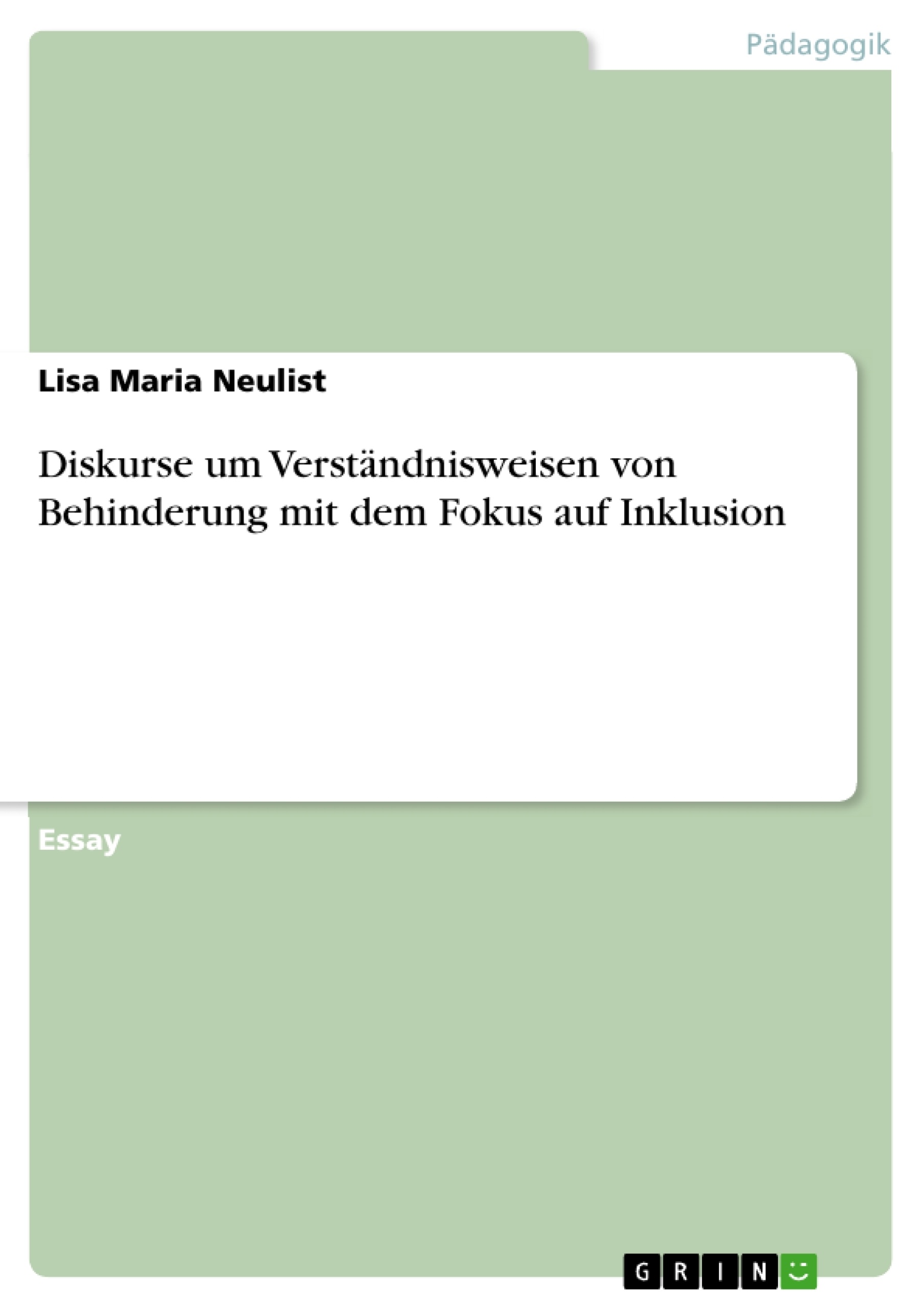Ziel dieser Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Verständnissen von Behinderung des professionsbezogenen Diskurses in der Behindertenpädagogik, um genau zu dieser reflektierten Haltung zu Gelangen. Gemäß dem historischen Diskurswechsel wird zunächst das individualtheoretische (medizinische) Modell skizziert und anschließend das soziale Modell. Im letzten Schritt sollen die ICIDH und Die ICF skizziert werden, wodurch beide Modelle integriert wurden und Kontextfaktoren in das Konstrukt Behinderung einbezo-gen wurden. Bei letzterem soll deutlich werden, was der Anteil der ErzieherIn an einer Be-hinderung ist. Wobei auch andere gesellschaftliche Strukturen an der Produktion von Behin-derung beteiligt sind. Zudem soll die Forderung der Inklusion nach ‚Dekategorisierung‘ kritisch hinterfragt werden.
Bildung bedeutet sich ein Bild von Etwas und Jemanden zu machen. Der allgemeine Bil-dungsbegriff der Erziehungswissenschaft scheint hier in der Sonderpädagogik zu scheitern. Mit der Orientierung ans einer Stilisierung der Vernünftigkeit und Höherbildung im Sinne von Ich-denke und dem Kanonisierung des Wissens, wird eine Norm gesetzt mit einer inhärenten Erwartung, der Menschen mit geistiger Behinderung nicht gerecht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verständnisse von Behinderung
- 2.1 Die individualtheoretische (medizinische) Sichtweise
- 2.2 Behinderung als soziale Zuschreibung
- 2.3 Behinderung als mehrdimensionales und relationales Konstrukt – ICIDH und ICF
- 2.3.1 ICIDH - International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
- 2.3.2 ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health
- 2.4 Inklusion und Dekategorisierung
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Verständnisse von Behinderung im professionsbezogenen Diskurs der Behindertenpädagogik. Ziel ist es, eine reflektierte Haltung zu diesem Thema zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem individualtheoretischen und dem sozialen Modell von Behinderung, sowie der Integration beider Modelle in der ICIDH und ICF. Die Rolle von Erzieher*innen im Kontext von Behinderung und die kritische Hinterfragung der Forderung nach „Dekategorisierung“ im Rahmen der Inklusion werden ebenfalls behandelt.
- Verständnisse von Behinderung im individualtheoretischen und sozialen Modell
- Analyse der ICIDH und ICF als integrative Modelle
- Der Beitrag von Erzieher*innen zur Entstehung und Bewältigung von Behinderung
- Kritische Betrachtung der Inklusion und der Dekategorisierung
- Menschenrechte und Inklusion im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den rechtlichen Rahmen inklusiver Bildung in Bayern und verweist auf den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zu Bildung und der hohen Rate an Exklusion behinderter Kinder in Sonderschulen. Sie thematisiert die ethischen und menschenrechtlichen Aspekte von Inklusion im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention und stellt die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Recht auf individuelle Förderung und dem Recht auf gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Der allgemeine Bildungsbegriff der Erziehungswissenschaft wird im Kontext der Sonderpädagogik hinterfragt, und das pädagogische Handeln wird als soziales Handeln definiert, das das Lernen des Zöglings zum obersten Ziel hat. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Verständnissen von Behinderung an, um eine reflektierte pädagogische Haltung zu entwickeln.
2. Verständnisse von Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Definition des Begriffs „Behinderung“ und der damit verbundenen Herausforderungen. Es werden die individualtheoretische (medizinische) und die soziale Sichtweise auf Behinderung dargestellt. Die individualtheoretische Perspektive betrachtet Behinderung als medizinische Normabweichung und fokussiert auf Heilungsversuche und Therapien. Das Kapitel beleuchtet das negative und defizitäre Bild von Menschen mit Behinderung, das durch dieses Modell verstärkt wird. Die individualtheoretische Sichtweise wird anhand eines von Zirfas entwickelten Modells analysiert, welches die logischen Argumente dieser Perspektive in fünf Schritten aufzeigt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verständnisse von Behinderung im professionsbezogenen Diskurs der Behindertenpädagogik
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert verschiedene Verständnisse von Behinderung im Kontext der Behindertenpädagogik. Sie untersucht kritisch das individualtheoretische und soziale Modell von Behinderung und integriert diese in der Betrachtung der ICIDH und ICF. Zusätzlich werden die Rolle von Erzieher*innen und die kritische Auseinandersetzung mit der Dekategorisierung im Rahmen der Inklusion beleuchtet.
Welche Modelle von Behinderung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das individualtheoretische (medizinische) Modell, welches Behinderung als medizinische Normabweichung versteht, und das soziale Modell, das Behinderung als soziales Konstrukt betrachtet. Die ICIDH und ICF werden als integrative Modelle analysiert, die Aspekte beider Modelle berücksichtigen.
Was sind ICIDH und ICF?
ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) und ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) sind Klassifikationssysteme, die versuchen, Behinderung mehrdimensional und relational zu erfassen. Die Arbeit analysiert beide Systeme im Detail und vergleicht ihre Ansätze.
Welche Rolle spielen Erzieher*innen?
Die Arbeit untersucht den Beitrag von Erzieher*innen zur Entstehung und Bewältigung von Behinderung und hinterfragt deren Rolle kritisch im Kontext der verschiedenen Behinderungsmodelle.
Wie wird Inklusion und Dekategorisierung behandelt?
Die Arbeit befasst sich kritisch mit dem Thema Inklusion und der Forderung nach Dekategorisierung. Sie hinterfragt die Auswirkungen dieser Forderungen und setzt sie in Bezug zu den Menschenrechten und der inklusiven Bildung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu verschiedenen Verständnissen von Behinderung (inklusive individualtheoretischer und sozialer Sichtweisen, ICIDH und ICF), und einen Schluss. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine reflektierte Haltung zum Thema Behinderung zu entwickeln und die verschiedenen Verständnisse kritisch zu hinterfragen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der komplexen Interaktion zwischen individuellen Fähigkeiten und gesellschaftlichen Bedingungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. verschiedene Verständnisse von Behinderung, die Analyse der ICIDH und ICF, den Beitrag von Erzieher*innen, die kritische Betrachtung von Inklusion und Dekategorisierung und den Bezug zu Menschenrechten im Bildungssystem.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Lisa Maria Neulist (Autor), 2016, Diskurse um Verständnisweisen von Behinderung mit dem Fokus auf Inklusion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323529