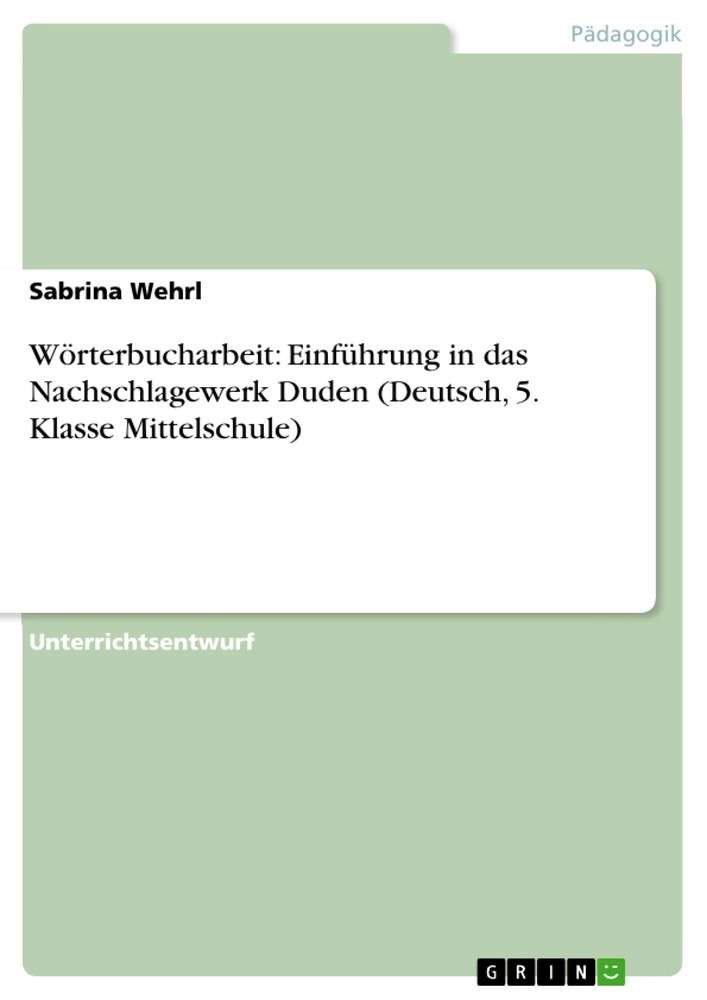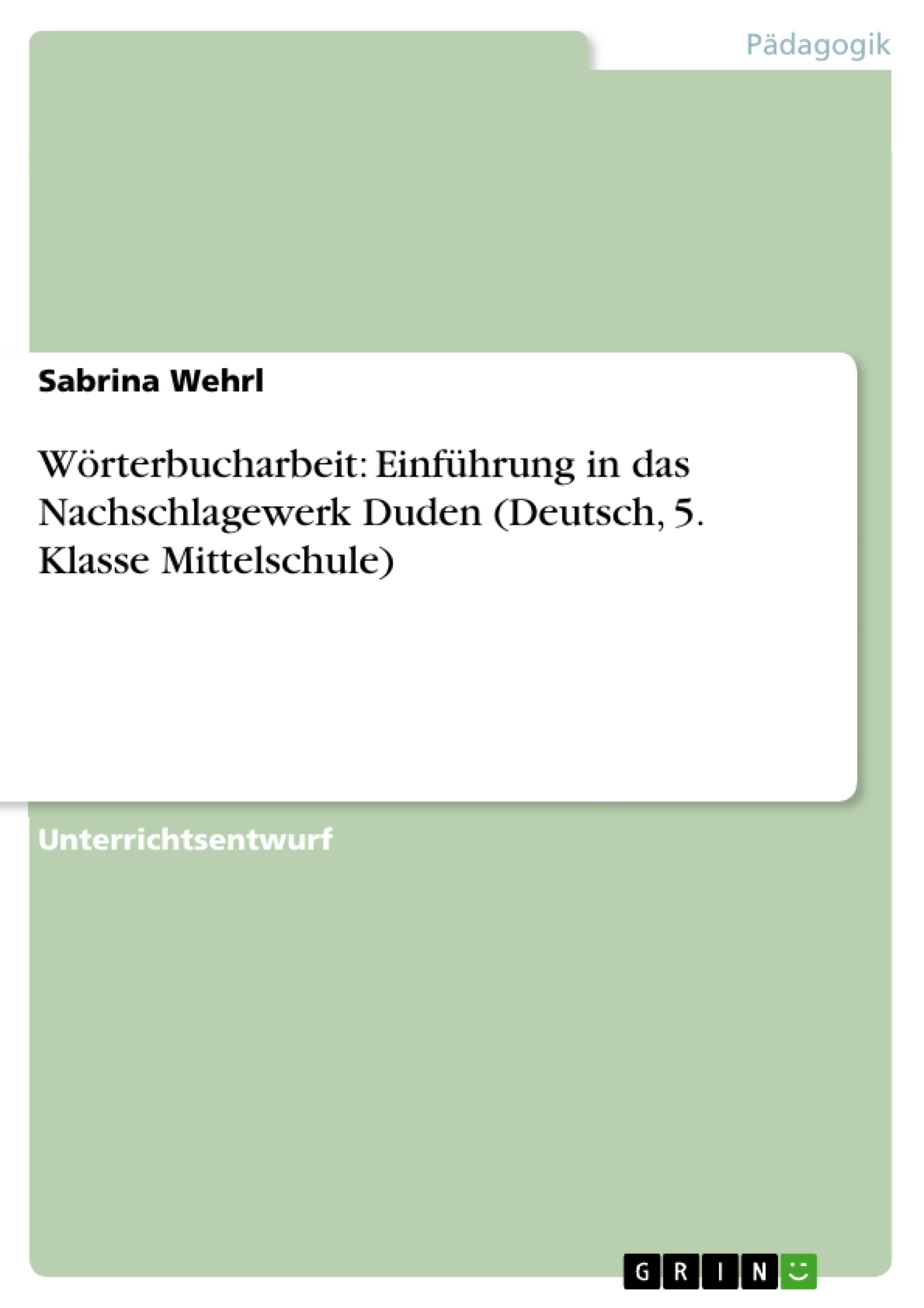Die Unterrichtsstunde "Einführung in das Nachschlagewerk Duden" im Deutschunterricht wurde in einer fünften Klasse der Mittelschule Bayern erprobt und kann sicher auch in anderen Schularten sowie Jahrgangsstufen etwas abgewandelt durchgeführt werden. Es sind einige Arbeitsblätter und Hilfestationen enthalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Wissenschaftlich-sachliche Grundlage
- 2. Lehr- und Lernziele
- 2.1 Was soll mit der Unterrichtsstunde erreicht werden?
- 2.2 Was möchte ich als Lehrer erreichen?
- 2.3 Welche Bedeutung hat der Inhalt der Stunde für die Schüler?
- 2.4 Wo sehe ich Schwierigkeiten?
- 3. Lernstand
- 3.1 Welchen Lernstand stelle ich in der Klasse insgesamt fest?
- 3.2 Auf welchem Lernstand befinden sich die Schüler konkret?
- 3.3 Welche differenzierenden Maßnahmen ergreife ich aufgrund des beschriebenen Lernstandes?
- 4. Lernarrangement
- 4.1 Warum eignet sich die gewählte Methode für die Umsetzung der Lerninhalte?
- 4.2 wodurch zeigt sich der Lernzuwachs der Schüler?
- 5. Fach- bzw. Sequenzplanung
- 6. Unterrichtsverlauf
- 7. Material
- 8. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde zum Thema "Nachschlagen im Wörterbuch". Ziel ist es, die Schüler*innen im Umgang mit dem Duden als Nachschlagewerk zu schulen und ihre Fähigkeiten im alphabetischen Ordnen und der Nutzung von Leitwörtern zu verbessern. Die Stunde soll dazu beitragen, die Rechtschreibleistung der Schüler*innen zu fördern und sie zu selbstständigem Arbeiten zu befähigen.
- Einführung in die Nutzung des Dudens als Nachschlagewerk
- Vermittlung des alphabetischen Ordnungsprinzips
- Anwendung von Leitwörtern zur effizienten Suche
- Förderung des selbstständigen Arbeitens
- Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstände und Bedürfnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Wissenschaftlich-sachliche Grundlage: Der Text begründet die Wichtigkeit des Nachschlagens im Wörterbuch als grundlegende Arbeitstechnik, insbesondere im Kontext des bayerischen Lehrplans für Mittelschulen. Er betont die Bedeutung der Fähigkeit, sowohl gedruckte als auch digitale Nachschlagewerke effektiv zu nutzen, und erläutert die spezifischen Techniken, die Schüler*innen erlernen sollen, wie z. B. alphabetisieren, die Orientierung an Leitwörtern und das Verständnis von Abkürzungen. Der Duden wird als Beispiel eines weit verbreiteten und geeigneten Wörterbuchs vorgestellt, wobei dessen Aufbau und Struktur detailliert beschrieben werden. Die Bedeutung der korrekten Rechtschreibung in der heutigen Gesellschaft und die Herausforderungen durch Rechtschreibschwächen werden angesprochen.
2. Lehr- und Lernziele: Dieses Kapitel spezifiziert die Lernziele der Unterrichtsstunde. Es unterscheidet zwischen den Zielen für die Schüler*innen (Umgang mit dem Duden, Anwendung des alphabetischen Prinzips, Verständnis von Leitwörtern) und den Zielen der Lehrkraft (Schüler*innen dort abholen wo sie stehen, Schaffung einer angenehmen Lernumgebung, Förderung der Selbstständigkeit). Der Bezug zur Bedeutung des Themas für die Schüler*innen (wichtige Fähigkeit, selbstständiges Arbeiten, Übertragbarkeit auf andere Nachschlagewerke) wird hergestellt. Schließlich werden potentielle Schwierigkeiten, wie unterschiedliche Leistungsstände und Motivation der Schüler*innen, sowie die Anwesenheit von Schüler*innen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) angesprochen.
3. Lernstand: Dieser Abschnitt beschreibt den Ist-Zustand der Klasse hinsichtlich des Themas Nachschlagen und der Rechtschreibung. Die unterschiedlichen Lernstände der Schüler*innen werden differenziert dargestellt, wobei sowohl hoch motivierte als auch leistungsschwache Schüler*innen, inklusive Schüler*innen mit LRS, berücksichtigt werden. Die Schwierigkeiten beim alphabetischen Ordnen von Wörtern und die Notwendigkeit differenzierender Maßnahmen werden hervorgehoben. Der Abschnitt legt den Grundstein für die Planung individueller Lernunterstützung.
4. Lernarrangement: Hier wird die gewählte Methode zur Umsetzung der Lerninhalte begründet und der zu erwartende Lernzuwachs der Schüler*innen beschrieben. Die Auswahl der Methode und der Materialien wird didaktisch gerechtfertigt. Dieser Abschnitt fokussiert darauf, wie der Lernerfolg der Schüler*innen messbar wird und welche Strategien zur individuellen Förderung eingesetzt werden sollen.
5. Fach- bzw. Sequenzplanung: Dieser Abschnitt beschreibt die konkrete Planung des Unterrichtsverlaufs innerhalb der Gesamtsequenz. Die einzelnen Phasen und Aktivitäten werden im Detail dargestellt und ihre didaktische Begründung wird gegeben. Es wird auf die Vernetzung mit vorherigen und nachfolgenden Unterrichtseinheiten eingegangen.
Schlüsselwörter
Wörterbuch, Duden, Nachschlagetechnik, Alphabetisierung, Leitwörter, Rechtschreibung, Lehr- und Lernziele, Lernstand, Differenzierung, LRS, Selbstständigkeit, Methodenkompetenz.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsplanung "Nachschlagen im Wörterbuch"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Unterrichtsplanung für eine Stunde zum Thema "Nachschlagen im Wörterbuch". Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (wissenschaftlich-sachliche Grundlage, Lehr- und Lernziele, Lernstand, Lernarrangement, Fach- bzw. Sequenzplanung), sowie Schlüsselwörter.
Welche Ziele werden in der Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Schüler sollen den Umgang mit dem Duden als Nachschlagewerk erlernen, alphabetisch ordnen, Leitwörter nutzen, ihre Rechtschreibleistung verbessern und selbstständig arbeiten. Die Lehrkraft möchte die Schüler dort abholen, wo sie stehen, eine angenehme Lernatmosphäre schaffen und die Selbstständigkeit fördern.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Einführung in die Nutzung des Dudens, das alphabetische Ordnungsprinzip, die Anwendung von Leitwörtern, die Förderung des selbstständigen Arbeitens und die Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstände.
Wie wird der Lernstand der Schüler berücksichtigt?
Der Text beschreibt die Erfassung des Ist-Zustandes der Klasse bezüglich Nachschlagetechniken und Rechtschreibung. Unterschiedliche Lernstände, inklusive Schüler mit LRS, werden berücksichtigt, und es werden differenzierende Maßnahmen zur individuellen Förderung geplant.
Welche Methode wird in der Unterrichtsstunde angewendet und warum?
Das Dokument beschreibt die gewählte Methode zur Umsetzung der Lerninhalte und begründet deren didaktische Eignung. Es wird erläutert, wie der Lernerfolg messbar gemacht wird und welche Strategien zur individuellen Förderung eingesetzt werden.
Wie ist der Unterrichtsverlauf geplant?
Der Abschnitt "Fach- bzw. Sequenzplanung" detailliert den geplanten Unterrichtsverlauf, inklusive der einzelnen Phasen und Aktivitäten, sowie deren didaktische Begründung und Vernetzung mit vorherigen und nachfolgenden Unterrichtseinheiten.
Welche Materialien werden verwendet?
Das Dokument listet die benötigten Materialien im Kapitel "Material" auf (diese sind im vorliegenden Auszug nicht enthalten).
Welche wissenschaftliche Grundlage liegt der Planung zugrunde?
Die Planung basiert auf der Bedeutung des Nachschlagens im Wörterbuch als grundlegende Arbeitstechnik, insbesondere im Kontext des bayerischen Lehrplans für Mittelschulen. Sie berücksichtigt die Nutzung von gedruckten und digitalen Nachschlagewerken und die Herausforderungen durch Rechtschreibschwächen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wörterbuch, Duden, Nachschlagetechnik, Alphabetisierung, Leitwörter, Rechtschreibung, Lehr- und Lernziele, Lernstand, Differenzierung, LRS, Selbstständigkeit, Methodenkompetenz.
- Quote paper
- Sabrina Wehrl (Author), 2016, Wörterbucharbeit: Einführung in das Nachschlagewerk Duden (Deutsch, 5. Klasse Mittelschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323273