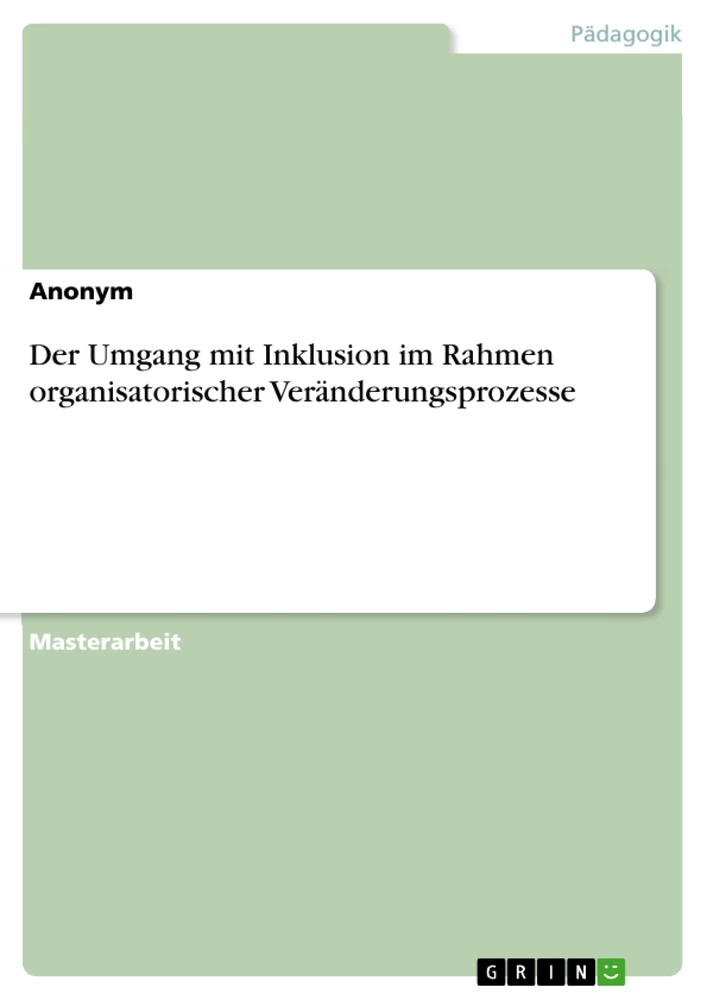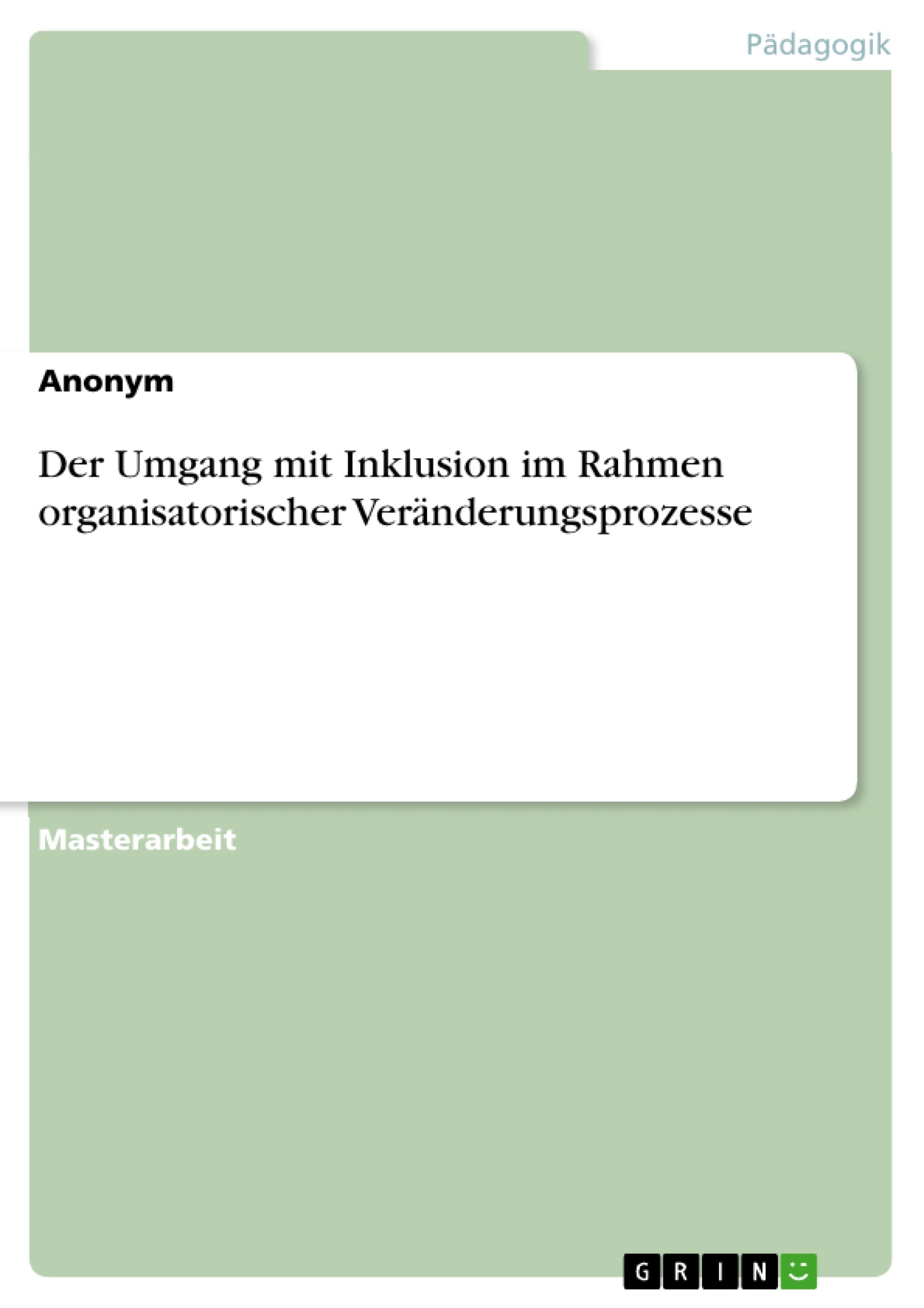In den letzten vier Jahrzehnten hat im Hinblick auf die Betreuung behinderter Kinder in den Kindertageseinrichtungen ein Paradigmenwechsel stattgefunden. So wurden diese Kinder eine lange Zeit ausschließlich in einer geschützten Umgebung betreut sowie gefördert und somit aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Dieses Schutzprinzip sollte aufgebrochen werden und somit geriet in den 70er Jahren in Deutschland ein Umdenken ins Rollen.
Kinder mit einer (drohenden) Behinderung sollten in öffentliche Institutionen eingegliedert und gemeinsam betreut und gefördert werden. Dies war der Beginn der Entstehung eines integrativen Bildungssystems, was insbesondere durch die Ratifizierung der UN Konvention unter dem Begriff der Inklusion eingeleitet und somit als Regelangebot auch in den Kindertagesstätten fest verankert wurde.
Die Arbeit zielt darauf ab, eine Erfassung der subjektiven Sichtweisen der Leiterinnen, die in der Praxis der Kindertagesbetreuung tätig sind, im Kontext der Inklusion darzustellen. Das primäre Interesse besteht nicht darin, herauszufinden, ob sich eine Einrichtung dahingehend verändert hat, sondern warum eine Veränderung erfolgte, welche Veränderungen genau nötig waren und wie mit der gemeinsamen Erziehung und Bildung aktuell umgegangen wird. Insbesondere soll hinterfragt werden, ob die Inklusion innerhalb des vorschulischen Bereichs wirklich so gut ausgebaut ist. Außerdem sollen im Zuge dessen die Grenzen der Veränderung aufgezeigt werden und die Herausforderungen innerhalb des Veränderungsprozesses thematisiert werden. Dies erfolgt durchgehend auch im Hinblick zum Vergleich der Einrichtungsarten. Dabei soll der Fokus auf die organisatorischen Veränderungsprozesse gerichtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Veränderungsprozesse von Organisationen
- Gründe für Veränderungen
- Veränderungsprozess und Erfolgsfaktoren
- Barrieren für Veränderungen
- Umgang mit Inklusion im frühpädagogischen Bereich
- Subjektive Ebene
- Interaktionale Ebene
- Institutionelle Ebene
- Gesellschaftliche Ebene
- Organisationsentwicklung durch Inklusion
- Aktueller Forschungsstand
- Veränderung von Organisationen
- Inklusion in der Frühpädagogik
- Forschungsdefizit
- Darstellung des Forschungsdesigns
- Vorstellung der Forschungsmethode
- Zielsetzung
- Datenerhebung
- Datenaufbereitung
- Datenanalyse
- Methodenkritik
- Darstellung der Ergebnisse
- Pädagogisches Leitbild
- Kernprofessionalität der Arbeit
- Externe Kooperationspartner
- Organisationsentwicklungsprozess
- Diskussion der Ergebnisse
- Pädagogisches Leitbild
- Kernprofessionalität
- Externe Kooperationspartner
- Organisationsentwicklungsprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Implementierung von Inklusion in Kindertagesstätten. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in den Regelbetrieb ergeben.
- Veränderungen im frühpädagogischen Bereich durch Inklusion
- Entwicklung eines inklusiven pädagogischen Leitbildes
- Kernprofessionalität der Erzieherinnen und Erzieher im Kontext von Inklusion
- Bedeutung von externen Kooperationspartnern für die Inklusion
- Organisationsentwicklungsprozess im Wandel zur Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Inklusion in der Kindertagesbetreuung dar und beleuchtet den aktuellen Kontext von Herausforderungen und Veränderungen im sozialen Bereich. Sie führt in die Thematik der Inklusion ein und skizziert die Bedeutung der Inklusion für die Entwicklung von Kindern.
Das Kapitel „Theoretischer Hintergrund" beleuchtet die Veränderungsprozesse von Organisationen, die Rolle von Inklusion im frühpädagogischen Bereich und die Bedeutung von Inklusion für die Organisationsentwicklung. Hier werden die verschiedenen Ebenen von Inklusion – subjektiv, interaktiv, institutionell und gesellschaftlich – näher betrachtet.
Im Kapitel „Aktueller Forschungsstand" wird der Stand der Forschung zur Veränderung von Organisationen, zur Inklusion in der Frühpädagogik und zu den Forschungsdefiziten im Bereich der Inklusion beleuchtet.
Das Kapitel „Darstellung des Forschungsdesigns" beschreibt die Forschungsmethode, die Zielsetzung der Arbeit, die Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenanalyse und die Methodenkritik.
Das Kapitel „Darstellung der Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die sich auf das pädagogische Leitbild, die Kernprofessionalität der Arbeit, die externen Kooperationspartner und den Organisationsentwicklungsprozess konzentrieren.
Das Kapitel „Diskussion der Ergebnisse" analysiert und interpretiert die Ergebnisse im Kontext der theoretischen Grundlagen und des aktuellen Forschungsstandes.
Schlüsselwörter
Inklusion, Kindertagesstätten, Frühpädagogik, pädagogisches Leitbild, Kernprofessionalität, externe Kooperationspartner, Organisationsentwicklung, Integration, Veränderungsprozesse, Forschungsdefizit, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Inklusion in Kindertagesstätten?
Ziel ist die gemeinsame Erziehung und Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung in öffentlichen Institutionen als Regelangebot.
Welche Rolle spielen die Leiterinnen beim Inklusionsprozess?
Die Arbeit untersucht die subjektiven Sichtweisen der Leiterinnen auf die nötigen Veränderungen und Herausforderungen in der Praxis.
Welche Barrieren gibt es bei der Umsetzung von Inklusion?
Die Arbeit thematisiert organisatorische Grenzen, mangelnde Ressourcen und Herausforderungen innerhalb des Veränderungsprozesses.
Was wird unter dem „Paradigmenwechsel“ in der Betreuung verstanden?
Der Wandel von der Ausgrenzung in geschützten Umgebungen hin zur Eingliederung in das allgemeine Bildungssystem.
Welche Ebenen der Inklusion werden in der Arbeit betrachtet?
Es werden die subjektive, interaktionale, institutionelle und gesellschaftliche Ebene analysiert.
Welche Bedeutung haben externe Kooperationspartner?
Für eine erfolgreiche Inklusion ist die Zusammenarbeit mit externen Therapeuten, Ämtern und Fachdiensten essenziell.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Der Umgang mit Inklusion im Rahmen organisatorischer Veränderungsprozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323079