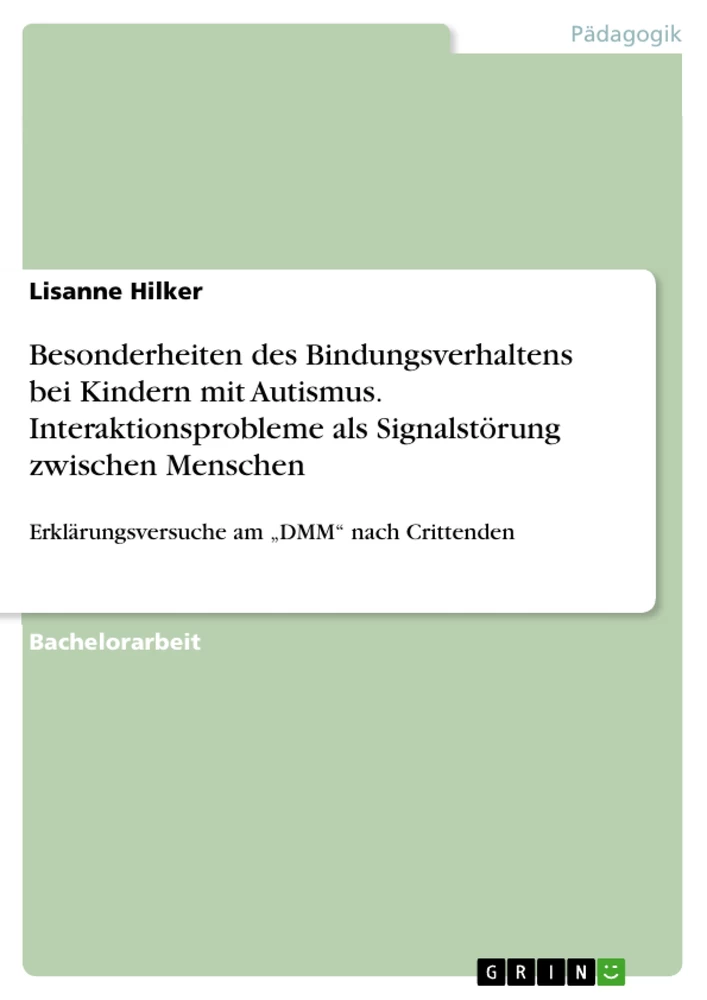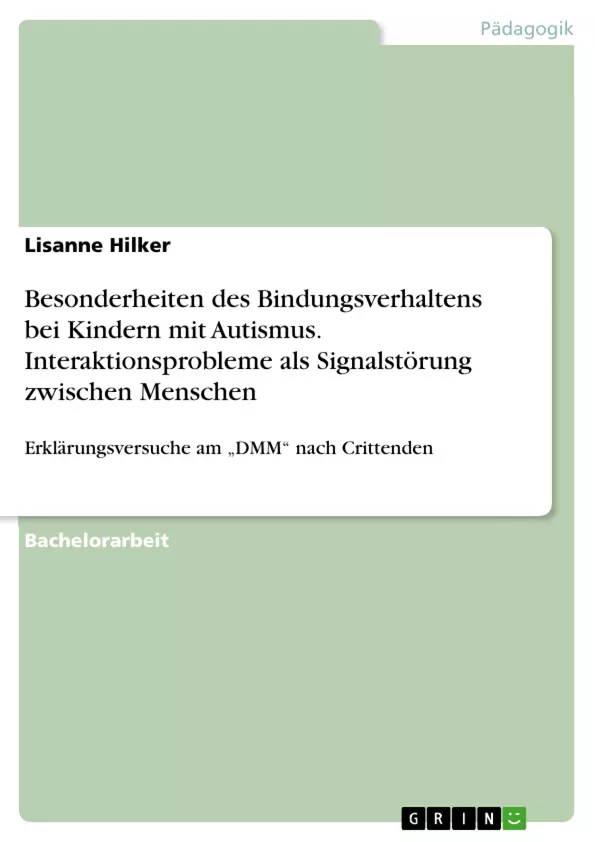Das Phänomen Autismus scheint die Gesellschaft zwar mit steigendem Bekanntheitsgrad zu faszinieren, doch häufig wird dessen Bedeutung leider völlig falsch verstanden. Reaktionen zum Thema verlaufen oft einsilbig: „Ach ja, 'Rain Man' habe ich gesehen.“ Nein, nicht jeder Mensch mit Autismus ist ein „Rain Man“. Doch der US- amerikanische Film, in welchem der hochbegabte Autist Raymond mit seinem Bruder Charlie eine lange Reise quer durch die USA antritt, sorgte mithilfe der Medien sicherlich dafür, dass die Autismusstörung mehr Menschen erreichte, jedoch auch für ein verzerrtes Krankheitsbild.
Mit den Symptomen gehen interessante Vorstellungen einher: Menschen mit autistischer Behinderung leben in ihrer „eigenen Welt“, sie haben keine Gefühle oder soziales Interesse und Genies sind sie auch. Diese Arbeit befasst sich unter anderem damit, mit diesen falschen „Fakten“ aufzuräumen.
Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit lässt sich in drei Teile gliedern: erst wird das Thema Autismus behandelt, dann das der Bindung und final das Bindungsverhalten bei Menschen mit Autismus. Diese Bachelorarbeit dient nicht nur dazu, über Autismus aufzuklären, also die Entwicklung der Autismusforschung und die Symptomatik zu beschreiben, sondern auch der Widmung eines besonderen Aspekts: der Vermutung, Menschen mit autistischer Behinderung hätten kein soziales Interesse und würden keine Emotionen entwickeln.
Um diesen Aspekt näher zu durchleuchten, wird vor allem die Zeit der frühen Kindheit thematisiert, das Alter indem der Mensch erste Bindungen eingeht.
Es wird versucht werden, der Ursache und dem Zweck von Bindung, der Bindungstheorie, den Phasen und Formen, welche Bindung durchlebt und annimmt, auf den Grund zu gehen, wie auch welche Faktoren ein stabiles Bindungsverhalten befördern.
Doch die Fragestellungen, mit denen sich diese Bachelorarbeit letztendlich befasst, lauten: Können prinzipiell alle Menschen Bindungen eingehen? Wenn ja, wie zeigen sich diese bei behinderten Kindern, speziell bei Kindern mit autistischer Behinderung? Gibt es Besonderheiten und wenn ja, worauf sind diese zurückzuführen? Eine besondere Rolle bei der Beantwortung dieser Fragen wird das „Dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung“ nach Dr. Patricia Crittenden einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Autismus
- 2.1. Die Pioniere der Autismusforschung
- 2.1.1. Hans Asperger
- 2.1.2. Leo Kanner
- 2.2. Autismus heute - die Symptomatik
- 2.3. Wahrnehmungsbesonderheiten
- 2.3.1. Das Sehen
- 2.3.2. Hören
- 3. Erste Bindung
- 3.1. Die Bindungstheorie nach John Bowlby
- 3.2. Die „Fremde Situation“ nach Ainsworth und Wittig
- 3.2.1. Die 4 Bindungstypen
- 3.2.2. Ursache und Zweck für die Entwicklung eines Bindungssystems
- 3.2.3. Bindungsverhalten bei behinderten Kindern
- 3.2.4. Mutter-Kind-Bindung in der Interaktion mit einem behinderten Kind
- 3.3. Erste Schlussfolgerungen
- 4. Autisten und Bindung - erklärt am „DMM“ nach Crittenden
- 4.1. Definition des DMM
- 4.2. Autistische Kinder und "Signalstörungen" negativer Basiseffekte
- 4.3. Resultierende Wechselwirkung bei Mutter und Kind
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Besonderheiten des Bindungsverhaltens bei Kindern mit Autismus. Ziel ist es, gängige Missverständnisse über Autismus zu korrigieren und die Frage zu beantworten, ob und wie sich Bindung bei Kindern mit autistischer Behinderung zeigt. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Autismusforschung, die Symptomatik von Autismus und die Bindungstheorie. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erforschung möglicher „Signalstörungen“ im Kontext der Interaktion zwischen betroffenen Kindern und ihren Bezugspersonen.
- Auflösung von Missverständnissen über Autismus und dessen Symptomatik
- Analyse der Bindungstheorie und deren Relevanz für Kinder mit Autismus
- Untersuchung des Bindungsverhaltens bei Kindern mit Autismus
- Anwendung des Dynamischen Reifungsmodells der Bindung und Anpassung (DMM) zur Erklärung von Interaktionsproblemen
- Erforschung der Rolle von „Signalstörungen“ in der Mutter-Kind-Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Autismus ein und räumt mit gängigen Vorurteilen auf. Sie thematisiert die steigende Bekanntheit von Autismus, die oft mit vereinfachten und unzutreffenden Vorstellungen verbunden ist. Die Arbeit wird in drei Teile gegliedert: Autismus, Bindung und Bindungsverhalten bei Autismus. Die zentrale Forschungsfrage lautet, ob und wie sich Bindung bei Kindern mit autistischer Behinderung zeigt und welche Besonderheiten dabei auftreten.
2. Autismus: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Autismusforschung, beginnend mit den Pionieren Hans Asperger und Leo Kanner. Es beschreibt die Symptomatik von Autismus heute und beleuchtet Besonderheiten der Wahrnehmung bei betroffenen Personen. Der Text zeigt die Entwicklung des Begriffs "Autismus" auf und widerlegt Mythen über autistische Menschen als "Genies" oder Wesen ohne soziale Fähigkeiten. Es wird der historische Kontext dargestellt, von mittelalterlichen Vorstellungen über "heilige Narren" bis hin zu frühen medizinischen Beobachtungen wie der von Victor von Aveyron.
3. Erste Bindung: Dieses Kapitel beschreibt die Bindungstheorie nach John Bowlby und die „Fremde Situation“ nach Ainsworth und Wittig, inklusive der vier Bindungstypen. Es beleuchtet die Ursachen und den Zweck der Entwicklung eines Bindungssystems und diskutiert das Bindungsverhalten bei behinderten Kindern im Allgemeinen. Ein wichtiger Aspekt ist die Mutter-Kind-Bindung in der Interaktion mit einem behinderten Kind, inklusive der Aspekte Resilienz und Vulnerabilität.
4. Autisten und Bindung - erklärt am „DMM“ nach Crittenden: Dieses Kapitel erklärt das Dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung (DMM) nach Crittenden und wendet es auf die Interaktionsprobleme bei Kindern mit Autismus an. Es analysiert "Signalstörungen" als Ursache für Schwierigkeiten in der Bindungsbildung und beschreibt die resultierende Wechselwirkung zwischen Mutter und Kind im Kontext autistischer Besonderheiten. Der Fokus liegt auf der Interpretation von Verhaltensweisen als Ausdruck einer Beeinträchtigung der Signalverarbeitung und deren Auswirkungen auf die Bindungsdynamik.
Schlüsselwörter
Autismus, Bindungstheorie, Bindungsverhalten, Interaktionsprobleme, Signalstörungen, Dynamisches Reifungsmodell (DMM), Patricia Crittenden, John Bowlby, Mary Ainsworth, Wahrnehmungsbesonderheiten, frühkindliche Entwicklung, Resilienz, Vulnerabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Autismus und Bindung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht das Bindungsverhalten bei Kindern mit Autismus. Sie zielt darauf ab, Missverständnisse über Autismus zu korrigieren und zu klären, ob und wie sich Bindung bei autistischen Kindern zeigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Autismusforschung, die Symptomatik von Autismus, die Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth, sowie das Dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung (DMM) nach Crittenden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse möglicher „Signalstörungen“ in der Interaktion zwischen autistischen Kindern und ihren Bezugspersonen.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Zeigt sich Bindung bei Kindern mit autistischer Behinderung, und wenn ja, welche Besonderheiten treten dabei auf?
Welche Autoren und Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Pionierarbeiten von Hans Asperger und Leo Kanner zur Autismusforschung, die Bindungstheorie von John Bowlby, die „Fremde Situation“ von Ainsworth und Wittig, und das Dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung (DMM) von Patricia Crittenden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Autismus (inklusive historischer Entwicklung und Symptomatik), Erste Bindung (Bindungstheorie und -typen), Autismus und Bindung erklärt am DMM, und Fazit. Jedes Kapitel fasst die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Themas zusammen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (in Kurzfassung)?
Die Arbeit analysiert die Besonderheiten der Bindungsbildung bei autistischen Kindern im Kontext von Wahrnehmungsbesonderheiten und möglichen „Signalstörungen“, die die Interaktion mit Bezugspersonen beeinflussen. Sie beleuchtet die Relevanz des DMM zur Erklärung dieser Interaktionsprobleme.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Autismus, Bindungstheorie, Bindungsverhalten, Interaktionsprobleme, Signalstörungen, Dynamisches Reifungsmodell (DMM), Patricia Crittenden, John Bowlby, Mary Ainsworth, Wahrnehmungsbesonderheiten, frühkindliche Entwicklung, Resilienz, Vulnerabilität.
Welche Kapitelüberschriften sind enthalten?
Die Arbeit enthält die folgenden Kapitelüberschriften: 1. Einleitung, 2. Autismus (mit Unterkapiteln zu den Pionieren der Autismusforschung und der Symptomatik), 3. Erste Bindung (mit Unterkapiteln zur Bindungstheorie und der „Fremden Situation“), 4. Autisten und Bindung - erklärt am „DMM“ nach Crittenden, 5. Fazit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachleute im Bereich der Autismusforschung, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung. Sie bietet zudem wertvolle Informationen für Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit Autismus.
- Citation du texte
- Lisanne Hilker (Auteur), 2014, Besonderheiten des Bindungsverhaltens bei Kindern mit Autismus. Interaktionsprobleme als Signalstörung zwischen Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321574