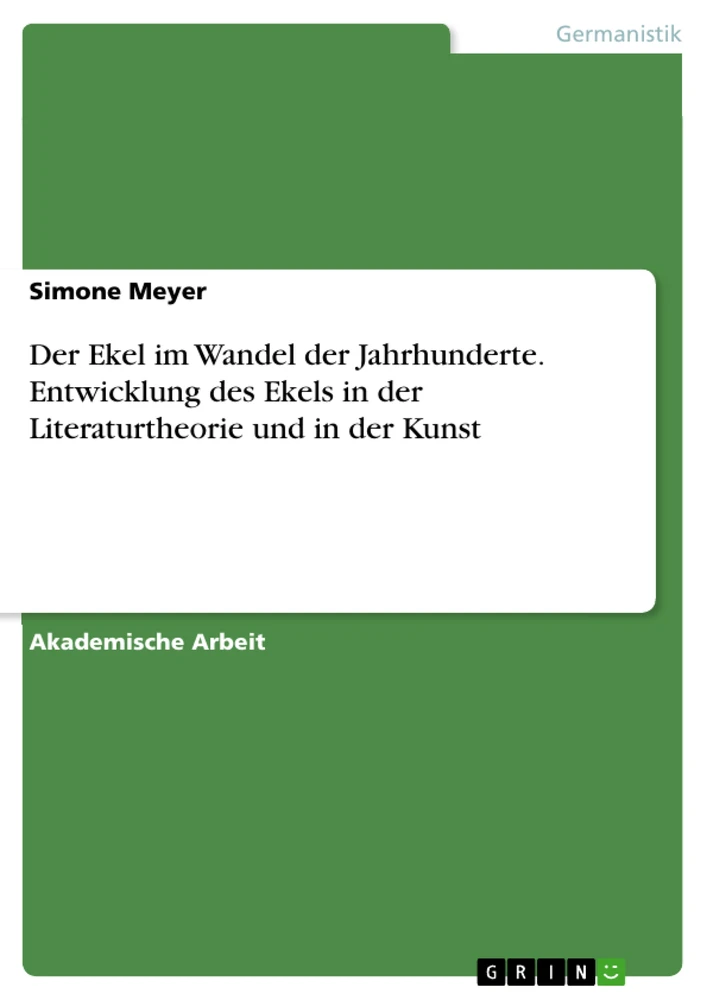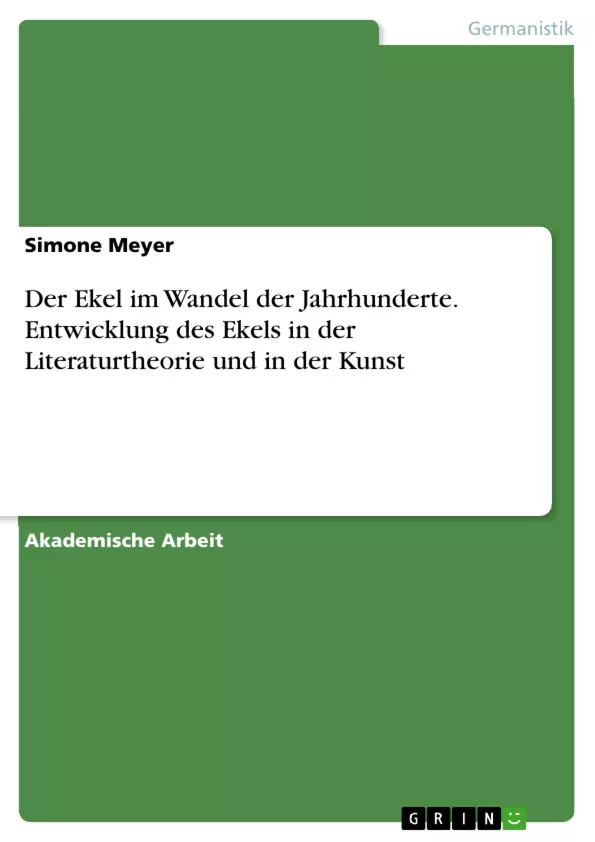Beginnend mit der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts, stellt der Autor in dieser Arbeit die Entwicklung des Ekels in der Literaturtheorie und in der Kunst an ausgewählten Beispielen dar. Die Epochen und Strömungen der Aufklärung, Klassik, der Romantik, des Naturalismus und der Dekadenz bis zum Expressionismus werden dabei behandelt. In den herausgegriffenen Zeitabschnitten ist das Thema Ekel entweder durch eine theoretische Diskussion präsent oder es ist eine Hinwendung zum Ekelhaften in der Literatur offensichtlich, die auffallend für die jeweilige Zeit war.
Absicht der Arbeit ist es, eine Antwort auf die Frage zu finden, inwieweit sich die Einstellung der Theoretiker und Künstler gegenüber dem Phänomen Ekel ändert und sich daraufhin in ihren philosophischen und literarischen Werken niederschlägt.
Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, wie sich der Ekel vorrangig in der deutschen, aber auch europäischen Literatur, ausgehend von der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts bis zur Moderne, entwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ekel in der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts
- 2. Die Anti-Ekelideale der Antike und ihre Einflüsse auf die Klassik
- 2.1 griechische Statuen als Vorbild der idealen Schönheit
- 3. Schöner Ekel in der Romantik
- 4. Rosenkranz’ „Ästhetik des Häßlichen“
- 5. Naturalismus – die Verbindung von Kunst und Wissenschaft
- 5.1. Zola: Experiment Literatur
- 5.2 Bestie Mensch
- 6. Nietzsche - zum Übermenschen durch die Überwindung des Ekels
- 7. Fin de Siècle und Dekadenz - Ekel als neuer Reiz
- 7.1. Stimmungen und Emotionen der Dekadenz
- 7.2. Literarische Dekadenz - dekadente Literatur
- 7.3. Baudelaire – kränkliche Blumen
- 8. Expressionismus
- 8.1 Dissoziation des Ichs in einer neuen Welt
- 8.2 Die Hässlichkeit des Expressionismus
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Ekels in der Literatur und Kunst, insbesondere in der deutschen und europäischen Literatur. Sie verfolgt die Evolution des Ekels von der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts bis in die Moderne, wobei sie sich auf ausgewählte Epochen und Strömungen wie Aufklärung, Klassik, Romantik, Naturalismus, Dekadenz und Expressionismus konzentriert.
- Die ästhetische Theorie des 18. Jahrhunderts und ihre Definition des Ekels
- Die Rolle des Ekels in der klassischen Literatur und Kunst
- Die romantische Ästhetik und die Akzeptanz des Ekels als Bestandteil der Kunst
- Der Ekel im Naturalismus und seine Verwendung als Mittel der Sozialkritik
- Nietzsches Konzept der Überwindung des Ekels und seine Auswirkungen auf die Dekadenz und den Expressionismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema des Ekels als menschliche Emotion und ästhetisches Phänomen ein. Sie beleuchtet die historische Relevanz des Ekels in Literatur und Kunst und verdeutlicht die Ambivalenz des Gefühls.
- Das erste Kapitel analysiert den Ekel im Kontext der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts. Es betrachtet die Debatte über die Grenzen des Ästhetischen und die Rolle des Ekels als negativer Gegenpol zum Schönen.
- Das zweite Kapitel widmet sich den Anti-Ekelidealen der Antike und ihren Einflüssen auf die klassische Epoche. Es untersucht die Idealisierung des menschlichen Körpers in der griechischen Kunst und die Vermeidung ekelerregender Aspekte.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die veränderte Rolle des Ekels in der Romantik. Es analysiert die Abkehr von den klassischen Schönheitsidealen und die Akzeptanz des Ekels als ästhetisches Mittel.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Rosenkranz’ „Ästhetik des Hässlichen“ und seiner Auseinandersetzung mit dem Ekelhaften. Es betrachtet die besondere Bedeutung von Verwesung und organischer Materie für die Wahrnehmung des Ekels.
- Das fünfte Kapitel untersucht den Naturalismus als literarische Strömung, die sich stark auf die wissenschaftliche Methode stützte und das Ekelhafte als Ausdruck der sozialen Realität thematisierte.
- Das sechste Kapitel widmet sich Nietzsches Philosophie und seiner Konzeption des Ekels als Symptom des Nihilismus. Es beleuchtet Nietzsches Vorstellung des „Menschen ohne Ekel“ und die Notwendigkeit, den Ekel zu überwinden.
- Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit dem Fin de Siècle und der Dekadenz. Es betrachtet die Gefühlslage der Dekadenz, die geprägt ist von Weltschmerz, Ennui und der Lust am Schmerz. Baudelaire’s „Fleur du mal“ wird als Beispiel für die Integration des Ekels in die Literatur der Dekadenz behandelt.
- Das achte Kapitel analysiert den Expressionismus und seine kulturkritische Auseinandersetzung mit der modernen Welt. Es untersucht die Bedeutung von Dissoziation, Nihilismus und Hässlichkeit in der expressionistischen Literatur.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Thema des Ekels, einem ambivalenten Gefühl, das in der Literatur und Kunst seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle spielt. Die Analyse der Ekelentwicklung in verschiedenen Epochen und Strömungen verweist auf zentrale Schlüsselbegriffe wie ästhetische Theorie, Schönheitsideal, Natur und Kunst, Sozialkritik, Verwesung, Nihilismus, Dekadenz, Dissoziation, Hässlichkeit und Kulturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Ekel in der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts gesehen?
In der Aufklärung galt der Ekel oft als negativer Gegenpol zum Schönen und markierte die Grenze dessen, was als ästhetisch darstellbar empfunden wurde.
Was änderte sich in der Romantik bezüglich des Ekelhaften?
Die Romantik entwickelte eine Ästhetik des „schönen Ekels“ und begann, das Hässliche und Schaurige als faszinierenden Bestandteil der Kunst zu akzeptieren.
Welche Bedeutung hat der Ekel im Naturalismus?
Im Naturalismus wurde das Ekelhafte ungeschönt dargestellt, um die soziale Realität und die „Bestie Mensch“ wissenschaftlich-literarisch zu analysieren.
Was versteht Nietzsche unter der Überwindung des Ekels?
Nietzsche sah den Ekel als Symptom des Nihilismus; der „Übermensch“ zeichnet sich dadurch aus, diesen Ekel vor dem Dasein zu überwinden.
Wie wird Ekel im Expressionismus eingesetzt?
Der Expressionismus nutzt die Hässlichkeit und das Ekelhafte, um die Dissoziation des Ichs und die Kulturkritik an der modernen Welt auszudrücken.
- Citar trabajo
- Simone Meyer (Autor), 2003, Der Ekel im Wandel der Jahrhunderte. Entwicklung des Ekels in der Literaturtheorie und in der Kunst, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321571