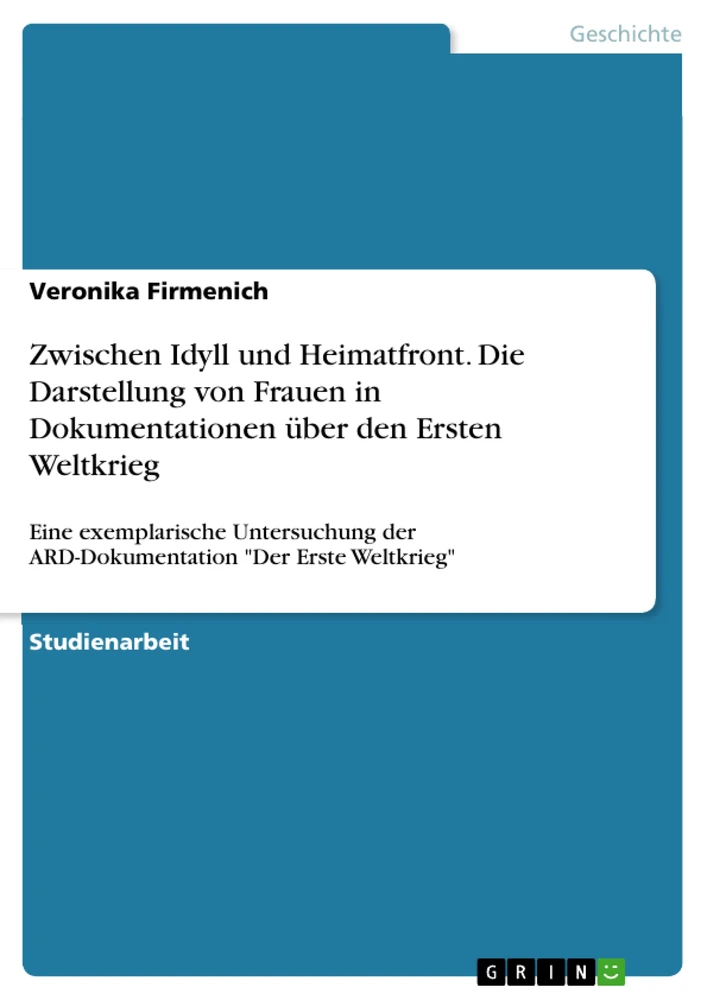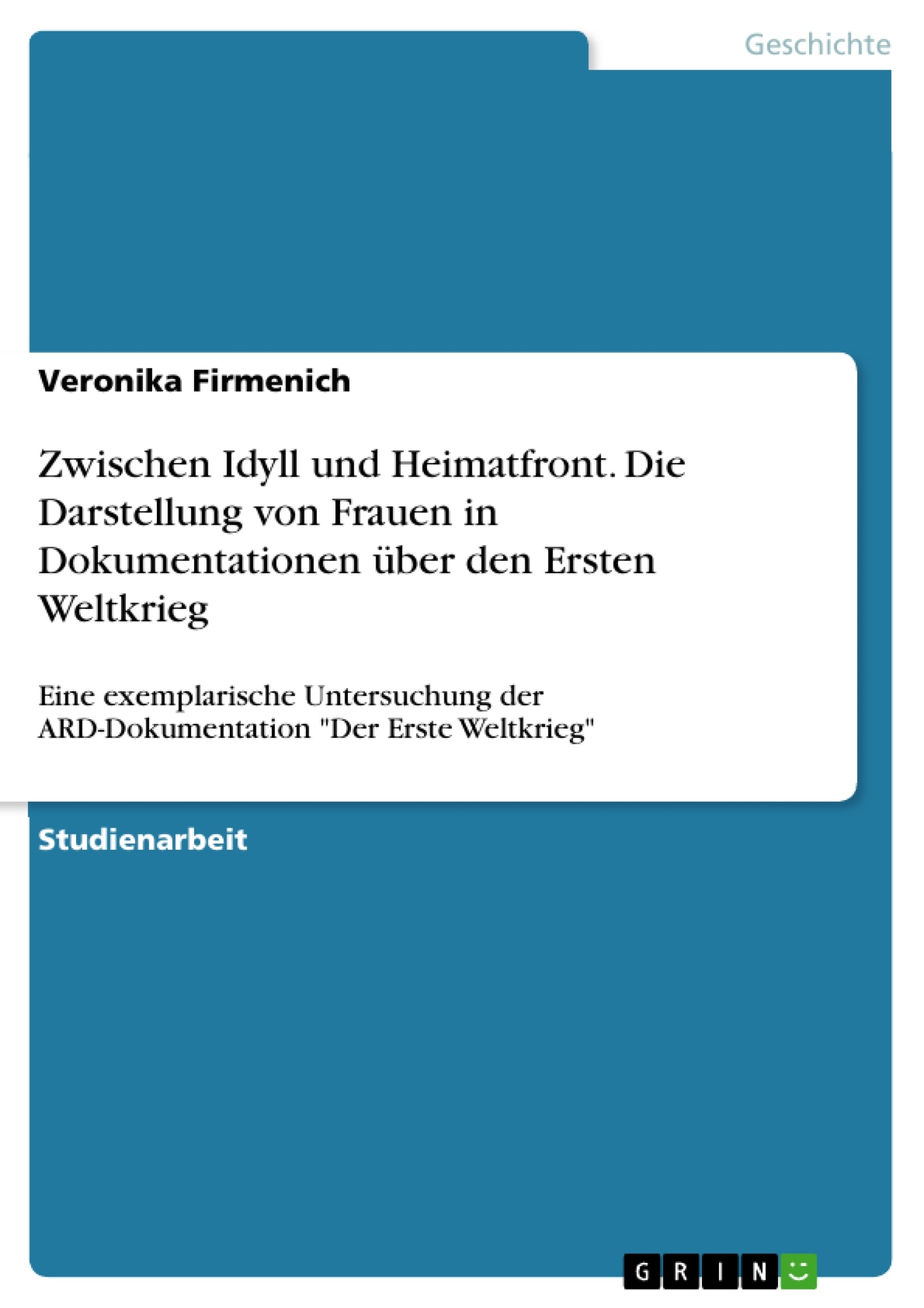Im Jahr 2004 strahlte die ARD eine fünfteilige Dokumentationsserie über den Ersten Weltkrieg aus. Anlässlich des neunzigsten Jahrestages macht sie sich Erinnerungsorte dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts zum Thema. Die vierte Folge heißt „Schlachtfeld Heimat“ und rückt eben diese Heimat und die Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft im Innern des Deutschen Reiches – ganz im Sinne der aktuellen Forschung von 2004 – in den Vordergrund. Als eine von drei Frauen suchten die Verantwortlichen Käthe Buchler und ihre Fotos als zentrale Person dieses Films aus.
Gegenstand dieser Arbeit wird es sein zu untersuchen, wieso gerade Käthe Buchler ausgesucht wurde und welche Rolle ihre historische Person in der Dokumentation spielt. Was sagt die Auswahl und Vorstellung ihrer Person aus? Welche Art Frauenbild verkörpert sie exemplarisch und ist es repräsentativ für den Geschlechterdiskurs ihrer Zeit? Entspricht die Auswahl ihrer Person dem aktuellen Forschungsstand von 2004? Ist Käthe Buchler historisch wirklich so aussagekräftig oder ist sie lediglich für einen Fernsehfilm gut präsentierbar? Und wo ordnet die Dokumentation sie zwischen Idyll und Heimatfront ein?
Die Beantwortung dieser Fragen erfordert eine Annäherung auf verschiedenen Ebenen. So wird in der historischen Herangehensweise auch auf kultur- und filmwissenschaftliche Aspekte eingegangen werden. Zu Beginn wird die Dokumentationsserie „Der Erste Weltkrieg“ und die historische Person Käthe Buchler vorgestellt. Anschließend folgt ein Überblick über den Stand der Forschung 2004, um die Produktion der Dokumentation zeitgemäß einordnen zu können. Dabei wird der Fokus auf den Geschlechterdiskursen und den neusten Erkenntnissen zur Heimatfront liegen. Im Hauptteil der Arbeit wird dann die Darstellung Käthe Buchlers in der Dokumentation untersucht, wobei die drei Untertitel „Frauen in Männerberufen“, „Sammlungen“ und „Lazarette“ die Bereiche kennzeichnen, in denen Buchler tätig war und wie diese in der Doku dargestellt werden. Das letzte Unterkapitel „Die letzten Fotos Buchlers“ wird sich mit eben diesen beschäftigen und die Gründe für den Abbruch ihrer Tätigkeit als (Kriegs-)Fotografin – so wie sie dargestellt werden – beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rahmeninformationen zur Dokumentation „Der Erste Weltkrieg“
- 3. Kurzbiografie Käthe Buchler
- 4. Forschungsüberblick 2004
- 5. Die Darstellung Buchlers in der Dokumentation
- 5.1 Frauen in Männerberufen
- 5.2 Lazarette
- 5.3 Sammlungen
- 5.4 Die letzten Fotos Buchlers
- 6. Fazit
- 7. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Fotografin Käthe Buchler in der ARD-Dokumentation „Der Erste Weltkrieg“ (2004), insbesondere in der Folge „Schlachtfeld Heimat“. Die Zielsetzung ist es, die Auswahl Buchlers als zentrale Person zu analysieren und zu bewerten, welche Aspekte ihres Lebens und ihrer Fotografien in der Dokumentation hervorgehoben werden und welche Aussagekraft dies im Hinblick auf den Geschlechterdiskurs des Ersten Weltkriegs und den Forschungsstand von 2004 hat.
- Die Darstellung von Frauen im Ersten Weltkrieg
- Die Rolle der Heimatfront im Ersten Weltkrieg
- Die Bedeutung von Fotografie als historische Quelle
- Die Auswahl und Präsentation von historischen Persönlichkeiten in Dokumentationen
- Der Vergleich zwischen der Darstellung Buchlers und dem aktuellen Forschungsstand
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Käthe Buchler und ihrer Fotografien in der ARD-Dokumentation "Der Erste Weltkrieg" vor. Sie skizziert den Kontext – ein Buch über Buchlers Fotografien und die Dokumentationsserie selbst – und umreißt die Methodik der Arbeit, die sowohl historische als auch kultur- und filmwissenschaftliche Aspekte berücksichtigt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswahl Buchlers zu untersuchen und deren Aussagekraft für den Geschlechterdiskurs ihrer Zeit zu beurteilen, unter Berücksichtigung des Forschungsstandes von 2004. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen.
2. Rahmeninformationen zur Dokumentation „Der Erste Weltkrieg“: Dieses Kapitel beschreibt die fünfteilige ARD-Dokumentation „Der Erste Weltkrieg“ von 2004, ihre Produktion (WDR/SWR), Zuschauerzahlen und Kosten. Es wird die Intention der Produzenten erläutert, den Alltag des Ersten Weltkriegs aus ungewöhnlichen Perspektiven darzustellen, insbesondere die Erfahrungen der Zivilbevölkerung an der Heimatfront. Das Kapitel betont die Verwendung von Originalmaterial (Fotos, Filmsequenzen, Objekte) und die Abwesenheit von nachgestellten Szenen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Folge „Schlachtfeld Heimat“ gewidmet, in der die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung im Fokus stehen.
3. Kurzbiografie Käthe Buchler: Diese Biografie bietet einen kurzen Überblick über das Leben von Käthe Buchler, geboren 1876 als Tochter eines Braunschweiger Landsyndikus. Sie liefert wichtige biografische Eckdaten, wie ihre Heirat und ihren Beruf als Fotografin. Die Kurzbiografie dient als Grundlage für das Verständnis ihrer Rolle in der Dokumentation und ihrer Fotografien.
Schlüsselwörter
Käthe Buchler, Erster Weltkrieg, Heimatfront, Frauen im Ersten Weltkrieg, Fotografie, ARD-Dokumentation, Geschlechterdiskurs, Dokumentarfilm, historische Quelle, Forschungsstand 2004, Braunschweig.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der ARD-Dokumentation "Der Erste Weltkrieg" (2004)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle der Fotografin Käthe Buchler in der ARD-Dokumentation „Der Erste Weltkrieg“ (2004), insbesondere in der Folge „Schlachtfeld Heimat“. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Auswahl Buchlers als zentrale Person und der Analyse der in der Dokumentation hervorgehobenen Aspekte ihres Lebens und ihrer Fotografien im Kontext des Geschlechterdiskurses des Ersten Weltkriegs und des Forschungsstands von 2004.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Frauen im Ersten Weltkrieg, die Rolle der Heimatfront, die Bedeutung von Fotografie als historische Quelle, die Auswahl und Präsentation historischer Persönlichkeiten in Dokumentationen und den Vergleich zwischen der Darstellung Buchlers und dem aktuellen Forschungsstand (Stand 2004).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Rahmeninformationen zur Dokumentation „Der Erste Weltkrieg“, Kurzbiografie Käthe Buchler, Forschungsüberblick 2004, Die Darstellung Buchlers in der Dokumentation (mit Unterkapiteln zu Frauen in Männerberufen, Lazaretten, Sammlungen und den letzten Fotos Buchlers), Fazit und Quellen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse und Bewertung der Auswahl Buchlers als zentrale Person in der Dokumentation. Es soll untersucht werden, welche Aspekte ihres Lebens und ihrer Fotografien hervorgehoben werden und welche Aussagekraft dies im Hinblick auf den Geschlechterdiskurs des Ersten Weltkriegs und den Forschungsstand von 2004 hat.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Methodik, die sowohl historische als auch kultur- und filmwissenschaftliche Aspekte berücksichtigt.
Wer ist Käthe Buchler?
Käthe Buchler (geboren 1876) war die Tochter eines Braunschweiger Landsyndikus und arbeitete als Fotografin. Die Arbeit bietet eine Kurzbiografie, die wichtige biografische Eckdaten liefert.
Welche Informationen zur Dokumentation "Der Erste Weltkrieg" werden gegeben?
Die Arbeit beschreibt die fünfteilige ARD-Dokumentation von 2004 (WDR/SWR), ihre Produktion, Zuschauerzahlen, Kosten und Intention. Besonderes Augenmerk liegt auf der Folge „Schlachtfeld Heimat“ und der Verwendung von Originalmaterial.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Käthe Buchler, Erster Weltkrieg, Heimatfront, Frauen im Ersten Weltkrieg, Fotografie, ARD-Dokumentation, Geschlechterdiskurs, Dokumentarfilm, historische Quelle, Forschungsstand 2004, Braunschweig.
Wie wird die Darstellung Buchlers in der Dokumentation analysiert?
Die Analyse der Darstellung Buchlers umfasst die Betrachtung ihrer Fotografien im Kontext von Frauen in Männerberufen, der Darstellung von Lazaretten, ihrer Sammlungen und ihren letzten Fotos. Die Analyse bezieht den Forschungsstand von 2004 mit ein.
- Citation du texte
- B.A. Veronika Firmenich (Auteur), 2014, Zwischen Idyll und Heimatfront. Die Darstellung von Frauen in Dokumentationen über den Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321149