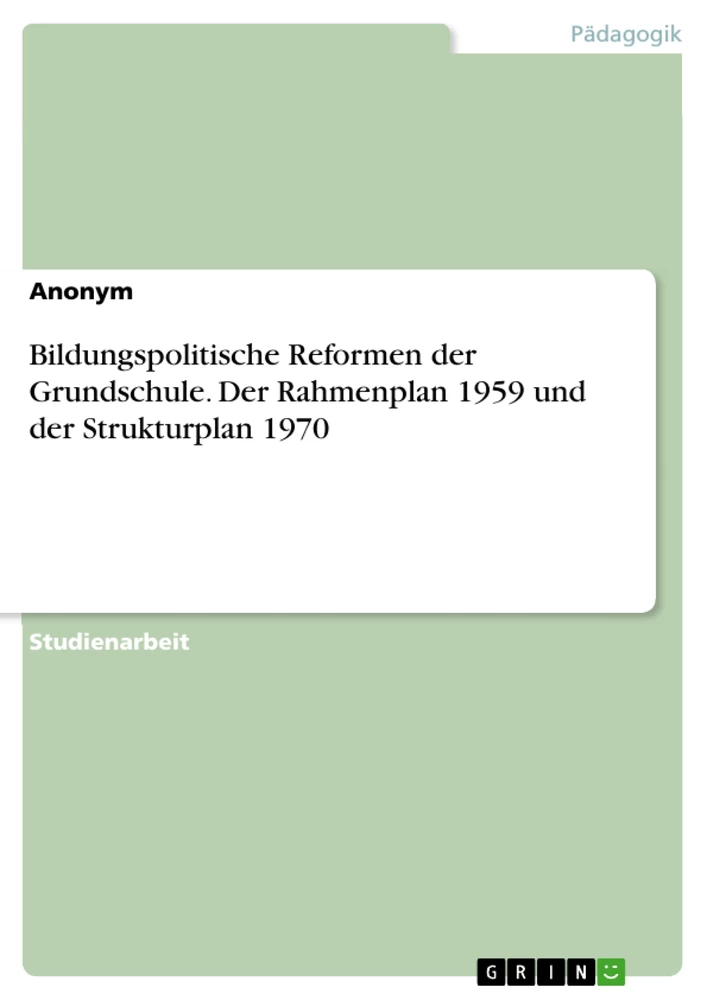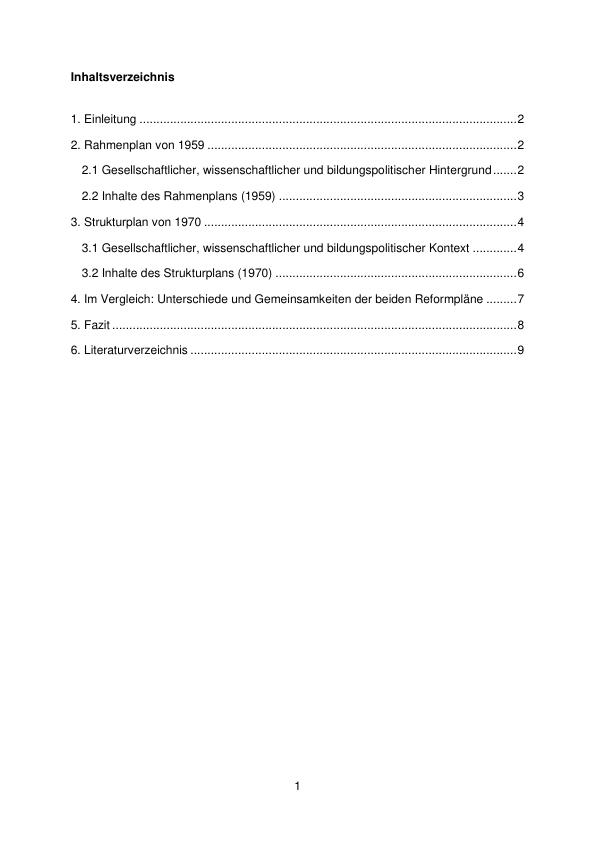Folgende Arbeit beschäftigt sich aus bildungspolitischer Perspektive mit zwei Reformplänen: zum einen mit dem „Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemein bildenden öffentlichen Schulwesens“ aus dem Jahr 1959 vom Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen und zum anderen mit dem vom Deutschen Bildungsrat entwickelten „Strukturplan für das Bildungswesen“ von 1970.
Es wird dargestellt, welche gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen zu dem jeweiligen Rahmen- bzw. Strukturplan führten und welche Reformziele in den Plänen verfolgt wurden. Außerdem wird herausgearbeitet, inwiefern sich der Strukturplan von 1970 auf den Rahmenplan von 1959 bezieht, das heißt, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten vorzufinden sind. Im Fokus innerhalb dieser beiden Pläne stehen schwerpunktmäßig die Reformen bezüglich der Grundschule.
Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland erfuhr in den 1960er und 1970er Jahren einschneidende Veränderungen. In Reaktion auf eine massive Bildungsexpansion, neue wirtschaftliche Herausforderungen, ungelöste soziale Strukturprobleme sowie zunehmende Kritik am bestehenden Bildungswesen wurde eine öffentliche Diskussion in Gang gesetzt, welche den Boden für umfassende Reformen des Schulwesens bereitete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenplan von 1959
- Gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und bildungspolitischer Hintergrund
- Inhalte des Rahmenplans (1959)
- Strukturplan von 1970
- Gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und bildungspolitischer Kontext
- Inhalte des Strukturplans (1970)
- Im Vergleich: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Reformpläne
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert aus bildungspolitischer Perspektive zwei Reformpläne des deutschen Schulwesens: den „Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemein bildenden öffentlichen Schulwesens“ von 1959 und den „Strukturplan für das Bildungswesen“ von 1970. Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen, die zu den jeweiligen Reformplänen führten, sowie die darin verfolgten Reformziele. Außerdem wird herausgearbeitet, inwiefern sich der Strukturplan von 1970 auf den Rahmenplan von 1959 bezieht, d.h. welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Plänen bestehen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf den Reformen bezüglich der Grundschule.
- Entwicklungen und Reformziele der beiden Reformpläne
- Gesellschaftliche, wissenschaftliche und bildungspolitische Hintergründe der Reformen
- Vergleich der Inhalte und Ziele der beiden Reformpläne
- Fokus auf die Reformen der Grundschule
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Rahmenplan von 1959 und dem Strukturplan von 1970
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungsreformen in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren ein. Sie beschreibt die Bildungsexpansion, die neuen wirtschaftlichen Herausforderungen und die zunehmende Kritik am bestehenden Bildungswesen, die zu einer öffentlichen Diskussion und dem Bedarf an umfassenden Reformen führten. Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Reformpläne: den „Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemein bildenden öffentlichen Schulwesens“ von 1959 und den „Strukturplan für das Bildungswesen“ von 1970.
Rahmenplan von 1959
Gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und bildungspolitischer Hintergrund
Dieser Abschnitt beschreibt die schwierige Situation des deutschen Bildungswesens nach dem Zweiten Weltkrieg, geprägt von Mangel an Lehrkräften, Schulgebäuden und Unterrichtsmaterialien. Die Arbeit beleuchtet die Rahmenrichtlinien des Potsdamer Abkommens von 1945 für eine umfassende Schulreform und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Ziele, wie Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung des Schulwesens. Sie analysiert die Renaissance der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und die Beibehaltung traditioneller Strukturen und Inhalte des Schulsystems der Weimarer Republik. Der Abschnitt beleuchtet die Debatte um die Schulorganisation und die zunehmende Bedeutung von Bildungsinhalten. Außerdem wird die föderale Struktur des Kultur- und Bildungswesens und die damit verbundenen unterschiedlichen Lösungen im Umgang mit Konfessionsschulen sowie die Uneinigkeit über die Länge der Grundschuldauer und die Regelung des Übergangs im weiteren Schulwesen beleuchtet. Schließlich werden die Modernisierungstendenzen der 1950er Jahre und die Gründung länderübergreifender Institutionen wie der Kultusministerkonferenz, des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen und des Wissenschaftsrats beschrieben.
Inhalte des Rahmenplans (1959)
Dieser Abschnitt widmet sich den Inhalten des „Rahmenplans zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemein bildenden öffentlichen Schulwesens“ von 1959. Der Plan forderte eine vierjährige Grundschule, eine Förderstufe im 5. und 6. Schuljahr, drei verschiedene Oberschulen (Haupt-, Realschule und Gymnasium) sowie die Sonderschule. Die Arbeit beschreibt die Ziele des Rahmenplans für die Grundschule, wie die Einheitlichkeit des Unterrichts für alle Kinder unabhängig von Schicht und Konfession, die Förderung der kindlichen Fähigkeiten und die Verlagerung der Auslese auf die Förderstufe. Der Abschnitt beleuchtet die inhaltlichen Schwerpunkte des Grundschulunterrichts, wie Sprache, Schrift, Rechnen und Raumvorstellung, sowie die pädagogisch-didaktischen Prinzipien des gemeinsamen, selbsttätigen, anschaulichen und subjekt bestimmten Lernens. Der Rahmenplan wird als ein Schonraum für die Entwicklung kindlicher Fähigkeiten dargestellt, der sich an den Zielen und Inhalten der Weimarer Zeit orientiert. Schließlich wird betont, dass der Rahmenplan, obwohl er nicht mit dem dreigliedrigen Schulmodell brach, wichtige Impulse für die folgende Reformdiskussion lieferte.
Strukturplan von 1970
Gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und bildungspolitischer Kontext
Dieser Abschnitt beschreibt die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und bildungspolitischen Veränderungen, die in den 1960er Jahren zu einer erneuten Kritik am traditionellen Bildungssystem führten. Die Arbeit beleuchtet die politische Neuorientierung, den Ost-West-Konflikt, das Ende des Wirtschaftswunders und die Entstehung eines neuen Mittelstandes. Sie analysiert die Kritik am Bildungssystem durch Georg Picht und Ralf Dahrendorf, die auf die Rückständigkeit der Bildung und die mangelnde Chancengleichheit im Bildungssystem hinwiesen. Der Abschnitt beschreibt die Studentenrevolten ab 1968 und deren Einfluss auf die politische Kultur sowie die Kritik von Gramm und Schaller an der geringen Einbindung der politischen Erziehung in das Schulwesen. Außerdem werden neuste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Begabtenförderung und die Abhängigkeit der Bildungslaufbahn von der Herkunftsschicht des Schülers beleuchtet. Der Abschnitt betont die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und die Abkehr von äußerer Differenzierung zugunsten innerer Differenzierung. Schließlich wird der Sputnik-Schock von 1957 und dessen Einfluss auf die Intensivierung der Bildungsprogramme, insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich, beschrieben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Reformen des deutschen Schulwesens in den 1960er und 1970er Jahren, insbesondere auf den „Rahmenplan“ von 1959 und den „Strukturplan“ von 1970. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bildungsexpansion, Wirtschaftswachstum, Chancengleichheit, soziales Ungleichgewicht, geisteswissenschaftliche Pädagogik, Grundschule, Förderstufe, Oberschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Sonderschule, Demokratisierung, Wissenschaftsorientierung, Bildungsreformen, Strukturreformen, Rahmenplan, Strukturplan, Bildungsplanung, Kultusministerkonferenz, Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen, Deutscher Bildungsrat.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Bildungspolitische Reformen der Grundschule. Der Rahmenplan 1959 und der Strukturplan 1970, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321100