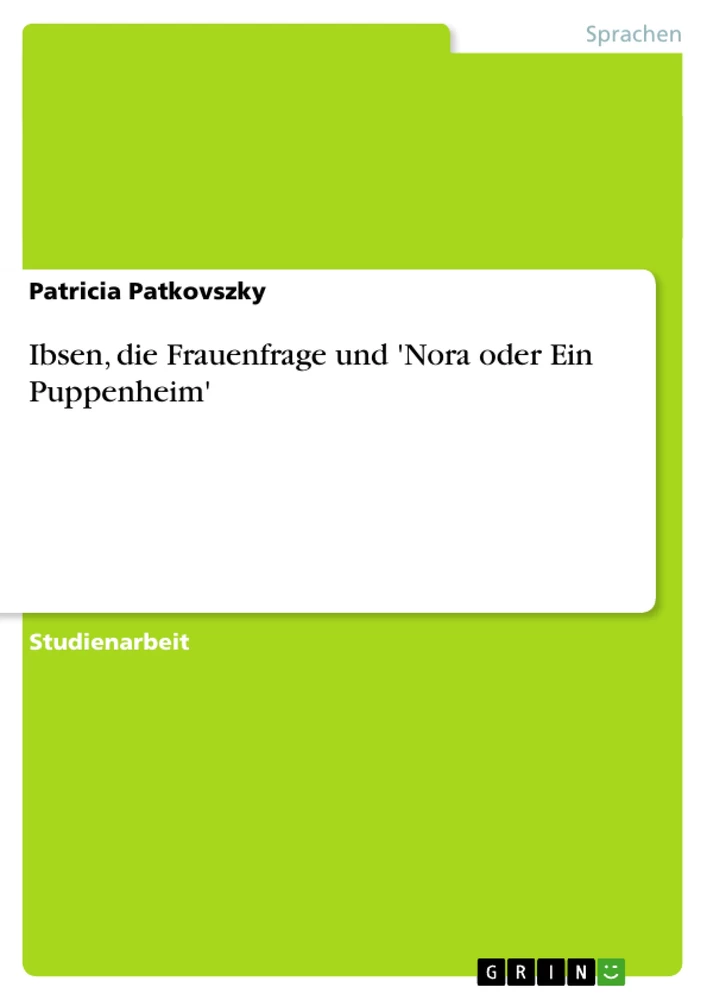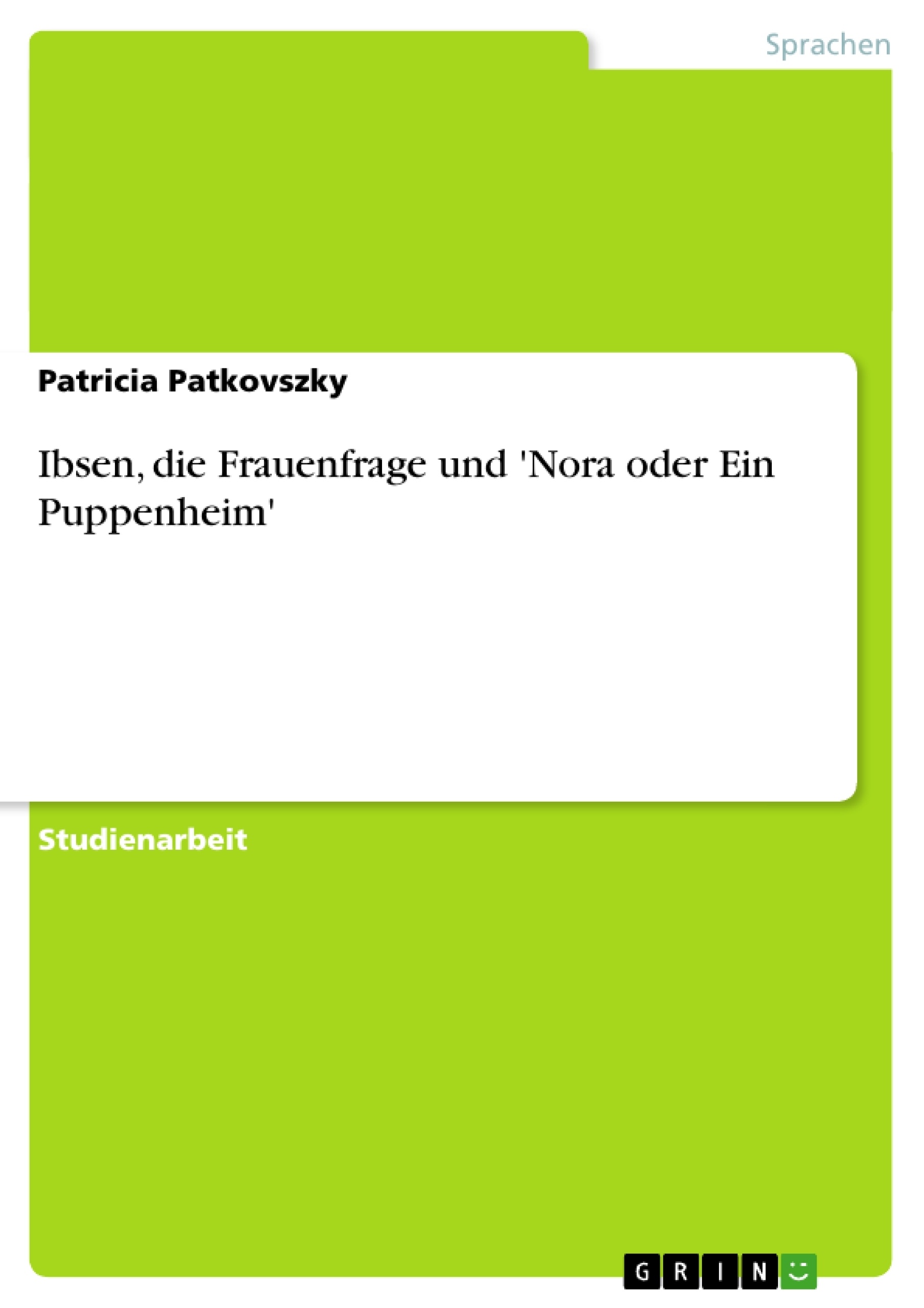Mit Ein Puppenheim hat Ibsen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, der über Schweden hinaus in den europäischen Ländern ein breites Echo fand. Zeitgenössische Kommentatoren fassten das Werk als Tendenzstück und als Kampfruf für die Rechte der Frauen auf. Dem eigenen Standpunkt folgend, sah man in dem Stück einen nahezu anarchistischen Angriff auf die „geheiligte Institution der Ehe“ oder eine mutige Darstellung der entrechteten und versklavten Frau, die um Gleichberechtigung rang.
Nach überliefertem Verständnis war das öffentliche und wirtschaftliche Leben die Domäne des Mannes; die Frau gehörte ins Haus, an den Herd oder in die Kinderstube. Die Zeit der reinen Männergesellschaft, in der die Frau nur als Dekor und Spielwerk geduldet wurde, war jedoch vorbei. Frauen verlangten ihren Anteil am öffentlichen Leben, augenscheinlich am Beispiel der Suffragetten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht eintraten. Ein Puppenheim lässt sich in diesem Kontext verorten: Nora befreit sich aus der Abhängigkeit von Mann und Familie; sie fordert für sich das Recht der Persönlichkeit. Am Schluss des Stückes deklariert sie: „Vor allem bin ich ein Mensch, glaube ich, ebenso wie du – oder wenigstens will ich versuchen, einer zu werden.“
Reicht diese erste Einordnung, um Ibsen als Vorkämpfer der Rechte der Frauen zu bezeichnen? Hat Ibsen mit Ein Puppenheim über das Genre des Sozialdramas hinausgegriffen und ein Plädoyer für die Emanzipation der Frau abgegeben, das möglicherweise sogar bis zum Feminismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachwirkt?
Die weitreichende Frage nach der Berechtigung einer feministischen Auslegung von Ein Puppenheim kann hier nur unvollständig beantwortet werden. Zwei Quellen sollen herangezogen werden: die biographischen Verbindungen Ibsens zu Frauen und zur Frauenbewegung einerseits sowie die Rezeption von Ein Puppenheim andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung.
- 2. Ibsen ein Leben mit der Frauenfrage......
- 3. Nora: Frauenrecht und Frauentragödie..
- 3.1 Ablehnende Stimmen
- 3.2 Die Frauenfrage in der Entstehungsgeschichte von Ein Puppenheim....
- 3.3 Aufnahme des Werkes...
- 3.3.1 Diskreditierung von Nora
- 3.3.2 Nora aus Sicht der Frauenbewegung..
- 4. Nachwort..
- 5. Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Henrik Ibsens Drama „Ein Puppenheim“ im Kontext der Frauenfrage des 19. Jahrhunderts. Das Ziel ist es, die Relevanz des Stücks für die Entwicklung des Feminismus zu beleuchten und die Rolle Ibsens als möglichen Vorkämpfer der Frauenrechte zu untersuchen.
- Die Darstellung der Frauenrolle in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Die Emanzipationsbestrebungen der Frauen im Kontext der Entstehung von „Ein Puppenheim“
- Die Kontroverse um die Interpretation von „Ein Puppenheim“ als feministisches Werk
- Ibsens eigene Ansichten zur Frauenfrage und seine Verbindung zur Frauenbewegung
- Die Rezeption von „Ein Puppenheim“ in der feministischen Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von „Ein Puppenheim“ für die Frauenfrage in den Fokus rückt. Kapitel 2 beleuchtet Ibsens eigene Lebensgeschichte und seinen Kontakt zur Frauenbewegung, wobei die Einflüsse seiner Mutter und seiner Ehefrau auf seine Dramen dargestellt werden. Kapitel 3 analysiert die Figur der Nora und ihr Streben nach Selbstbestimmung im Kontext der gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen im 19. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Henrik Ibsen, Ein Puppenheim, Frauenfrage, Feminismus, Frauenrechte, Emanzipation, Gesellschaftliche Rollen, Norwegen, Skandinavische Literatur, Tendenzstück, Sozialdrama, Rezeption.
- Quote paper
- Patricia Patkovszky (Author), 2003, Ibsen, die Frauenfrage und 'Nora oder Ein Puppenheim', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32066