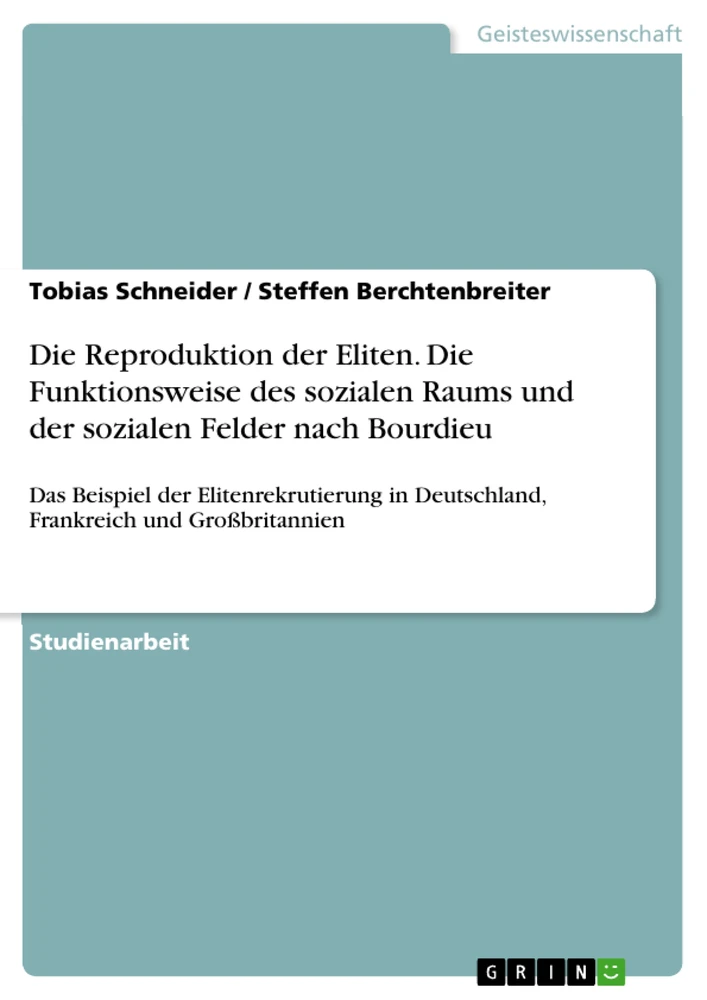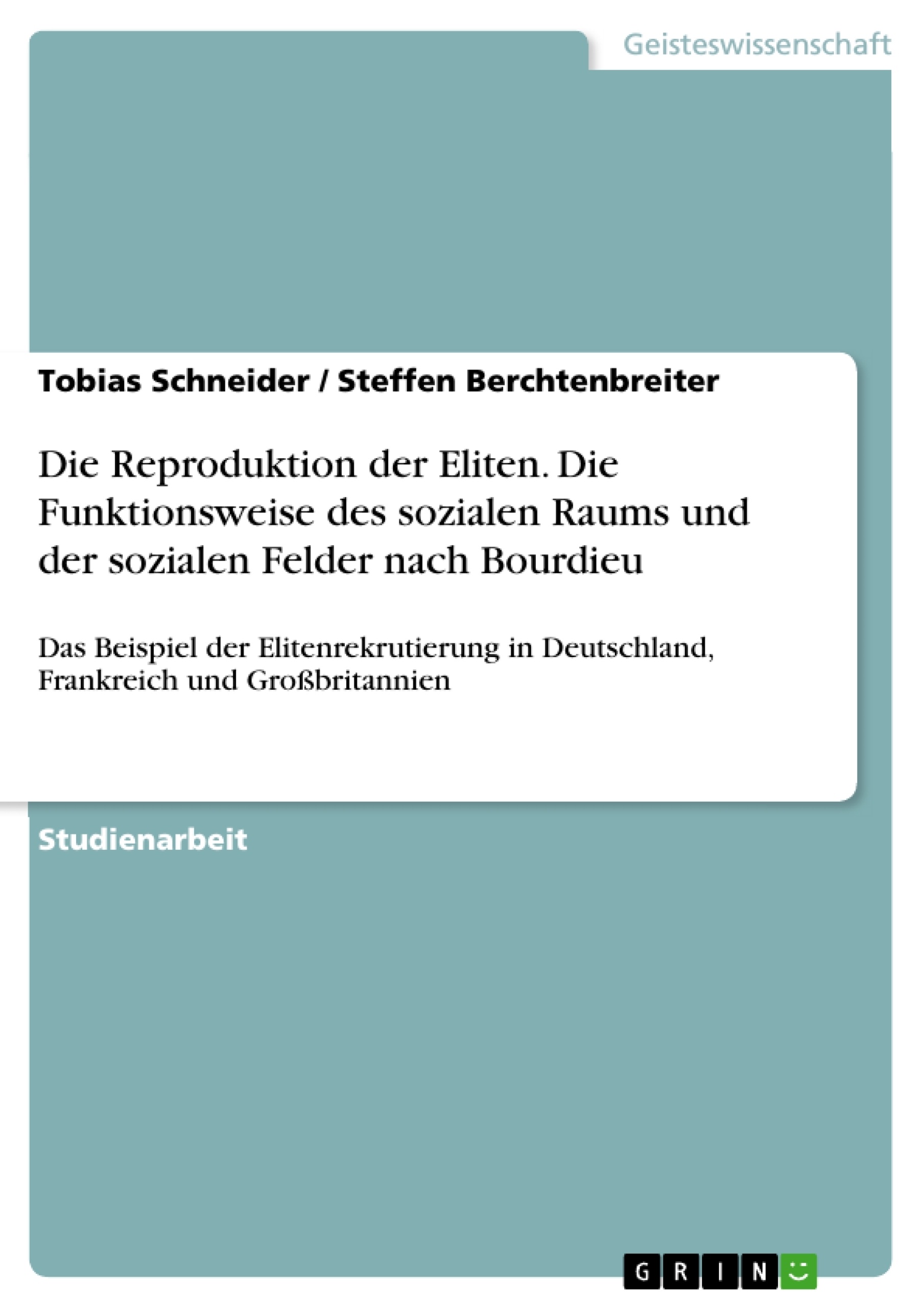Eine Bildungsreform jagt die nächste, um dem Ziel der Chancengleichheit näher zu kommen. Dass diese Chancengleichheit eine – wenn auch erstrebenswerte – Illusion ist, deckt Bourdieu in seinem Buch „Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs“ auf. In diesem Werk setzt sich Bourdieu kritisch mit dem Bildungswesen in Frankreich auseinander und weist darauf hin, dass in diesem die Unterschiede zwischen den Individuen nicht aufgehoben, sondern vielmehr manifestiert werden.
Der Glaube an eine steigende Chancengleichheit in der deutschen Gesellschaft, vor allem befördert durch das staatliche Schulsystem, ist auch in Deutschland fest verankert. Die Chancengleichheit gehört in unserer modernen Gesellschaft offiziell zu einem erstrebenswerten Grundwert. Diese stellt die Wertvorstellung und zugleich politische Forderung dar, dass „allen Menschen die gleichen Möglichkeiten für die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten zu gewähren“ (Hillmann 2007: S. 120) ist.
Dieses Paradigma wurde aber durch den Elitesoziologen Michael Hartmann ins Wanken gebracht. Er hat die Rekrutierung der Eliten in Deutschland, sowie in einem späteren Werk der internationalen Eliten, erforscht und die Mechanismen des sozialen Feldes der Eliten aufgezeigt. Auch diese Hausarbeit verabschiedet sich von der Illusion der Chancengleichheit. Anhand der Leitfrage „Wie reproduzieren sich Eliten?“ soll aufgezeigt werden, dass keineswegs Fleiß und Leistung die Hauptfaktoren sind, die einem jeden Zugang zu Erfolg und Spitzenpositionen verschaffen.
Hierzu werden im Folgenden Pierre Bourdieus Theorien des sozialen Raums und des soziale Feldes erarbeitet. Anhand dieser werden gesellschaftliche Selektionsmechanismen erkenntlich, die sich vor allem im Verborgenen und unbewusst abspielen. Anhand der Länder: Frankreich, Großbritannien und Deutschland werden schließlich beispielhaft die Reproduktionsmechanismen der Eliten in den Feldern der Wirtschaft, Politik und Verwaltung diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog...
- Erster Teil
- Heranführung an Pierre Bourdieus Werkzeuge zur Untersuchung der gesellschaftlichen Ordnung.
- Die Kapitalsorten
- Objektives Kapital
- Subjektives Kapital
- Sozialer Raum und Klassen
- Soziale Felder
- Das Feld der Macht
- Der Habitus
- Elite
- Definition der Elite
- Klassische Elitesoziologie
- Die Psychologie der Massen
- Die herrschende Klasse
- Das eherne Gesetz der Oligarchie
- Die Funktionseliten
- Masse und Funktionseliten
- Funktionseliten und Demokratie
- Kritische Elitesoziologie: Elite und Klassen
- Zweiter Teil
- Elitenrekrutierung in Deutschland, Frankreich und Groß-Britannien in den Feldern der Wirtschaft, Politik und Verwaltung
- Bourdieus Werkzeuge in der kritischen Elitesoziologie
- Die Bildungsexpansion und die Elitebildungsinstitutionen
- Die französische Elite
- Die französischen Elitehochschulen
- Herausbildung eines Adels
- Elitecorps
- Die Homogenität und Mobilität der französischen Elite
- Elite in Groß-Britannien
- Die britischen Elitebildungseinrichtungen
- Elitenrekrutierung in Groß-Britannien
- Die deutsche Elite
- Bildungseinrichtungen in Deutschland
- Elitenrekrutierung in Deutschland
- Wandelnde Elitenrekrutierung in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Reproduktion von Eliten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie analysiert, wie sich die Eliten in diesen Ländern im Laufe der Zeit etablieren und ihre Positionen erhalten. Im Fokus stehen dabei die Mechanismen des sozialen Raums und der sozialen Felder, die Pierre Bourdieu in seinen Werken entwickelt hat.
- Die Reproduktion von Eliten in verschiedenen Gesellschaften
- Die Rolle von Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) bei der Elitenbildung
- Die Bedeutung von Bildungseinrichtungen und Institutionen für die Elitenrekrutierung
- Die Herausbildung von Elite-Netzwerken und -strukturen
- Die Dynamik und der Wandel der Elitenbildung in den untersuchten Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog führt in die Thematik der Elitenreproduktion ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext von Chancengleichheit und Bildungssystemen dar. Er thematisiert die Illusion der Chancengleichheit und stellt die These auf, dass die Reproduktion von Eliten nicht allein durch Leistung und Fleiß bestimmt wird.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Vorstellung von Pierre Bourdieus Werkzeugen zur Analyse der gesellschaftlichen Ordnung. Er erläutert die verschiedenen Kapitalformen, den sozialen Raum, die sozialen Felder und den Habitus. Diese Konzepte dienen als Grundlage für die Analyse der Elitenbildung und -reproduktion.
Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Elitenrekrutierung in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Er analysiert die Rolle von Bildungseinrichtungen, die Herausbildung von Elite-Netzwerken und die Dynamik der Elitenbildung in den jeweiligen Ländern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kritischen Analyse der Mechanismen, die zur Reproduktion von Eliten beitragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Elitenreproduktion, sozialer Raum, soziale Felder, Kapitalformen, Bildungsexpansion, Elitebildungsinstitutionen, Elitenrekrutierung, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Bourdieu, kritische Elitesoziologie.
- Quote paper
- Tobias Schneider (Author), Steffen Berchtenbreiter (Author), 2013, Die Reproduktion der Eliten. Die Funktionsweise des sozialen Raums und der sozialen Felder nach Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319623