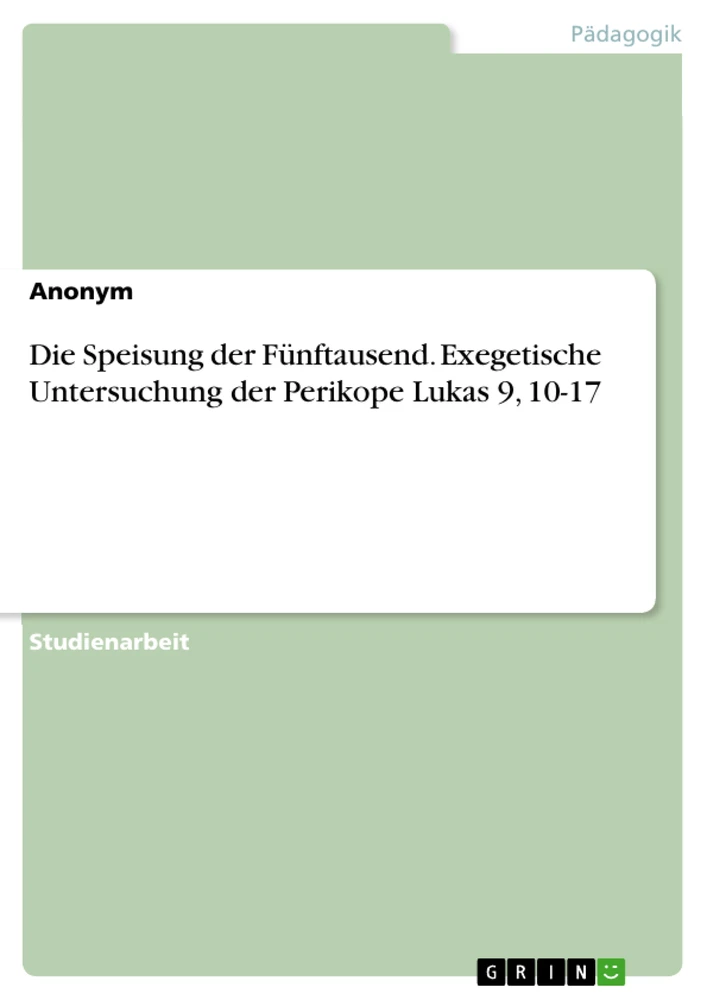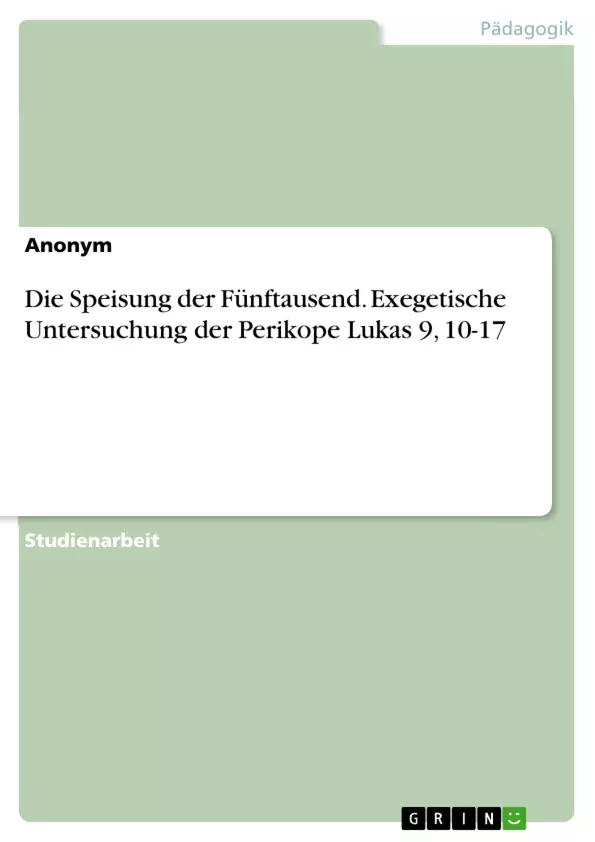Unter Verwendung der historisch kritischen Methode (HKM) wird in dieser Hausarbeit die Perikope Lk 9, 10-17 umfassend analysiert.
Die historisch-kritische Methode in traditioneller Anwendung gilt inzwischen nicht mehr als das „non plus ultra“ für exegetische Untersuchungen, sondern wurde durch weitere Methodenschritte der Literarkritik ergänzt. Hierdurch ist ein umfangreicher Methodenkanon entstanden, dessen Anwendung im „Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments“ von Wolfgang Fenske detailliert beschrieben ist.
Fenskes Vorlage folgend, geht diese exegetische Hausarbeit vom Methodenschritt „Textkritik / Übersetzungsvergleich“ aus, um für die Weiterarbeit eine Übersetzung ausfindig zu machen, die dem Urtext möglichst nahe ist. Es folgt eine linguistische Betrachtung, um die Frage nach dem pragmatischen Aufbau, den inhaltlichen Aussagen und den beabsichtigten Wirkungen des Textes zu erhellen. Dieser Methodenschritt ist der einzige synchrone Methodenschritt.
In der „Literarkritik“ wird die Perikope von ihrem Kontext abgegrenzt und in einem synoptischen Vergleich innerhalb der Evangelien auf Brüche im Text untersucht, um einen Rückschluss auf Minor- oder Major-Agreements ziehen zu können. Die formgeschichtliche Analyse soll die Funktion der Textgattung erschließen und Aufschluss über die Frage nach dem „Sitz im Leben“ nach Hermann Gunkel geben. Die traditionsgeschichtliche Analyse hinterfragt und belegt hingegen die vorliegende Perikope anhand innerbiblischer und außerbiblischer Belege unter besonderer Berücksichtigung des jüdischen und des hellenistischen Weltbilds. Die Untersuchung der Redaktionsgeschichte bezieht das theologische Profil des Redaktors in die Bewertung der Perikope mit ein. Abgerundet wird die exegetische Untersuchung der Perikope Lk 9, 10-17 von einem Fazit in Form einer Gesamtinterpretation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzungsvergleich
- Vers-für-Vers Analyse Lukas 9, 10-17
- Linguistische Betrachtung
- Syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Pragmatische Analyse
- Literarkritik
- Abgrenzung der Perikope vom Kontext
- Synoptischer Vergleich
- Vergleich Matthäus 14, 13-21 mit Markus 6, 30-44
- Vergleich Markus 6, 30-44 mit Lukas 9, 10-17
- Vergleich Matthäus 14, 13-21 mit Lukas 9, 10-17
- Formgeschichte
- Gattungszugehörigkeit
- Vergleich von Lk 9, 10-17 mit anderer Perikope
- Funktion der Gattung Wundergeschichte
- Sitz im Leben:
- Traditionsgeschichte
- Motivkritik
- Redaktionsgeschichte
- Gesamtinterpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende exegetische Hausarbeit untersucht die Perikope Lukas 9, 10-17 mit dem Ziel, die verschiedenen Methodenschritte der Textkritik, Linguistik, Literarkritik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte und Redaktionsgeschichte anzuwenden, um einen umfassenden Einblick in den Text zu gewinnen und seine Bedeutung im Kontext der neutestamentlichen Literatur zu erschließen.
- Übersetzungsvergleich und Textkritik
- Linguistische Analyse von Syntax, Semantik und Pragmatik
- Literarische Analyse und synoptischer Vergleich
- Formgeschichte und Gattungsanalyse
- Traditionsgeschichte und ihre Relevanz für den Text
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Methodik der exegetischen Arbeit vor, die auf dem "Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments" von Wolfgang Fenske basiert. Sie erläutert die einzelnen Methodenschritte und ihre Anwendung im Kontext der Perikope Lukas 9, 10-17.
- Übersetzungsvergleich: Dieser Abschnitt widmet sich der Frage, welche deutsche Bibelübersetzung dem Urtext am nächsten kommt. Er beleuchtet die Herausforderungen der Übersetzung und die verschiedenen Instrumente der Textkritik, die zur Bestimmung der dem Urtext näheren Übersetzung verwendet werden können.
- Vers-für-Vers Analyse Lukas 9, 10-17: Hier erfolgt eine detaillierte Analyse der verschiedenen Bibelübersetzungen (Neue Genfer Übersetzung, Hoffnung für alle, Schlachter) anhand der "lectio brevior" und "lectio difficilior"-Methode. Anhand von Vers-für-Vers Vergleichen werden die Unterschiede zwischen den Übersetzungen herausgearbeitet, um die dem Urtext nähere Übersetzung zu ermitteln.
- Linguistische Betrachtung: Dieser Abschnitt befasst sich mit den linguistischen Besonderheiten der Perikope und analysiert sie in Hinblick auf ihre Syntax, Semantik und Pragmatik. Die Analyse soll Aufschluss über die grammatikalischen Strukturen, die Wortbedeutung und die kommunikativen Funktionen des Textes liefern.
- Literarkritik: Dieser Abschnitt analysiert die Perikope innerhalb ihres Kontextes und im Vergleich zu den parallelen Texten in Matthäus und Markus. Der synoptische Vergleich soll Aufschluss über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Textversionen geben und Rückschlüsse auf die literarische Tradition und die Entstehung der einzelnen Evangelien ermöglichen.
- Formgeschichte: Die Formgeschichte untersucht die Gattung der Perikope und ihren Sitz im Leben. Anhand von vergleichenden Analysen mit anderen Wundergeschichten soll die Funktion und Bedeutung der Perikope innerhalb der neutestamentlichen Literatur herausgearbeitet werden.
- Traditionsgeschichte: Dieser Abschnitt analysiert die Perikope unter Berücksichtigung ihrer Tradition und untersucht sie anhand innerbiblischer und außerbiblischer Belege. Die Analyse bezieht das jüdische und hellenistische Weltbild in die Betrachtung ein und soll Aufschluss über die Entstehung und Weiterentwicklung des Textes geben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Lukas 9, 10-17, Perikope, Übersetzungsvergleich, Textkritik, Linguistische Analyse, Literarkritik, Synoptischer Vergleich, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Redaktionsgeschichte, Exegese, Neues Testament.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der exegetischen Untersuchung von Lukas 9, 10-17?
Die Arbeit analysiert die Speisung der Fünftausend mittels historisch-kritischer Methoden, um den Aufbau, die Gattung und die theologische Bedeutung des Textes zu erschließen.
Was bedeutet „Sitz im Leben“ in der Formgeschichte?
Dieser Begriff von Hermann Gunkel beschreibt den ursprünglichen sozialen und rituellen Kontext, in dem ein Text innerhalb der frühen christlichen Gemeinde entstanden ist.
Warum wird ein synoptischer Vergleich durchgeführt?
Um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas) herauszuarbeiten und Rückschlüsse auf die Quellen und Redaktionsabsichten zu ziehen.
Was unterscheidet die Redaktionsgeschichte von der Traditionsgeschichte?
Die Traditionsgeschichte untersucht die Vorstufen des Textes, während die Redaktionsgeschichte das spezifische theologische Profil des Evangelisten als Endredakteur betont.
Welche Rolle spielt die Textkritik bei dieser Untersuchung?
Sie dient dazu, durch den Vergleich verschiedener Handschriften und Übersetzungen einen Text zu rekonstruieren, der dem ursprünglichen Urtext am nächsten kommt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Die Speisung der Fünftausend. Exegetische Untersuchung der Perikope Lukas 9, 10-17, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319215