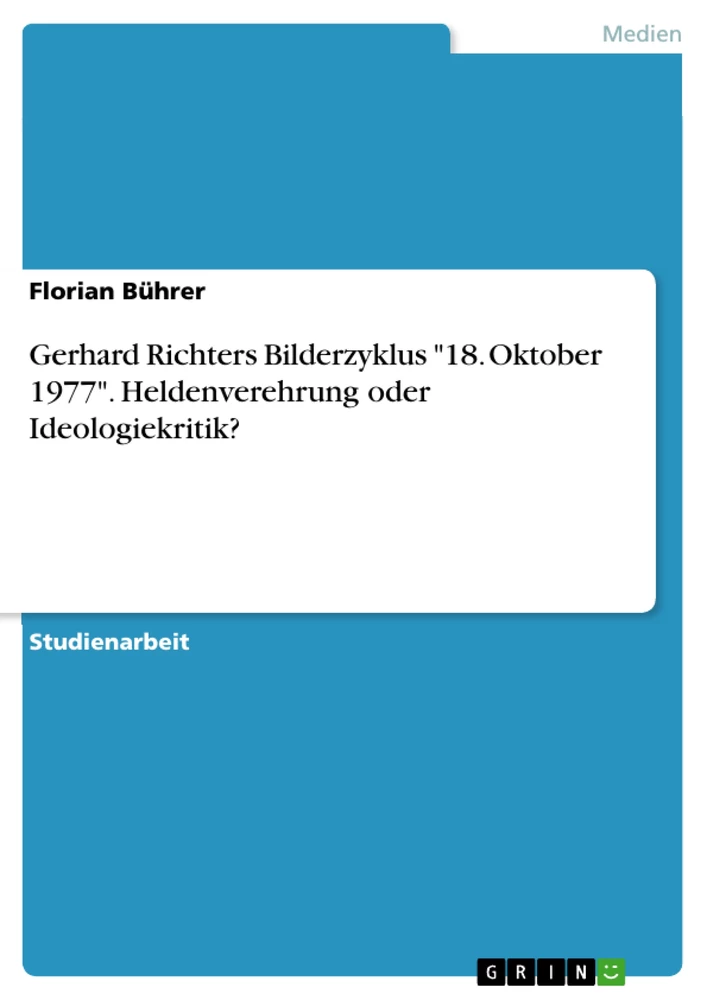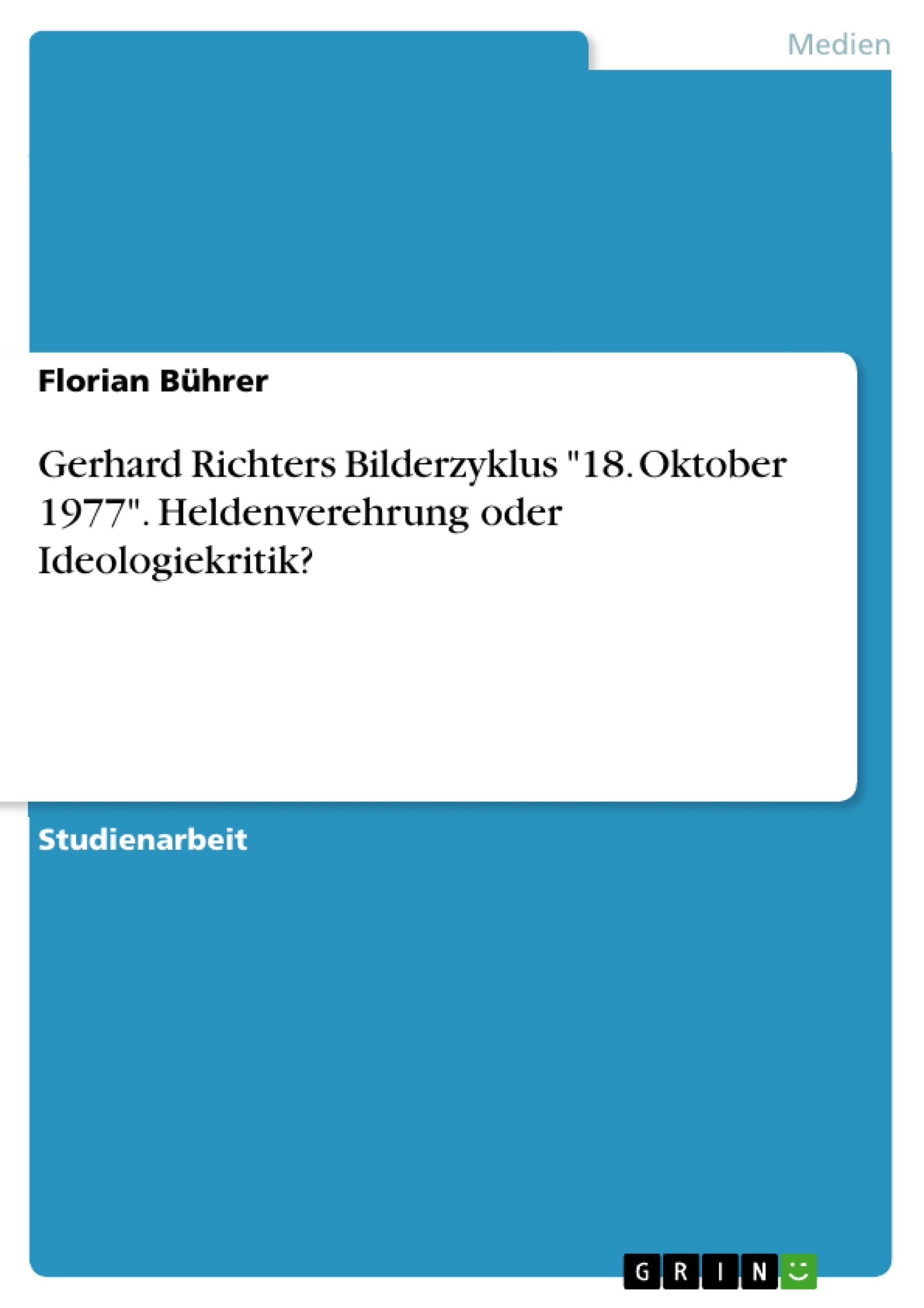Gerhard Richters Bilderzyklus trägt den schlichten Namen "18. Oktober 1977". Der Titel verweist auf das Ende eines langen Konfliktes zwischen den staatlichen Autoritäten der BRD und der ersten Generation einer radikal militanten Vereinigung, der Roten Armee Fraktion. Die unmittelbare Konfrontation mit dem linken Terrorismus gehörte zu den prägendsten Ereignissen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Thematik ist bis heute wesentlich stärker mit Verboten, Scham und Angst besetzt als die Verbrechen des Dritten Reiches, mit denen sich viel zu viele längst psychisch und sozial arrangiert zu haben scheinen.
Durch die bis heute anhaltende politische Brisanz gehört der Zyklus zu den strittigsten Werken Richters. Kein anderes Kunstwerk des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist von der Kritik mit vergleichbarem Interesse aufgenommen oder ähnlich kontrovers diskutiert worden. Von vielen Seiten wurde Richter vorgeworfen, er verharmlose mit seinem Werk den Terror und seine Fokussierung auf die RAF-Täter stelle eine Pietätlosigkeit gegenüber den Opfern dar. Hilton Kramer warf Richter gar vor, er wolle die Erinnerung an die RAF romantisieren und erhebe die Baader-Meinhof-Bande zu politischen Heiligen. Dem Vorwurf der Heldenverehrung widerspricht diese Arbeit entschieden. Vielmehr stellt diese Arbeit die These auf, Richters Zyklus stellt es eine umfassende, allgemeine Kritik an ideologischen bzw. totalitären Denkmustern dar.
Um den Nachweis der Richtigkeit dieser These zu erbringen, erfolgt zunächst ein Exkurs zur RAF- Thematik. Ein chronologischer Ablauf der Ereignisse wäre dabei jedoch unsachgemäß, vielmehr soll das totalitäre Denken der RAF hier im Vordergrund stehen. Anschließend wird im weiteren Verlauf auf ausgewählte Werke des Zyklus eingegangen. Eine umfassende Untersuchung des gesamten Zyklus lässt der begrenzte Umfang dieser Arbeit nicht zu. Dass im Zyklus wichtige zeithistorische Motive nicht dargestellt wurden, ist hinsichtlich der Interpretation des Zyklus von Bedeutung. Hinsichtlich der These scheint es zudem angebracht, genauer auf frühere Werke Richters einzugehen. Der Film Volker Bradke und der Lichtdruck Mao sind nicht nur frühe Werke Richters, in denen er sich kritisch mit ideologischen Denkmustern auseinandersetzte, in beiden Arbeiten wurde auch das Prinzip der Unschärfe angewandt. Die Verifizierung der eingangs postulierten These erfolgt abschließend in einem kurzen Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sechs gegen 60 Millionen - die RAF
- 3. Der Bilderzyklus 18. Oktober 1977
- 3.1 Betrachtung einzelner Bilder des Zyklus
- 3.2 Auslassen einzelner Bildmotive
- 4. Ideologiekritik in früheren Werken Richters
- 5. Vom Umgang anderer Künstler mit der RAF-Thematik
- 5.1 Sigmar Polke: Ohne Titel (Dr. Bonn) und Sicherheitsverwahrung
- 5.2 Odd Nerdrum: Der Mord an Andreas Baader
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gerhard Richters Bilderzyklus „18. Oktober 1977“ und widerlegt die These der Heldenverehrung der RAF. Stattdessen wird argumentiert, dass der Zyklus eine umfassende Kritik an ideologischen und totalitären Denkmustern darstellt. Die Analyse stützt sich auf eine Betrachtung ausgewählter Bilder des Zyklus, die Auslassung bestimmter Motive, frühere Werke Richters, sowie den Vergleich mit dem Umgang anderer Künstler mit der RAF-Thematik.
- Analyse von Gerhard Richters Bilderzyklus "18. Oktober 1977"
- Widerlegung des Vorwurfs der Heldenverehrung der RAF durch Richter
- Interpretation des Zyklus als Kritik an ideologischen und totalitären Denkmustern
- Vergleich mit dem Umgang anderer Künstler mit der RAF-Thematik
- Bedeutung der Auslassung bestimmter Motive im Zyklus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Bilderzyklus „18. Oktober 1977“ von Gerhard Richter vor und thematisiert die bis heute anhaltende Kontroverse um das Werk. Sie führt den Vorwurf der Verharmlosung des Terrors und der Heldenverehrung der RAF an, entgegnet dieser aber mit der These, dass der Zyklus vielmehr eine Kritik an ideologischen und totalitären Denkmustern darstellt. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der einen Exkurs zur RAF, die Analyse ausgewählter Bilder, die Bedeutung ausgelassener Motive, die Betrachtung früherer Werke Richters und den Vergleich mit anderen Künstlern umfasst.
2. Sechs gegen 60 Millionen - die RAF: Dieses Kapitel beleuchtet das totalitäre Denken der RAF, ohne einen chronologischen Ablauf der Ereignisse zu verfolgen. Es beschreibt die Entstehung der RAF im Kontext der Studentenbewegung der 1960er Jahre, ihre marxistisch-leninistische Ideologie mit Einflüssen aus lateinamerikanischen Befreiungsbewegungen und anarchistischen Ideen, und ihr Konzept der Stadtguerilla als antiimperialistischen Kampf. Die Entwicklung der RAF von der Beschaffungskriminalität zu Bombenanschlägen und schließlich zum „Deutschen Herbst“ wird skizziert, wobei der Fokus auf der ideologischen Begründung der Gewalt liegt.
3. Der Bilderzyklus 18. Oktober 1977: Dieses Kapitel befasst sich mit ausgewählten Aspekten des Bilderzyklus. Die Analyse einzelner Bilder und die Bedeutung ausgelassener Motive werden untersucht, ohne den gesamten Zyklus umfassend zu betrachten. Der begrenzte Umfang der Arbeit erlaubt lediglich eine fokussierte Betrachtung, die dennoch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Gesamtwerks leistet. Die Interpretation konzentriert sich auf die Darstellung der ideologischen und totalitären Aspekte im Kontext der RAF und deren Wirkung.
4. Ideologiekritik in früheren Werken Richters: Das Kapitel untersucht frühere Werke Richters, wie den Film „Volker Bradke“ und den Lichtdruck „Mao“, um die These der Ideologiekritik zu untermauern. Es analysiert, wie Richter bereits in diesen früheren Arbeiten kritisch mit ideologischen Denkmustern umgegangen ist und das Prinzip der Unschärfe angewendet hat. Die Verbindungen zu den Themen und Techniken des „18. Oktober 1977“-Zyklus werden aufgezeigt.
5. Vom Umgang anderer Künstler mit der RAF-Thematik: Dieses Kapitel vergleicht Richters Umgang mit der RAF-Thematik mit dem anderer Künstler, exemplarisch an Sigmar Polkes Werken „Ohne Titel (Dr. Bonn)“ und „Sicherheitsverwahrung“, sowie Odd Nerdrums „Der Mord an Andreas Baader“. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema aufgezeigt, um Richters Position und Herangehensweise besser zu verstehen und einzuordnen.
Schlüsselwörter
Gerhard Richter, 18. Oktober 1977, RAF, Rote Armee Fraktion, Bilderzyklus, Ideologiekritik, Totalitarismus, Kunst und Politik, deutsche Nachkriegsgeschichte, Heldenverehrung, Stadtguerilla, marxistisch-leninistische Ideologie.
Häufig gestellte Fragen zum Werk "Gerhard Richter: 18. Oktober 1977"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gerhard Richters Bilderzyklus "18. Oktober 1977" und widerlegt die These, dass Richter die RAF verherrlicht. Stattdessen interpretiert sie den Zyklus als umfassende Kritik an ideologischen und totalitären Denkmustern. Die Analyse vergleicht Richters Werk mit anderen künstlerischen Auseinandersetzungen mit der RAF-Thematik.
Welche Themen werden im Bilderzyklus "18. Oktober 1977" behandelt?
Der Zyklus thematisiert die RAF, ihre Ideologie und die damit verbundene Gewalt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interpretation des Zyklus als Kritik an ideologischen und totalitären Denkmustern, nicht als Heldenverehrung der RAF.
Wie wird die These der Heldenverehrung der RAF widerlegt?
Die Widerlegung erfolgt durch eine detaillierte Analyse ausgewählter Bilder des Zyklus, die Berücksichtigung ausgelassener Motive, den Vergleich mit früheren Werken Richters, die eine kritische Auseinandersetzung mit ideologischen Mustern zeigen, und den Vergleich mit dem Umgang anderer Künstler mit der RAF-Thematik.
Welche Rolle spielen die ausgelassenen Motive im Bilderzyklus?
Die Auslassung bestimmter Motive wird als wichtiger Aspekt der Gesamtdeutung analysiert und in den Kontext der ideologischen Kritik eingeordnet. Die Arbeit untersucht, welche Bedeutung die bewusste Weglassung von Bildmotiven für das Verständnis des Werkes hat.
Wie werden frühere Werke Richters in die Analyse einbezogen?
Frühere Arbeiten Richters, wie "Volker Bradke" und "Mao", werden herangezogen, um seine langjährige kritische Auseinandersetzung mit ideologischen Denkmustern zu belegen und die Konsistenz seiner künstlerischen Haltung zu zeigen.
Welche anderen Künstler werden zum Vergleich herangezogen?
Die Arbeit vergleicht Richters Werk mit dem Umgang von Sigmar Polke ("Ohne Titel (Dr. Bonn)" und "Sicherheitsverwahrung") und Odd Nerdrum ("Der Mord an Andreas Baader") mit der RAF-Thematik, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die RAF, eine Analyse des Bilderzyklus "18. Oktober 1977", ein Kapitel zur Ideologiekritik in früheren Werken Richters, einen Vergleich mit anderen Künstlern und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gerhard Richter, 18. Oktober 1977, RAF, Rote Armee Fraktion, Bilderzyklus, Ideologiekritik, Totalitarismus, Kunst und Politik, deutsche Nachkriegsgeschichte, Heldenverehrung, Stadtguerilla, marxistisch-leninistische Ideologie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine neue Interpretation von Richters Bilderzyklus "18. Oktober 1977" zu liefern, indem sie die These der Heldenverehrung widerlegt und den Zyklus als eine umfassende Kritik an ideologischen und totalitären Denkmustern darstellt.
Wo finde ich weitere Informationen zur RAF?
Das zweite Kapitel der Arbeit bietet einen Überblick über die RAF, ihr ideologisches Umfeld und ihre Taten, ohne einen umfassenden historischen Ablauf zu bieten. Für detailliertere Informationen wird auf weitere historische Literatur verwiesen (nicht in diesem Dokument enthalten).
- Quote paper
- Florian Bührer (Author), 2012, Gerhard Richters Bilderzyklus "18. Oktober 1977". Heldenverehrung oder Ideologiekritik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319083