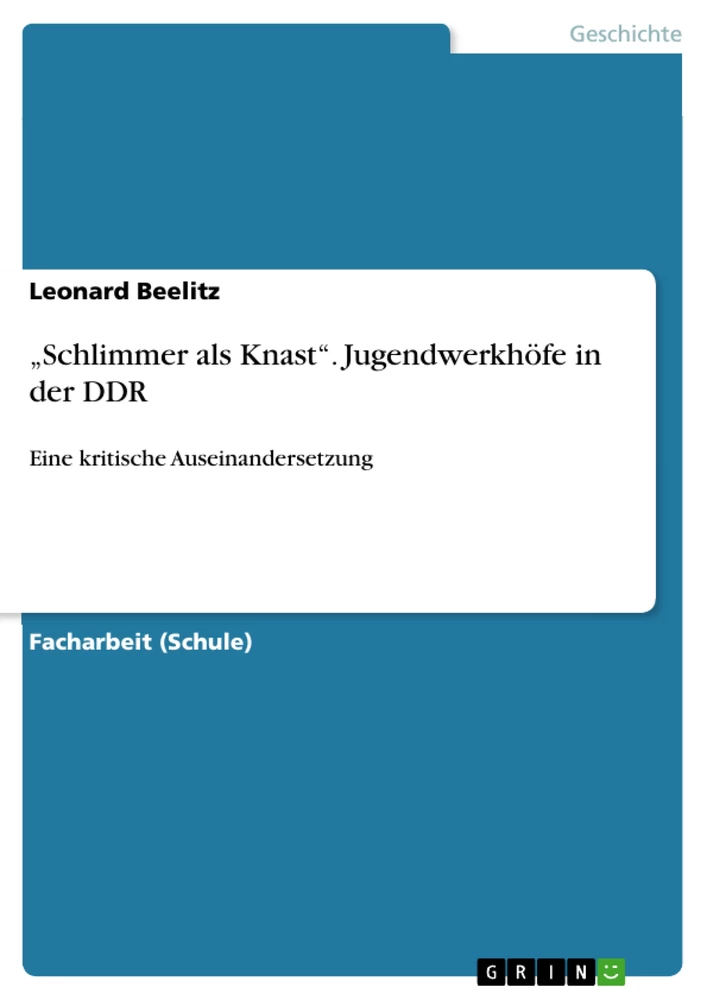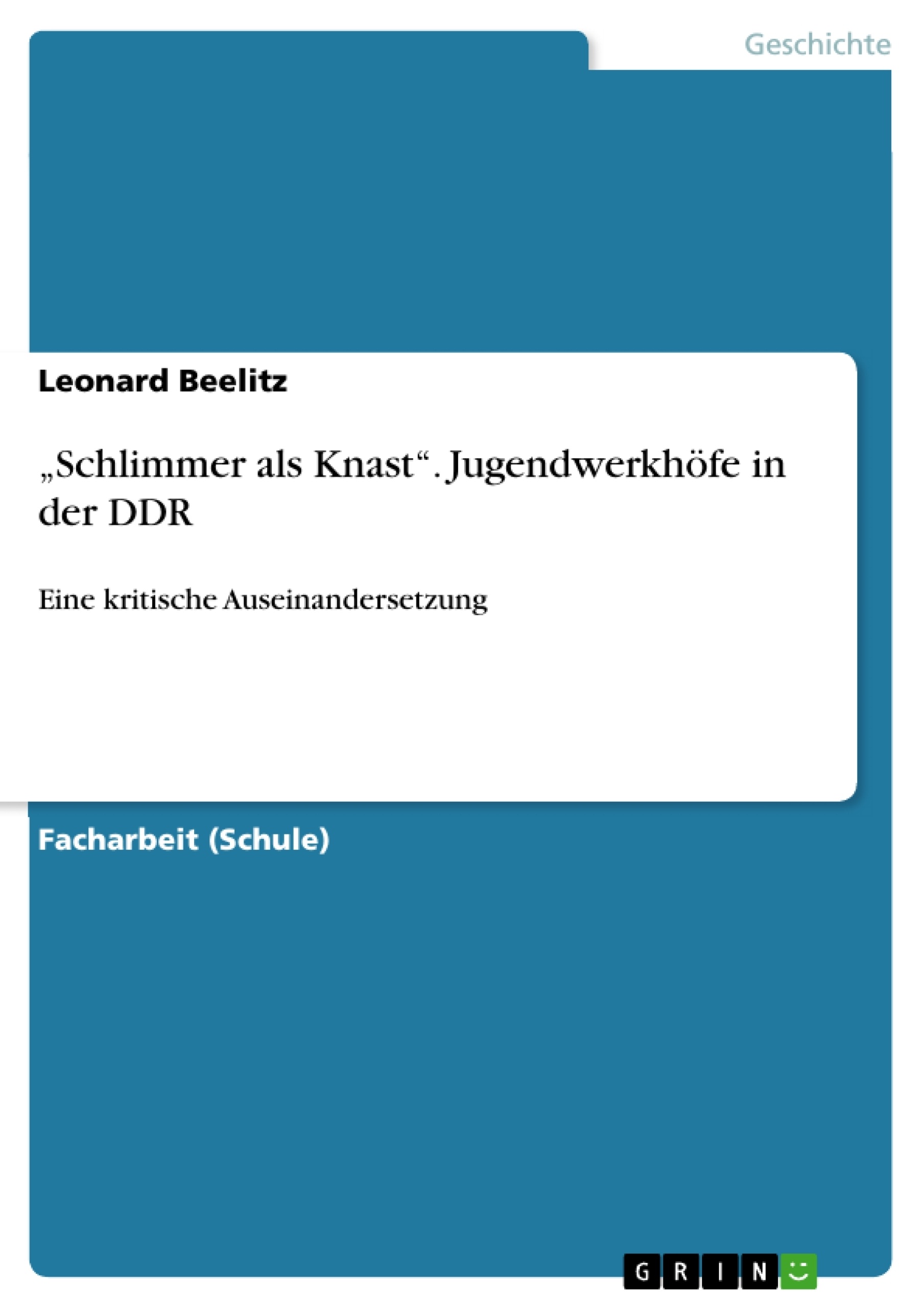Diese Facharbeit befasst sich mit dem Thema Jugendwerkhöfe in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Noch heute leiden Betroffene an den Spätfolgen ihres Aufenthaltes in einem Jugendwerkhof. Dennoch gibt es Befürworter für die Grundprinzipien eines Jugendwerkhofes. Viele Machenschaften der Staatssicherheit und des Staates der ehemaligen DDR sind inzwischen hinreichend bekannt, dieses Thema jedoch leider heute nur noch sehr wenigen, weshalb ich mich näher damit befasst habe. Bei der Erstellung meiner Facharbeit sind auch Schwierigkeiten aufgetreten.
Trotz des recht umfangreichen Angebots an wissenschaftlichem Material, Umfragen und Literatur hätte ich beispielsweise gern selbst Betroffene dazu befragt, um persönliche und individuelle Sichtweisen, Erlebnisse und Geschichten von ehemaligen Insassen von Jugendwerkhöfen nicht nur aus Büchern zu erfahren, sondern ein „Stück Geschichte“ auch persönlich zu erleben. Es war mir jedoch nicht möglich, trotz intensiver Bemühungen, solche ausfindig zu machen. Warum die Betroffenen schweigen, darauf werde ich in dieser Arbeit noch eingehen. Das Ziel dieser Facharbeit besteht darin, die Thematik "Jugendwerkhöfe in der DDR" möglichst objektiv zu beleuchten.
Dabei sollen sowohl Argumente gegen als auch für Jugendwerkhöfe aufgezeigt und kritisch hinterfragt werden. Zu Beginn dieser Arbeit werde ich eine ausführliche Definition der Jugendwerkhöfe formulieren und auch auf deren geschichtliche Entwicklung eingehen. Weiterhin sollen Prinzipien und Zielenäher erläutert und der Alltag in einem Jugendwerkhof beschrieben werden. In einem abschließenden Fazit werden die Auswirkungen solcher Anstalten dargestellt. Hier wird auch zusammenfassend eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Die Jugendwerkhöfe in der DDR - eine Definition
- 2. Geschichte der Jugendwerkhöfe
- 3. Die Einweisung in einen Jugendwerkhof der DDR
- 4. Prinzipien und Ziele der Erziehung in Jugendwerkhöfen
- 5. Der Alltag im Jugendwerkhof
- 6. Der geschlossene Jugendwerkhof
- 7. Pro und Kontra von Jugendwerkhöfen
- 8. Auswirkungen der Jugendwerkhöfe - Ein kritisches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Jugendwerkhöfe der DDR, ihre Geschichte, Funktionsweise und Auswirkungen auf die Betroffenen. Das Ziel ist eine objektive Betrachtung, die sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchtet und kritisch hinterfragt.
- Definition und geschichtliche Entwicklung der Jugendwerkhöfe in der DDR
- Einweisungskriterien und -verfahren
- Erziehungsmethoden und der Alltag in den Einrichtungen
- Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau und seine Besonderheiten
- Langzeitfolgen und kritische Bewertung des Systems
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Jugendwerkhöfe in der DDR - eine Definition: Dieses Kapitel definiert Jugendwerkhöfe der DDR als Einrichtungen zur Umerziehung sogenannter „schwererziehbarer Jugendlicher“ durch produktive Arbeit. Es betont den Unterschied zu Strafvollzugsanstalten, obwohl die Realität oft Demütigungen, Schikanen und Gewalt beinhaltete. Die rechtliche Grundlage und die politischen Ziele der Erziehung werden erläutert, wobei die mangelnde Klarheit der Aufgaben bis zur „Anordnung über die Spezialheime der Jugendhilfe“ hervorgehoben wird. Das Kapitel unterstreicht die politisch geprägte Erziehung und die langfristigen negativen Folgen für die Betroffenen.
2. Geschichte der Jugendwerkhöfe: Die Entstehung der Jugendwerkhöfe nach dem Zweiten Weltkrieg wird beschrieben, ausgehend von der Notwendigkeit, heimatlose und straffällige Jugendliche zu betreuen. Das Kapitel verfolgt die Entwicklung von relativ guten handwerklichen Ausbildungsmöglichkeiten hin zu Arbeitslagern mit harter körperlicher Arbeit, angetrieben durch die Anforderungen der Industrie. Die Etablierung des geschlossenen Jugendwerkhofs in Torgau und die unterschiedlichen Typen von Jugendwerkhöfen mit abgestuften Aufenthaltsdauern und Ausbildungsniveaus werden dargestellt. Die Entwicklung hin zu Pilotprojekten mit dem Ziel einer Abkehr von rigiden Strafmethoden in den 1980er Jahren und die Auflösung bzw. Umwandlung der Einrichtungen nach 1990 bilden den Abschluss.
Schlüsselwörter
Jugendwerkhöfe, DDR, Umerziehung, „schwererziehbare Jugendliche“, Torgau, geschlossener Jugendwerkhof, produktive Arbeit, politische Erziehung, Spätfolgen, Arbeitslager, sozialistische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Jugendwerkhöfe in der DDR
Was ist das Thema der Facharbeit?
Die Facharbeit befasst sich umfassend mit den Jugendwerkhöfen in der DDR. Sie untersucht deren Geschichte, Funktionsweise, Einweisungskriterien, Erziehungsmethoden, den Alltag in den Einrichtungen, die Besonderheiten des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau und die langfristigen Folgen für die Betroffenen. Die Arbeit zielt auf eine objektive Betrachtung, die sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchtet und kritisch hinterfragt.
Was wird im Inhaltsverzeichnis der Facharbeit behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Vorwort, Definition der Jugendwerkhöfe, Geschichte der Jugendwerkhöfe, Einweisung in Jugendwerkhöfe, Erziehungsziele und -prinzipien, Alltag in den Jugendwerkhöfen, der geschlossene Jugendwerkhof, Pro und Kontra von Jugendwerkhöfen und ein kritisches Fazit zu den Auswirkungen der Jugendwerkhöfe.
Welche Zielsetzung verfolgt die Facharbeit?
Die Facharbeit möchte die Jugendwerkhöfe der DDR objektiv betrachten und sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchten. Sie analysiert die Geschichte, Funktionsweise und Auswirkungen dieser Einrichtungen auf die betroffenen Jugendlichen. Die kritische Hinterfragung des Systems steht im Mittelpunkt.
Wie definiert die Facharbeit Jugendwerkhöfe der DDR?
Die Facharbeit definiert Jugendwerkhöfe der DDR als Einrichtungen zur Umerziehung sogenannter „schwererziehbarer Jugendlicher“ durch produktive Arbeit. Es wird betont, dass es sich, trotz des Unterschieds zu Strafvollzugsanstalten, in der Realität oft um Demütigungen, Schikanen und Gewalt handelte. Die rechtliche Grundlage und die politischen Ziele der Erziehung werden erläutert, wobei die mangelnde Klarheit der Aufgaben hervorgehoben wird.
Was beschreibt die Facharbeit zur Geschichte der Jugendwerkhöfe?
Die Facharbeit beschreibt die Entstehung der Jugendwerkhöfe nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnend mit der Betreuung heimatloser und straffälliger Jugendlicher. Sie verfolgt die Entwicklung von relativ guten handwerklichen Ausbildungsmöglichkeiten hin zu Arbeitslagern mit harter körperlicher Arbeit. Die Etablierung des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau und die verschiedenen Typen von Jugendwerkhöfen werden dargestellt. Die Entwicklung hin zu Pilotprojekten mit dem Ziel einer Abkehr von rigiden Strafmethoden in den 1980er Jahren und die Auflösung bzw. Umwandlung der Einrichtungen nach 1990 bilden den Abschluss.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Facharbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendwerkhöfe, DDR, Umerziehung, „schwererziehbare Jugendliche“, Torgau, geschlossener Jugendwerkhof, produktive Arbeit, politische Erziehung, Spätfolgen, Arbeitslager, sozialistische Gesellschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit behandelt die Definition und geschichtliche Entwicklung der Jugendwerkhöfe, Einweisungskriterien und -verfahren, Erziehungsmethoden und den Alltag in den Einrichtungen, den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau und seine Besonderheiten sowie die Langzeitfolgen und eine kritische Bewertung des Systems.
- Citation du texte
- Leonard Beelitz (Auteur), 2016, „Schlimmer als Knast“. Jugendwerkhöfe in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318053