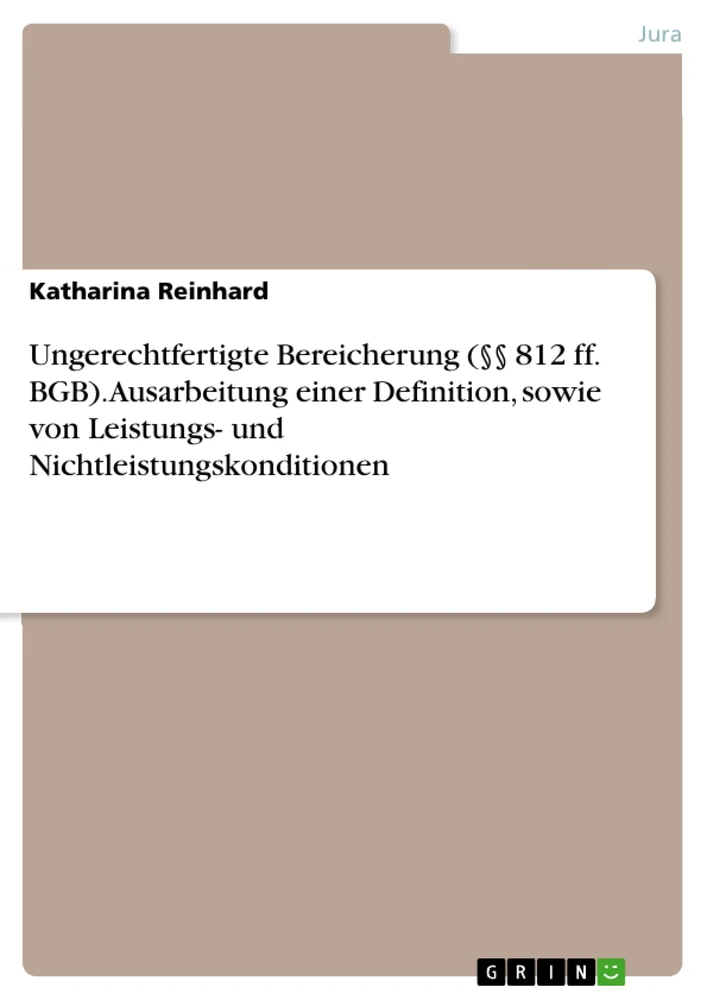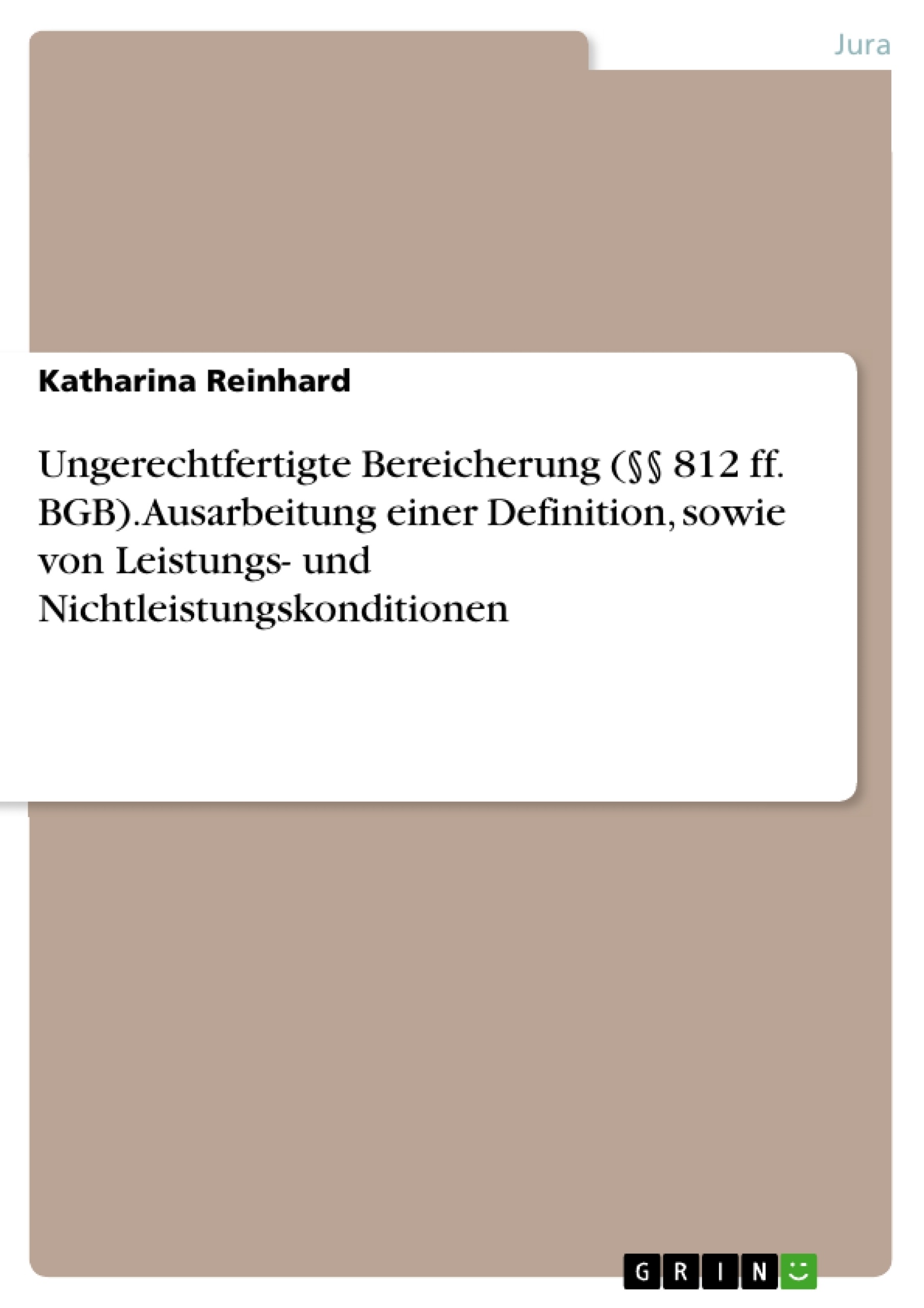Die Literatur zum Bereicherungsrecht ist sehr umfassend und enthält Unmengen an Gerichtsurteilen, Autorenmeinungen und Lehrbüchern. All diese Gedankengänge aufzugreifen ist nahezu unmöglich, weshalb in dieser Hausarbeit lediglich die Grundprinzipien des Bereicherungsrechts beschrieben werden. Demnach wird sich auf den folgenden Seiten mit den zentralen Leitfragen befasst, wann, wieso und wie die Rückübereignung eines Gegenstandes oder einer Leistung, dessen Verschiebung rechtsgrundlos ist, erreicht werden kann. Die Antworten auf diese Leitfrage sind gesetzlich geregelt und sichern so eine gerechte Vermögensverteilung, wie sie jedem gutgläubigen Bürger zusteht. Nach dem Lesen dieser Ausarbeitung zur ungerechtfertigten Bereicherung sollte also ein jeder sein Recht auf die Herausgabe der von ihm geleisteten Sache im Falle einer rechtsgrundlosen Vermögensverschiebung erkennen, verstehen und begründen können.
Die Antwort auf die Frage, wann eine Bereicherung ungerechtfertigt ist, ist in dem ersten Kapitel dieser Hausarbeit zu finden. Dort folgen auf die allgemeine Definition des BGB die drei Hauptmerkmale der rechtsgrundlosen Vermögensverschiebung.
Wieso es die ungerechtfertigte Bereicherung geben muss, klärt sich historisch im zweiten Kapitel. Dort wird kurz auf die ursprüngliche Verwendung der ungerechtfertigten Bereicherung, wie wir sie heute kennen, eingegangen. In dem Kapitel "Das Abstraktionsprinzip" werden die Bestandteile eines Rechtsgeschäfts und deren Bedeutung für das Bereicherungsrecht erklärt. Hier ist der wichtigste Grund zu finden, warum es ein Gesetz zur Rückübereignung von Gegenständen und Leistungen geben muss.
Das vierte Kapitel nennt Gründe, wie es zu einer ungerechtfertigten Bereicherung durch unterschiedliche Leistungen kommt. In den darauf folgenden Kapiteln werden die verschiedenen Klagearten, die auf eine ungerechtfertigten Bereicherung folgen, erläutert. Zum besseren Verständnis und der Anschaulichkeit folgt auf jede Bereicherungsart, die auch Kondiktion genannt wird, ein Beispiel.
Im Kapitel "Herausgabepflicht des Schuldners" werden die unterschiedlichen Inhalte des Bereicherungsanspruches erläutert. Im letzten Kapitel wird auf die daraus resultierende Bereicherungshaftung eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Definition
- Etwas erlangt
- Durch die Leistung eines anderen
- Ohne rechtlichen Grund
- Ursprung
- Das Abstraktionsprinzip
- Leistung und Nichtleistung
- Die Leistung
- Solvendi causa
- Donandi causa
- Bereicherung in sonstiger Weise
- Die Leistung
- Leistungskondiktionen
- Condictio indebiti
- Condictio ob causam finitam
- Condictio ob rem
- Nichtleistungskondiktionen
- Condictio ob turpem vel iniustam causam
- Ausschluss der Leistungskondiktionen
- Eingriffskondiktion
- Verwendungskondiktion
- Rückgriffskondiktion
- Herausgabepflicht des Schuldners
- Nutzungsherausgabe oder Wertersatz nach § 818 Abs. 1 u. 2
- Der Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3
- Die Saldotheorie nach § 818 Abs. 3
- Die einfache Haftung
- Die verschärfte Haftung
- Verjährung der Bereicherungsanspruchs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der ungerechtfertigten Bereicherung im deutschen BGB. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen dieser Rechtsfigur zu erläutern und die Voraussetzungen für die Geltendmachung eines Bereicherungsanspruchs zu erklären. Insbesondere werden die verschiedenen Formen der ungerechtfertigten Bereicherung sowie die unterschiedlichen Arten von Herausgabeansprüchen und Haftungsformen beleuchtet.
- Die rechtlichen Grundlagen der ungerechtfertigten Bereicherung
- Die Voraussetzungen für die Geltendmachung eines Bereicherungsanspruchs
- Die verschiedenen Formen der ungerechtfertigten Bereicherung
- Die unterschiedlichen Arten von Herausgabeansprüchen
- Die unterschiedlichen Haftungsformen bei ungerechtfertigter Bereicherung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Definition der ungerechtfertigten Bereicherung und erläutert die drei Hauptmerkmale: Etwas erlangt, durch die Leistung eines anderen, ohne rechtlichen Grund. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem historischen Ursprung der ungerechtfertigten Bereicherung. Im dritten Kapitel wird das Abstraktionsprinzip im Bereicherungsrecht erklärt, und das vierte Kapitel untersucht die unterschiedlichen Arten von Leistungen, die zu einer ungerechtfertigten Bereicherung führen können.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit verschiedenen Arten von Leistungskondiktionen, wie der Condictio indebiti, der Condictio ob causam finitam und der Condictio ob rem. Es werden Beispiele gegeben, um das Verständnis zu erleichtern. Ebenso werden die verschiedenen Arten von Nichtleistungskondiktionen erläutert, darunter die Condictio ob turpem vel iniustam causam, die Eingriffskondiktion, die Verwendungskondiktion und die Rückgriffskondiktion.
Das Kapitel über die Herausgabepflicht des Schuldners erklärt verschiedene Inhalte des Bereicherungsanspruchs, darunter die Nutzungsherausgabe, den Wertersatz und den Wegfall der Bereicherung. Schließlich werden die einfache und die verschärfte Haftung bei ungerechtfertigter Bereicherung besprochen, sowie die Verjährung des Bereicherungsanspruchs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: ungerechtfertigte Bereicherung, Bereicherungsrecht, BGB, §§ 812 ff., Leistungskondiktion, Nichtleistungskondiktion, Herausgabepflicht, Haftung, Verjährung.
- Citar trabajo
- Katharina Reinhard (Autor), 2014, Ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB). Ausarbeitung einer Definition, sowie von Leistungs- und Nichtleistungskonditionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317843