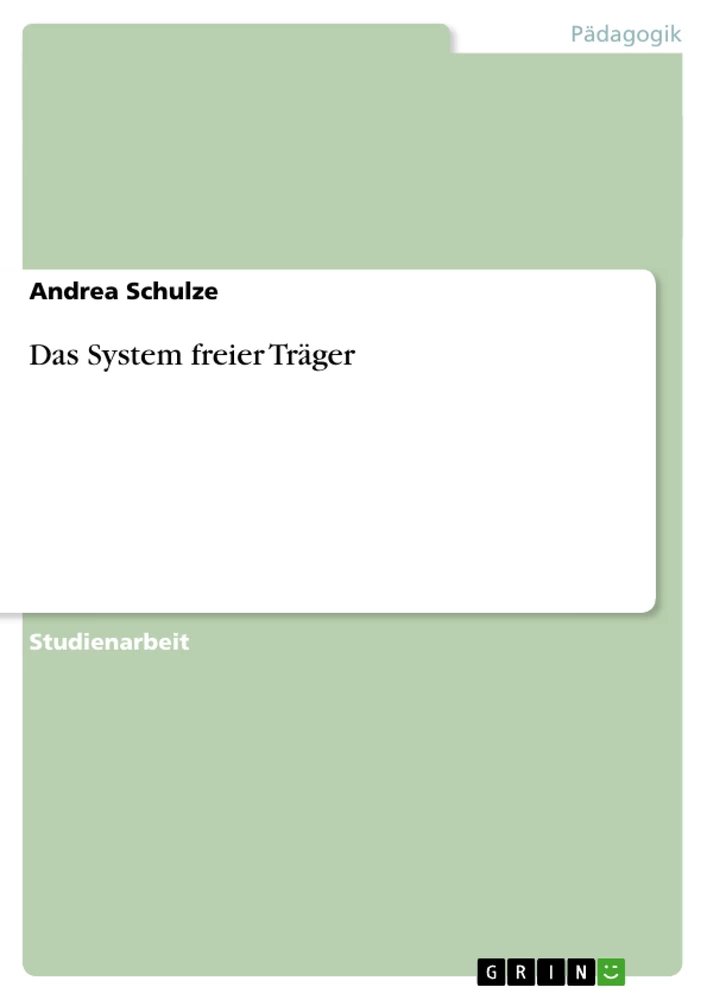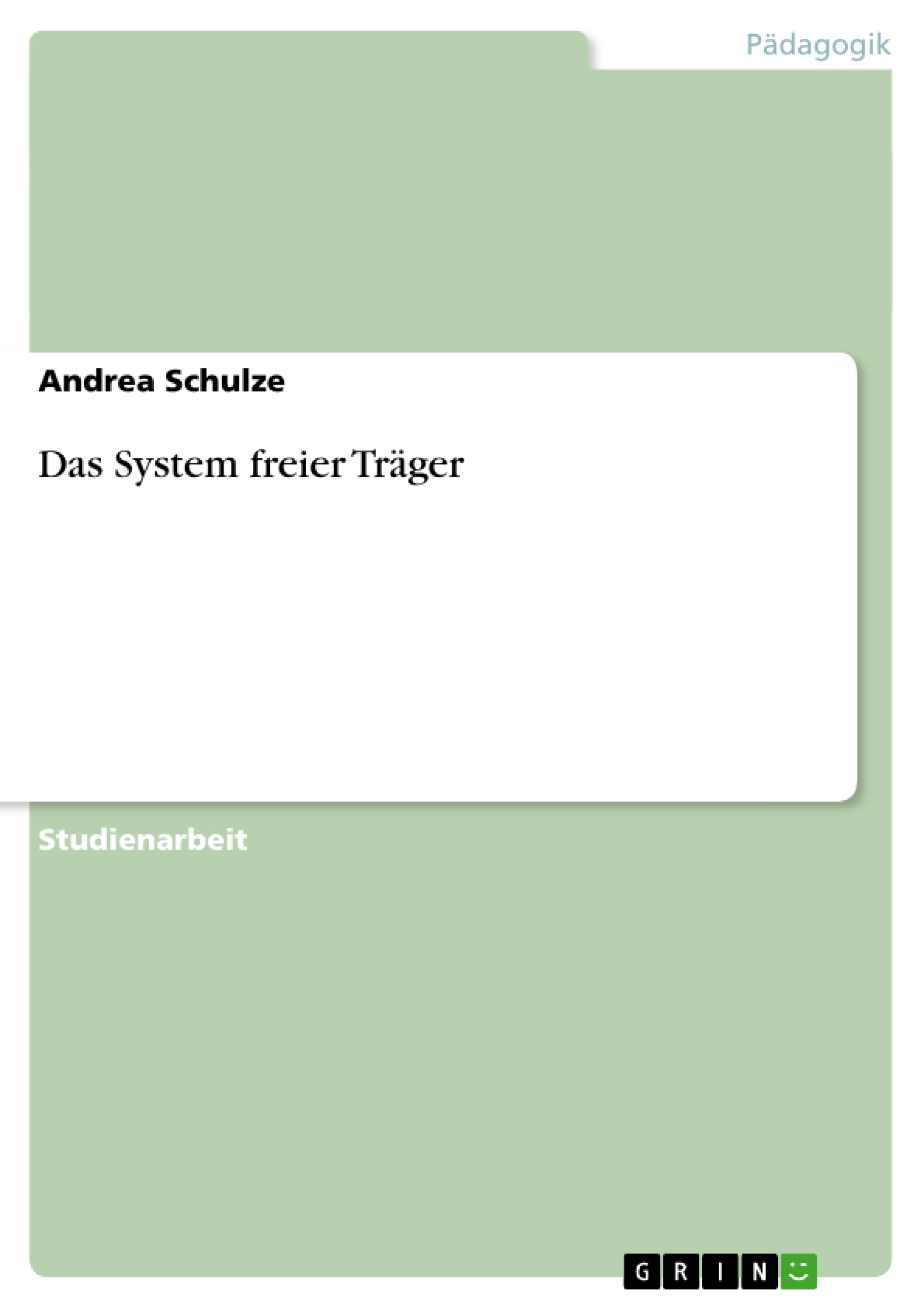In dieser Arbeit soll der Text: „Das System öffentlicher und freier Träger sowie gewerblicher Anbieter sozialer (Dienst-) Leistungen“ nach Harald Hottellet behandelt werden. Insbesondere der Teil, in dem es um die Freien Träger geht. Einführend wird ein kleiner Überblick über alle Träger der Jugendhilfe gegeben. In dem zu klären ist, wie sie sich definieren und welchen Grundsätzen, Rechten und Pflichten sie unterliegen. Anschließend soll diese Arbeit spezifisch auf die Freien Träger und ihre Prinzipien eingehen. Schwerpunktmäßig werden aber nur die größten Wohlfahrtsverbände mit ihren Aufgaben angesprochen. Allgemein werden Träger in der sozialen Arbeit als Organisationen dargestellt, die gemäß dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) auch und hauptsächlich die Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen. Nach der Trägerschaft wird unterschieden nach öffentlichen und freien Trägern. Öffentliche Träger sind auf regionaler Ebene die örtlichen Träger; das sind Kreise, kreisfreie Städte und zum Teil auch kreisangehörige Gemeinden, sofern sie ein eigenes Jugendamt besitzen. Sie erbringen ihre Leistungen durch die Jugendämter, während auf überregionaler Ebene die überörtlichen Träger in Form von Bundesländern ihre Leistungen durch die Landesjugendämter erbringen. Das bayerische Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) beschäftigt sich ausführlich mit den Trägern der Jugendhilfe. Die öffentlichen Träger sind dazu verpflichtet, die Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII zu erbringen. Dagegen handeln freie Träger eher situationsbedingt und aus einem Mangel an sozialen Dienstleistungen heraus. Ihre Prinzipien beruhen auf Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit. Zu den freien Trägern der Jugendhilfe zählen die sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die sich zu einer Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zusammengeschlossenen haben (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland). Neben diesen Hauptorganisationen existieren noch eine Reihe von trägerübergreifenden Organisationen und Alternativprojekten. Beispiele dafür sind Kirchen und die Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, Jugendverbände, Selbsthilfe- beziehungsweise selbstorganisierte Gruppen und juristische Personen, deren Zweck es ist, die Jugendhilfe zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Freie Träger in ihrer Definition
- Freie Träger im Überblick
- Die Spitzenverbände
- Die Arbeiterwohlfahrt
- Die Caritas Deutschland
- Die Paritätische Wohlfahrtsorganisation
- Das Deutsche Rote Kreuz
- Das Diakonische Werk
- Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
- Weitere Wohlfahrtsorganisationen
- Dachverbände der Jugendhilfe
- Trägerübergreifende Organisationen
- Selbsthilfegruppen und Alternativprojekte
- Gewerbliche Anbieter
- Fazit
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem System öffentlicher und freier Träger sowie gewerblicher Anbieter sozialer Dienstleistungen, insbesondere im Kontext der Jugendhilfe. Die Zielsetzung ist es, einen Überblick über die verschiedenen Träger zu geben, ihre Definitionen zu klären und die Prinzipien der freien Träger, vor allem der großen Wohlfahrtsverbände, zu beleuchten.
- Definition und Charakteristika freier Träger
- Die Rolle der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege
- Der Einfluss des Rechtsrahmens auf die Trägerlandschaft
- Die Entwicklung und Herausforderungen im Kontext gewerblicher Anbieter
- Zusammenspiel öffentlicher und freier Träger
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Dieses Vorwort beschreibt kurz den Inhalt der Arbeit, der sich auf den Text „Das System öffentlicher und freier Träger sowie gewerblicher Anbieter sozialer (Dienst-) Leistungen“ von Harald Hottelet konzentriert, insbesondere auf die Abschnitte über freie Träger. Es kündigt einen einführenden Überblick über Träger der Jugendhilfe an, gefolgt von einer detaillierteren Betrachtung freier Träger und ihrer Prinzipien, wobei der Schwerpunkt auf den größten Wohlfahrtsverbänden liegt.
Einleitung: Die Einleitung definiert Träger sozialer Arbeit gemäß SGB VIII und unterscheidet zwischen öffentlichen und freien Trägern. Öffentliche Träger werden auf regionaler (örtliche Träger) und überregionaler Ebene (überörtliche Träger) beschrieben. Das bayerische KJHG wird zitiert, um die Vielfalt der Träger und ihre unterschiedlichen Aufgaben zu betonen. Die Einleitung hebt den Unterschied in den Leistungsverpflichtungen zwischen öffentlichen und freien Trägern hervor, wobei letztere auf Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit basieren. Die sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege werden genannt, sowie weitere Organisationen und Alternativprojekte.
Freie Träger in ihrer Definition: Dieses Kapitel definiert freie Träger als selbstgewählte Zusammenschlüsse von Bürgern, die Aufgaben im sozialen Bereich übernehmen, welche von öffentlichen Trägern nicht gedeckt werden. Es erläutert die rechtliche Grundlage im Vereinsrecht und die Anforderungen an Gemeinnützigkeit, einschließlich der Anerkennung durch die Finanzbehörde und die damit verbundenen Möglichkeiten der Spendenwerbung. Die zunehmende Bedeutung gewerblicher Anbieter und die daraus resultierende Zweiteilung der freien Trägerschaften werden angesprochen, sowie die offenen Fragen zum Verbandsbegriff im BSHG und die Bedeutung von Qualität statt Trägerprofil im Kontext des Pflegeversicherungsgesetzes.
Schlüsselwörter
Freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Jugendhilfe, SGB VIII, Gemeinnützigkeit, öffentliche Träger, gewerbliche Anbieter, Spitzenverbände, Vereinsrecht, Qualitätssicherung.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Das System öffentlicher und freier Träger sowie gewerblicher Anbieter sozialer (Dienst-) Leistungen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das System öffentlicher und freier Träger sowie gewerblicher Anbieter sozialer Dienstleistungen, insbesondere im Kontext der Jugendhilfe. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserklärung, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf freien Trägern, insbesondere den großen Wohlfahrtsverbänden.
Welche Träger sozialer Dienstleistungen werden behandelt?
Der Text behandelt öffentliche Träger (örtliche und überörtliche), freie Träger (inkl. der sechs großen Wohlfahrtsverbände: Arbeiterwohlfahrt, Caritas Deutschland, Paritätische Wohlfahrtsorganisation, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland), weitere Wohlfahrtsorganisationen, Dachverbände der Jugendhilfe, trägerübergreifende Organisationen, Selbsthilfegruppen, Alternativprojekte und gewerbliche Anbieter.
Wie werden freie Träger definiert?
Freie Träger werden als selbstgewählte Zusammenschlüsse von Bürgern definiert, die Aufgaben im sozialen Bereich übernehmen, welche von öffentlichen Trägern nicht gedeckt werden. Ihre rechtliche Grundlage liegt im Vereinsrecht, und sie zeichnen sich durch Gemeinnützigkeit aus, die durch Anerkennung der Finanzbehörde bestätigt wird. Der Text thematisiert auch die wachsende Bedeutung gewerblicher Anbieter und die damit verbundene Veränderung der freien Trägerschaft.
Welche Rolle spielen die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege?
Die sechs großen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (siehe Frage 2) spielen eine zentrale Rolle. Der Text beleuchtet ihre Prinzipien und ihren Einfluss auf die Trägerlandschaft. Ihre Bedeutung im Kontext des Rechtsrahmens und der Herausforderungen durch gewerbliche Anbieter wird ebenfalls erörtert.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Zielsetzung ist es, einen Überblick über die verschiedenen Träger sozialer Dienstleistungen zu geben, ihre Definitionen zu klären und die Prinzipien der freien Träger, vor allem der großen Wohlfahrtsverbände, zu beleuchten. Der Text analysiert das Zusammenspiel von öffentlichen und freien Trägern und betrachtet den Einfluss des Rechtsrahmens auf die Trägerlandschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Jugendhilfe, SGB VIII, Gemeinnützigkeit, öffentliche Träger, gewerbliche Anbieter, Spitzenverbände, Vereinsrecht, Qualitätssicherung.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel zu einem Vorwort, einer Einleitung, einer Definition freier Träger, einem Überblick über freie Träger, den Spitzenverbänden, weiteren Wohlfahrtsorganisationen, Dachverbänden der Jugendhilfe, trägerübergreifenden Organisationen, Selbsthilfegruppen und Alternativprojekten, gewerblichen Anbietern, einem Fazit und einem Schlusswort.
Wie wird der Unterschied zwischen öffentlichen und freien Trägern dargestellt?
Der Text hebt den Unterschied in den Leistungsverpflichtungen hervor: Öffentliche Träger haben eine gesetzliche Verpflichtung, während freie Träger auf Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit basieren. Öffentliche Träger werden auf regionaler (örtliche Träger) und überregionaler Ebene (überörtliche Träger) beschrieben. Das bayerische KJHG wird als Beispiel für die Vielfalt der Aufgaben und Träger genannt.
- Quote paper
- Andrea Schulze (Author), 2004, Das System freier Träger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31766