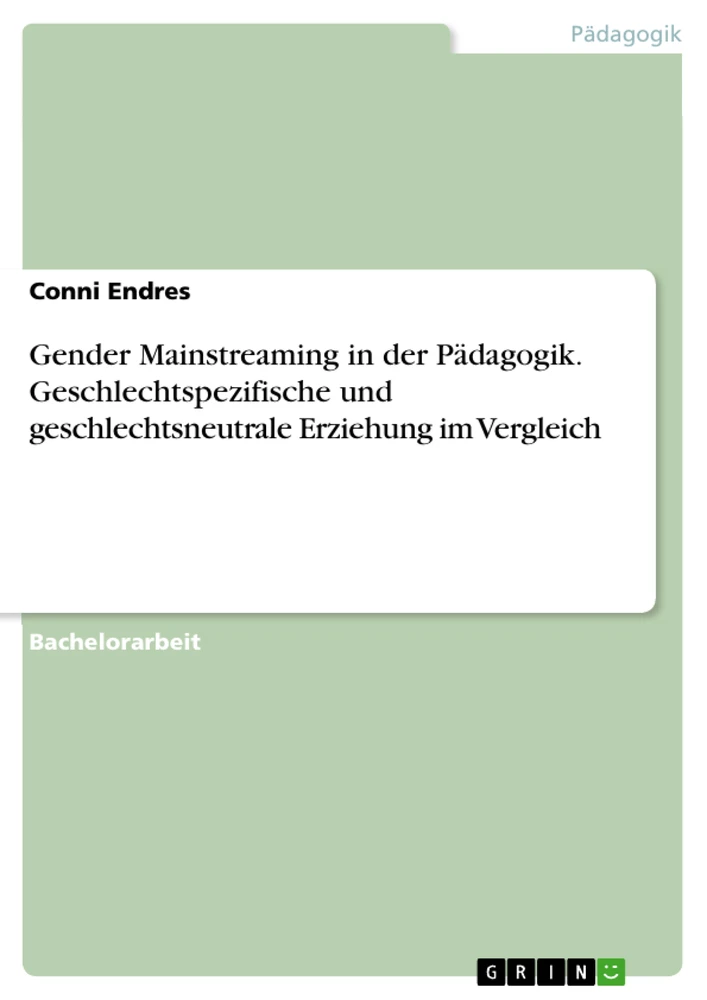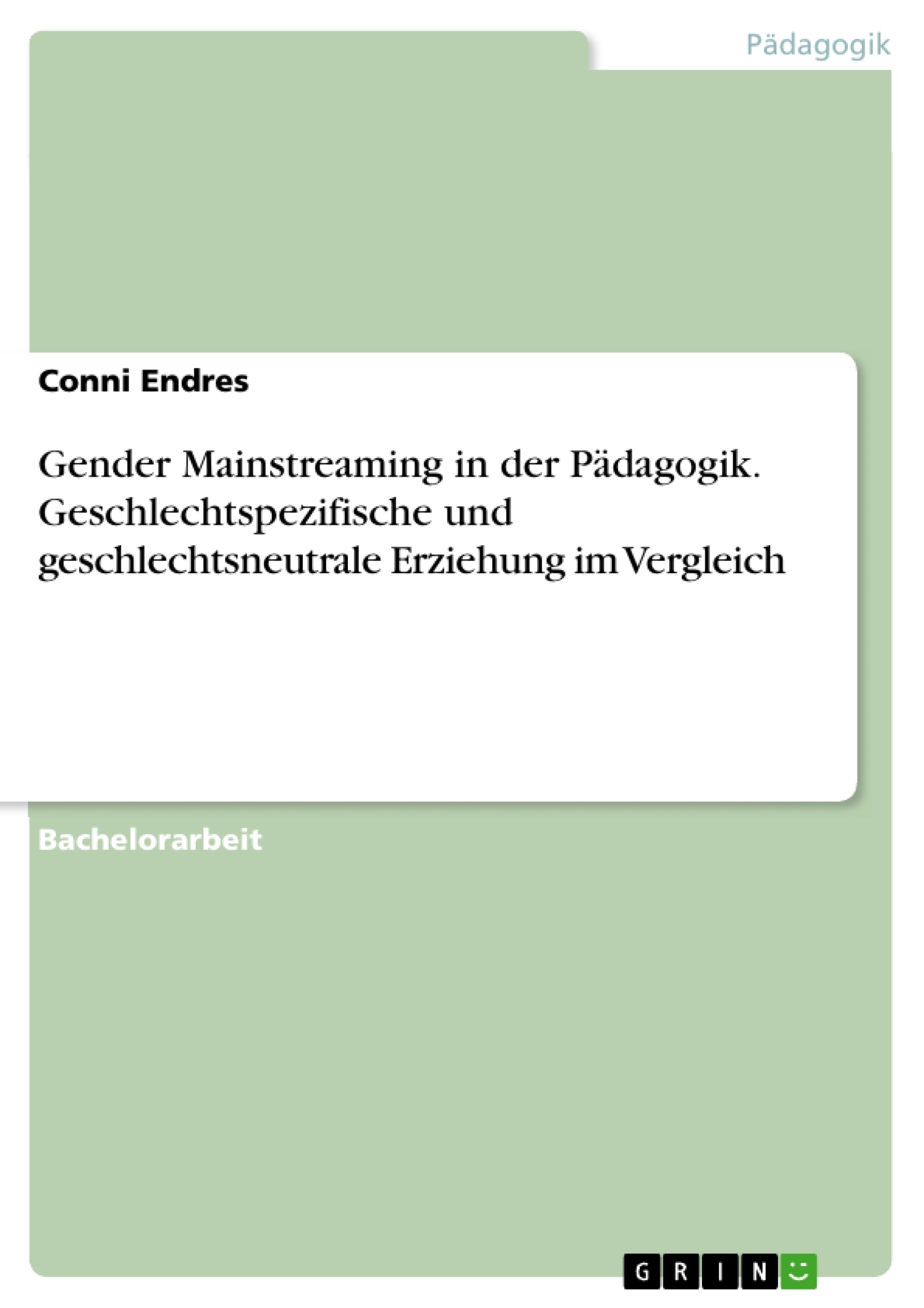Das bipolare Geschlechtersystem ist so alltäglich, dass wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen: Wenn ein Kind geboren wird, lautet die erste Frage, ob es ein Mädchen oder Junge ist. Und so verbinden wir gleichzeitig mit dem Geschlecht bestimmte Eigenschaften, ganz automatisch. Frauen sind eher einfühlsam, „mütterlich“ und gesprächiger, das „schöne Geschlecht“, künstlerisch begabter, dafür nicht so gut in naturwissenschaftlichen Angelegenheiten und beim Einparken; Männer dagegen sind das „starke Geschlecht“, haben einen besseren Orientierungssinn, sind geradliniger, nicht so launisch, dafür manchmal grobmotorisch, vielleicht nicht so empathisch. So hat es also als Mädchen geboren zu werden Konsequenzen, welche, die über die chromosomalen und biologischen Unterschiede weit hinausgehen.
Fast jedes menschliche Verhalten und Erleben hat eine Art geschlechtliche Färbung. Durch die Einführung des Wortes gender, das den Begriff sex ablöst, sollen allerdings genau diese Paradigmen der Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgehoben werden: Frauen sollen im Berufsleben endlich den Männern gleichgestellt und somit die gender-pay-gap aufgehoben werden. Homosexuelle Paare sollen die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare bekommen, auch die Sprache soll angeglichen werden, so soll zum Beispiel „Vater“ und „Mutter“ durch „Elter“ ersetzt werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit wir es bei den traditionellen Denkweisen über Mann und Frau tatsächlich mit obsolet gewordenen Stereotypen zu tun haben, oder ob sie doch noch essentielle Bedeutung für die Kultur haben und daher zum Erhalt einer „gesunden Kultur“ nicht ganz aufgegeben werden sollten.
Hinsichtlich der Tendenz zu einer geschlechtslosen Pädagogik, wird in der vorliegenden Arbeit erarbeitet, ob es für die Jugendlichen fördernder und persönlichkeitsstärkender ist, sie bezüglich ihres Geschlechtes oder ihrer Geschlechtslosigkeit zu bestärken.
Im Folgenden soll zunächst die Entstehung der Gender Theorie und auf welche Weise diese den Weg in die Politik gefunden hat, erläutert werden. Es soll die Frage geklärt werden, was Gender Mainstreaming erreichen will. Über den historischen Rückblick zu dem bürgerlichen Familienideal soll erklärt werden, von welchem Geschlechterbild die Gender Theorie wegführen will.
Inhaltsverzeichnis
- A. Die Präsenz des Geschlechtes in unserer Gesellschaft
- B. Erziehung zur Geschlechtslosigkeit?
- 2.1 Die Entstehung der Gender Theorie
- 2.1.1 Drei Feministinnen als Vordenkerinnen des Gender Begriffes
- 2.1.2 Begriffsdefinitionen
- 2.1.3 Gender Mainstreaming in der Politik
- 2.1.4 Die Zielsetzung der Gender Theorie
- 2.1.5 Kritik an der feministischen Entwicklung
- 2.2 Exkurs: Geschichte der Geschlechterrollen
- 2.2.1 Vom bürgerlichen Familienideal zur modernen Sicht von Geschlechterrollen
- 2.2.2 Wovon will die Gender Theorie weg?
- 2.3 Gender Mainstreaming in der Erziehung
- 2.3.1 Zu den Unterschieden zwischen den Geschlechtern
- 2.3.2 Ein Beispiel für geschlechtsspezifische Erziehung: TeenSTAR
- 2.3.3 Schwierigkeiten bei der geschlechtsspezifischen Erziehung
- 2.3.4 Ausgangspunkt der geschlechtsneutralen Erziehung: Geschlecht als soziales Konstrukt
- 2.3.5 Ein Beispiel für geschlechtsneutrale Erziehung: Egalia
- 2.4 Auswertungen verschiedener Studie
- 2.4.1 Zur Möglichkeit einer geschlechtsneutralen Erziehung
- 2.4.2 Zur Geschlechtsneutralität der unter Zweijährigen
- 2.4.3 die Geschlechtsidentität nach Trautner
- 2.4.4 Zu den Folgen geschlechtsneutraler Erziehung
- 2.5 abschließende Gedanken: Geschlechter als Pole im Miteinander
- C. Der Neue Mensch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob eine geschlechtsneutrale Pädagogik für Jugendliche fördernder und persönlichkeitsstärkender ist als eine geschlechtsspezifische Erziehung. Hierbei wird insbesondere die Entwicklung der Gender Theorie und ihre Auswirkungen auf die Erziehung in den Fokus gerückt. Die Arbeit analysiert, ob traditionelle Geschlechterrollen obsolet geworden sind oder ob sie noch immer essentielle Bedeutung für die Kultur besitzen. Dabei wird auch die Kritik am Gender Mainstreaming und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft beleuchtet.
- Entstehung und Entwicklung der Gender Theorie
- Kritik an der feministischen Entwicklung
- Geschlechtsspezifische vs. geschlechtsneutrale Erziehung
- Auswirkungen von Gender Mainstreaming auf die Gesellschaft
- Die Rolle der Geschlechter in der Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Präsenz des Geschlechtes in unserer Gesellschaft und zeigt auf, wie stark unser Leben von traditionellen Geschlechterrollen geprägt ist. Anschließend beleuchtet das zweite Kapitel die Entstehung der Gender Theorie, ihre Ziele und ihre Kritik. Dabei wird auch ein Exkurs in die Geschichte der Geschlechterrollen und die Entwicklung des Familienideals unternommen. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, wie sich die Gender Theorie auf die Erziehung auswirkt, und stellt die geschlechtsspezifische Erziehung der geschlechtsneutralen Erziehung gegenüber. Im vierten Kapitel werden verschiedene Studien ausgewertet, die die Möglichkeit und die Folgen von geschlechtsneutraler Erziehung beleuchten. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Gender Theorie, Geschlechterrollen, geschlechtsspezifische Erziehung, geschlechtsneutrale Erziehung, Gender Mainstreaming, Kultur, Familie, Selbstbewusstsein, Geschlechtsidentität.
- Quote paper
- Conni Endres (Author), 2014, Gender Mainstreaming in der Pädagogik. Geschlechtspezifische und geschlechtsneutrale Erziehung im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316951