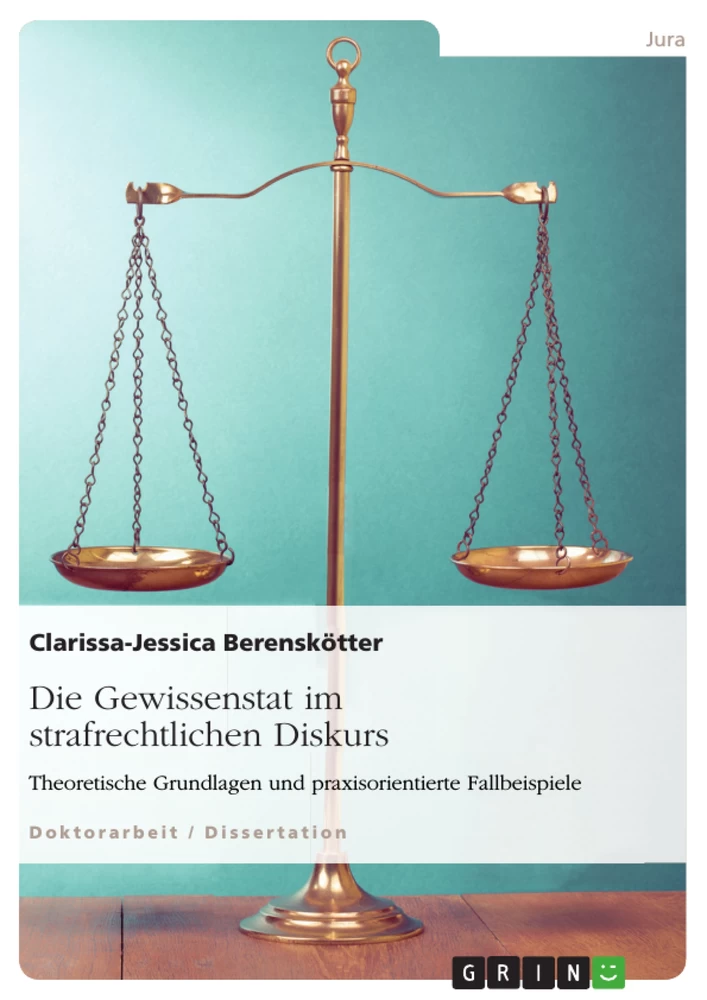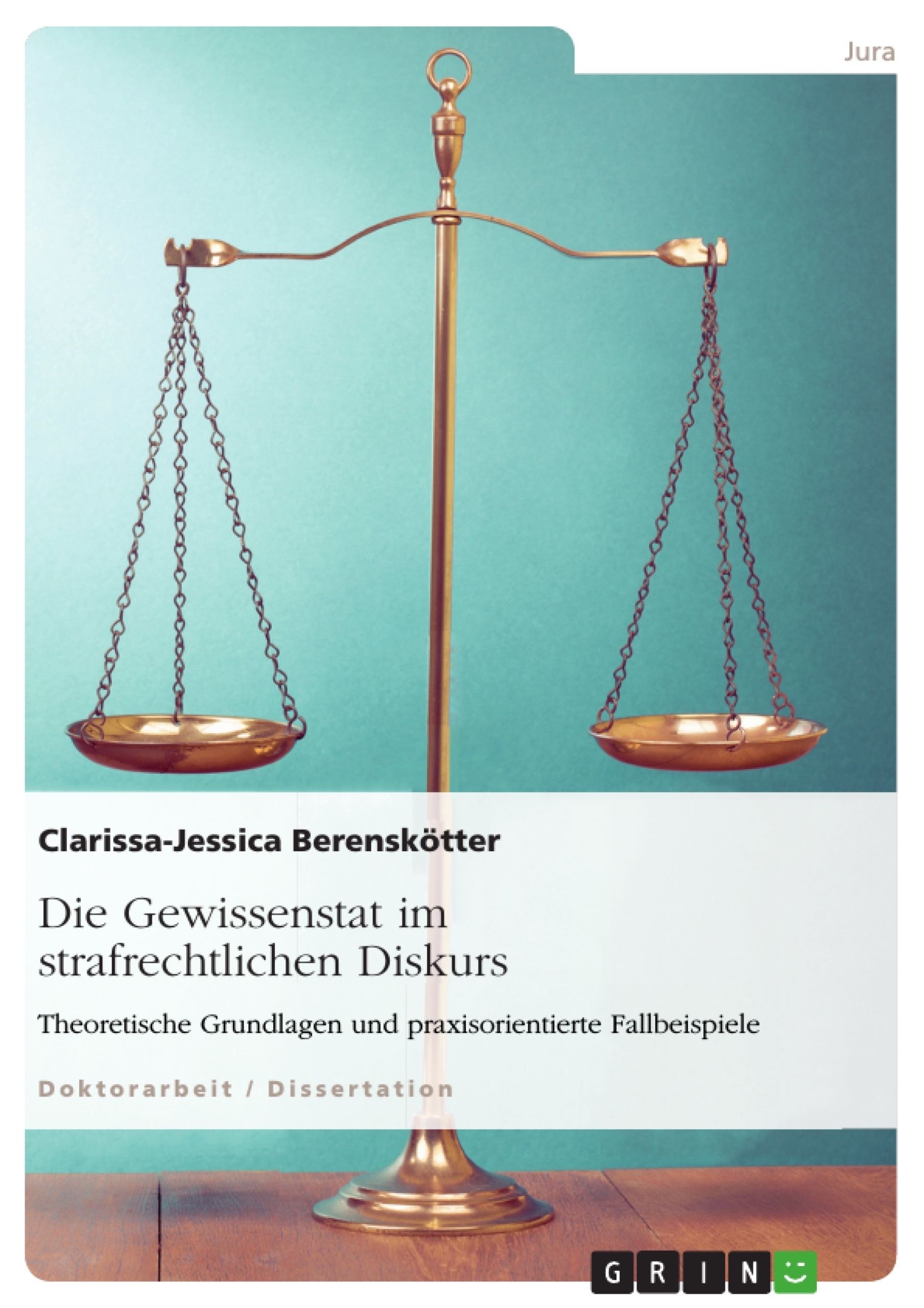Die Dissertation behandelt das Spannungsverhältnis der Gewissensfreiheit aus Art. 4 I GG im Verhältnis zu strafrechtlichen Normen.
Kollidieren individuelle Handlungs- oder Unterlassungsbefehle des Gewissens mit Rechtsnormen, manifestiert das Grundgesetz durch die schrankenlose Anerkennung der Gewissensfreiheit zunächst, dass der Grundrechtsträger grundsätzlich berechtigt ist, seinem Gewissen zu folgen. Allerdings ist es vorhersehbar, dass durch die schrankenlose Grundrechtsgewährleistung einerseits die Geltungskraft demokratisch geschaffener Gesetze in Frage gestellt und zum anderen Rechte Dritter oder der Allgemeinheit oder öffentliche Güter und Interessen gefährdet oder verletzt werden können. Die hauptsächliche Schwierigkeit besteht deshalb darin, einerseits die Gewissensfreiheit nicht als „Generalvorbehalt“ des Einzelnen gegenüber der Rechtsordnung und deren Verpflichtungen ausufern, andererseits aber das Grundrecht als unverletzlich erklärtes, höchstpersönliches Recht nicht überflüssig und inhaltsleer werden zu lassen.
Der Umgang mit dieser Schwierigkeit ist Gegenstand der Dissertation. Dabei werden der Einfluss des Grundrechts der Gewissensfreiheit auf die strafrechtliche Beurteilung von Gewissenstaten eruiert sowie die vielfältigen hierzu vertretenen unterschiedlichen Ansichten in Rechtsprechung und Literatur dargestellt und kritisch gewürdigt. Das Werk konzentriert sich unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben auf die Klärung der Frage, wie eine Kollision zwischen Individualgewissen und Rechtsordnung im Rahmen des Strafrechts zu behandeln ist. Hierbei werden die Besonderheiten von Gewissenstaten bei der strafrechtlichen Beurteilung auf der jeweiligen Deliktsprüfungsebene erörtert und anhand von Fallbeispielen praktisch veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
- ERSTER TEIL
- HISTORISCHE BETRACHTUNG DER GEWISSENSPROBLEMATIK
- 1. Kapitel
- Antike bis Neuzeit
- 19.-21. Jahrhundert
- ZWEITER TEIL
- BEGRIFFLICHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR BEURTEILUNG DER STRAFBARKEIT VON GEWISSENSTATEN
- 3. Kapitel
- Der Begriff des Gewissens
- Der Begriff der Gewissensentscheidung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation befasst sich mit der Gewissenstat im strafrechtlichen Diskurs. Sie untersucht die historischen und rechtlichen Grundlagen der Gewissensproblematik und analysiert die strafrechtliche Beurteilung von Gewissensentscheidungen.
- Die historische Entwicklung des Gewissensbegriffs im Strafrecht
- Die rechtliche Definition des Gewissens und der Gewissensentscheidung
- Die Anforderungen an eine strafrechtlich relevante Gewissensentscheidung
- Die Abgrenzung der Gewissensentscheidung von anderen Rechtfertigungsgründen
- Die strafrechtliche Behandlung von Gewissenskonflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der historischen Betrachtung der Gewissensproblematik. Es werden die Entwicklungen des Gewissensbegriffs im antiken römischen Recht, im altgermanischen Recht, im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Recht sowie im 19. und 20. Jahrhundert beleuchtet.
Der zweite Teil befasst sich mit den begrifflichen und rechtlichen Grundlagen zur Beurteilung der Strafbarkeit von Gewissensstaten. Es werden die Definitionen des Gewissens und der Gewissensentscheidung im außerrechtlichen und rechtlichen Bereich analysiert.
Die Arbeit untersucht die Anforderungen an das Entstehen und den Inhalt einer Gewissensentscheidung sowie die Abgrenzung der Gewissensentscheidung von anderen Rechtfertigungsgründen.
Schlüsselwörter
Gewissenstat, Gewissen, Gewissensentscheidung, Strafrecht, Rechtfertigungsgründe, historische Entwicklung, rechtliche Grundlagen, strafrechtliche Beurteilung.
- Quote paper
- Clarissa-Jessica Berenskötter (Author), 2015, Die Gewissenstat im strafrechtlichen Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316356