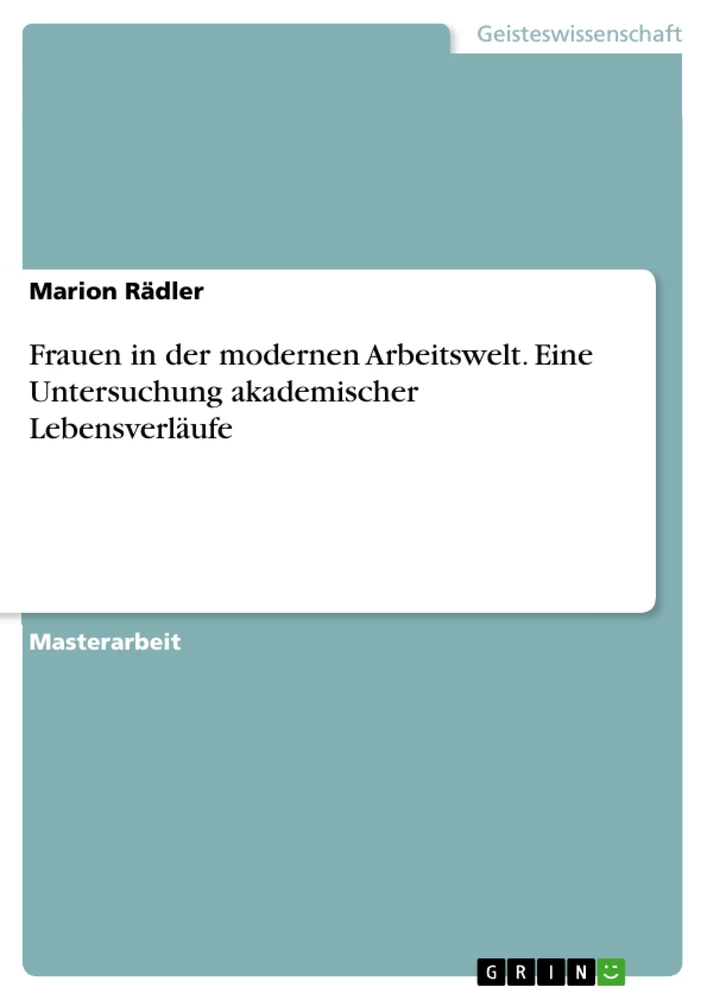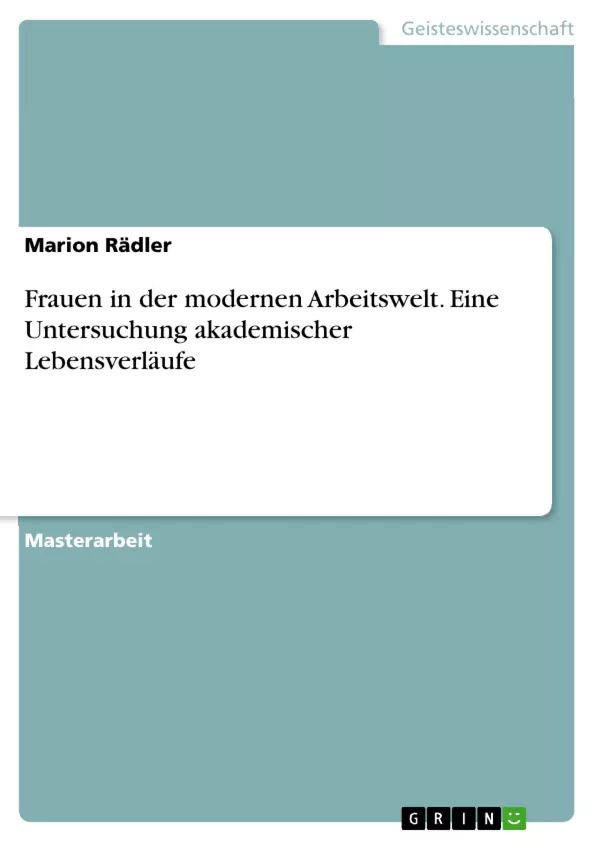Neue Technologien und die zunehmende Vernetzung in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht über nationale und kontinentale Grenzen hinweg haben die moderne Gesellschaft nachhaltig verändert. Besonders deutlich ist dieser Wandel im Bereich der Arbeit zu spüren: Der wirtschaftliche Strukturwandel führt dazu, dass Berufszweige pluraler und die berufliche Bildung anspruchsvoller werden, gleichzeitig wird der Wettbewerb verschärft und Arbeitsprozesse werden rationalisiert. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen eine selbstbestimmtere Arbeitsweise und lösen gleichzeitig die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zunehmend auf. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, wie vielschichtig der Wandel der Arbeitswelt ist und dass er neben Chancen erhebliche Unsicherheiten birgt.
Die Frage, wie Individuen die „schöne neue Arbeitswelt“ erleben und wie sie mit den damit einhergehenden biographischen Risiken umgehen, wird über den Zusammenhang von makro- und mikrosoziologischen Dynamiken der modernen Arbeitswelt behandelt – theoretisch sowie empirisch. Hierfür wird zunächst der Blick auf den historischen Strukturwandel von der Industrie- zur modernen Dienstleistungsgesellschaft gerichtet, um hiervon ausgehend zentralen sozialen Phänomenen der Moderne – Flexibilisierung, Beschleunigung und Selbstoptimierung – nachzugehen. Hierfür werden vier Theorien behandelt, die den aktuellen Diskurs prägen: "Der flexible Mensch" von Richard Sennett (1998), "Beschleunigung und Entfremdung" von Hartmut Rosa (2013), "Der Arbeitskraftunternehmer" von Günter Voß und Hans Pongratz (1998) sowie "Das unternehmerische Selbst" von Ulrich Bröckling (2007).
In die Diskussion werden aktuelle Studien und Daten eingeflochten, die zeigen, dass insbesondere die Gruppe der jungen, gut ausgebildeten Frauen – die von den Soziologen nur randständig diskutiert werden – besonders von den untersuchten sozialen Phänomenen betroffen sind. Im zweiten Teil dieser Abschlussarbeit soll im Rahmen einer Vorstudie den Fragen nachgegangen werden, wie diese Frauengeneration die moderne Arbeitswelt erlebt und wie sie ihre Rolle findet und gestaltet. Mithilfe narrativer Interviews werden erste Hinweise auf die Strategien dreier Frauen erfasst, die bereits seit mehreren Jahren versuchen, ihren Weg in der modernen Arbeitswelt zu finden. Im dritten Teil der Arbeit werden die empirischen Befunde vor dem Hintergrund der Theorien diskutiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- MODERNE ARBEITSWELT: MAKRO- UND MIKROPERSPEKTIVEN
- Historische Entwicklung
- Die moderne Dienstleistungsgesellschaft
- Dynamiken in der modernen Arbeitswelt
- Flexibilisierung und Drift
- Beschleunigung und Entfremdung
- Selbstoptimierter Arbeitskraftunternehmer
- Zwischenfazit
- UNTERSUCHUNGSDESIGN
- Interpretative Sozialforschung
- Das autobiographisch-narrative Interview
- Feldzugang und Fallauswahl
- Auswertungsmethodik
- BIOGRAPHISCHE FALLREKONSTRUKTIONEN
- Selbstpräsentation und erlebte Lebensgeschichte
- Katja
- Anna
- Silke
- Fallübergreifende Kontrastierung
- Erleben der modernen Arbeitswelt
- Dominante Handlungsmuster der Rollenfindung
- Der Zusammenhang von Biographie und Arbeitshaltung
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- Theorie und Empirie: Schnittstellen und Divergenzen
- Das Potential biographischer Sinnrekonstruktion
- AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Zusammenhang von makro- und mikrosoziologischen Dynamiken der modernen Arbeitswelt, insbesondere im Hinblick auf die Erfahrungen von Frauen in akademischen Berufsfeldern. Sie beleuchtet die Auswirkungen des wirtschaftlichen Strukturwandels von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft auf die Arbeitswelt und analysiert zentrale Phänomene wie Flexibilisierung, Beschleunigung und Selbstoptimierung.
- Der Einfluss des Strukturwandels auf die moderne Arbeitswelt
- Die Herausforderungen von Flexibilisierung, Beschleunigung und Selbstoptimierung
- Die subjektiven Erfahrungen von Frauen in akademischen Berufen
- Die Rolle von biografischen Faktoren für die Bewältigung von Arbeitsanforderungen
- Die Bedeutung von narrativen Interviews für die Erforschung individueller Lebensverläufe
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung (Kapitel 1) bietet eine Einführung in das Thema und stellt den Rahmen für die Untersuchung dar. Sie beleuchtet den Wandel der Arbeitswelt von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und analysiert die zentralen Dynamiken von Flexibilisierung, Beschleunigung und Selbstoptimierung. Kapitel 2 beschreibt das Untersuchungsprogramm, das auf interpretativer Sozialforschung und autobiographisch-narrativen Interviews basiert. Kapitel 3 präsentiert biographische Fallrekonstruktionen von drei Frauen, die Einblicke in ihre Erfahrungen mit der modernen Arbeitswelt liefern. Die Schlussteil (Kapitel 4) diskutiert die Ergebnisse vor dem Hintergrund der einleitenden Theorie, während der Ausblick (Kapitel 5) den Bedarf weiterer Forschungsarbeiten und mögliche zukünftige Fragestellungen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen moderne Arbeitswelt, Wandel von Industrie- zu Dienstleistungsgesellschaft, Flexibilisierung, Beschleunigung, Selbstoptimierung, biografische Erfahrungen, Frauen in akademischen Berufen, narrative Interviews, interpretative Sozialforschung.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert der Strukturwandel die moderne Arbeitswelt?
Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft führt zu mehr Flexibilisierung, aber auch zu einer Verschmelzung von Arbeit und Privatleben.
Was bedeutet der Begriff "Arbeitskraftunternehmer"?
Dieses Konzept von Voß und Pongratz beschreibt Arbeitnehmer, die ihre Arbeitskraft wie ein eigenes Unternehmen führen und sich ständig selbst optimieren müssen.
Welche Rolle spielt die Beschleunigung nach Hartmut Rosa?
Rosa beschreibt eine soziale Beschleunigung, die oft zu Entfremdung und dem Gefühl führt, trotz höherem Tempo nie genug Zeit zu haben.
Warum sind gerade Akademikerinnen von diesen Dynamiken betroffen?
Gut ausgebildete Frauen stehen oft unter hohem Leistungsdruck und müssen Flexibilität sowie Selbstoptimierung in einem oft noch männlich geprägten Umfeld leisten.
Was ist ein autobiographisch-narratives Interview?
Eine Forschungsmethode, bei der Personen frei aus ihrem Leben erzählen, um subjektive Erfahrungen und Bewältigungsstrategien im Berufsleben zu rekonstruieren.
Was versteht Richard Sennett unter dem "flexiblen Menschen"?
Sennett kritisiert, dass ständige Flexibilität den Charakter korrodieren kann, da langfristige Bindungen und berufliche Identitäten erschwert werden.
- Quote paper
- Marion Rädler (Author), 2015, Frauen in der modernen Arbeitswelt. Eine Untersuchung akademischer Lebensverläufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315037