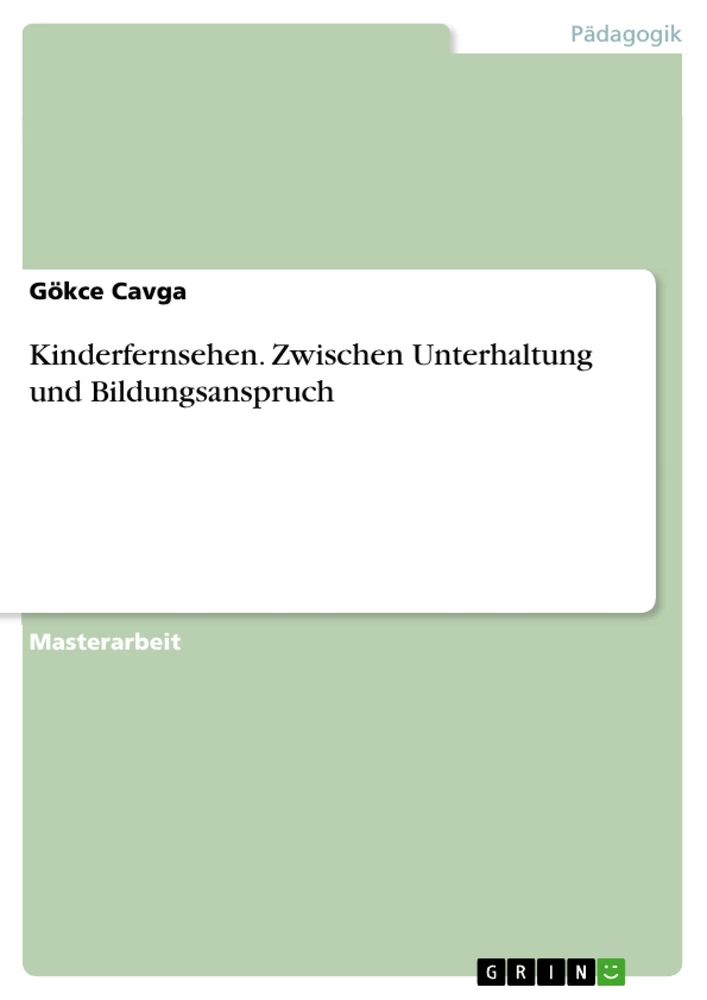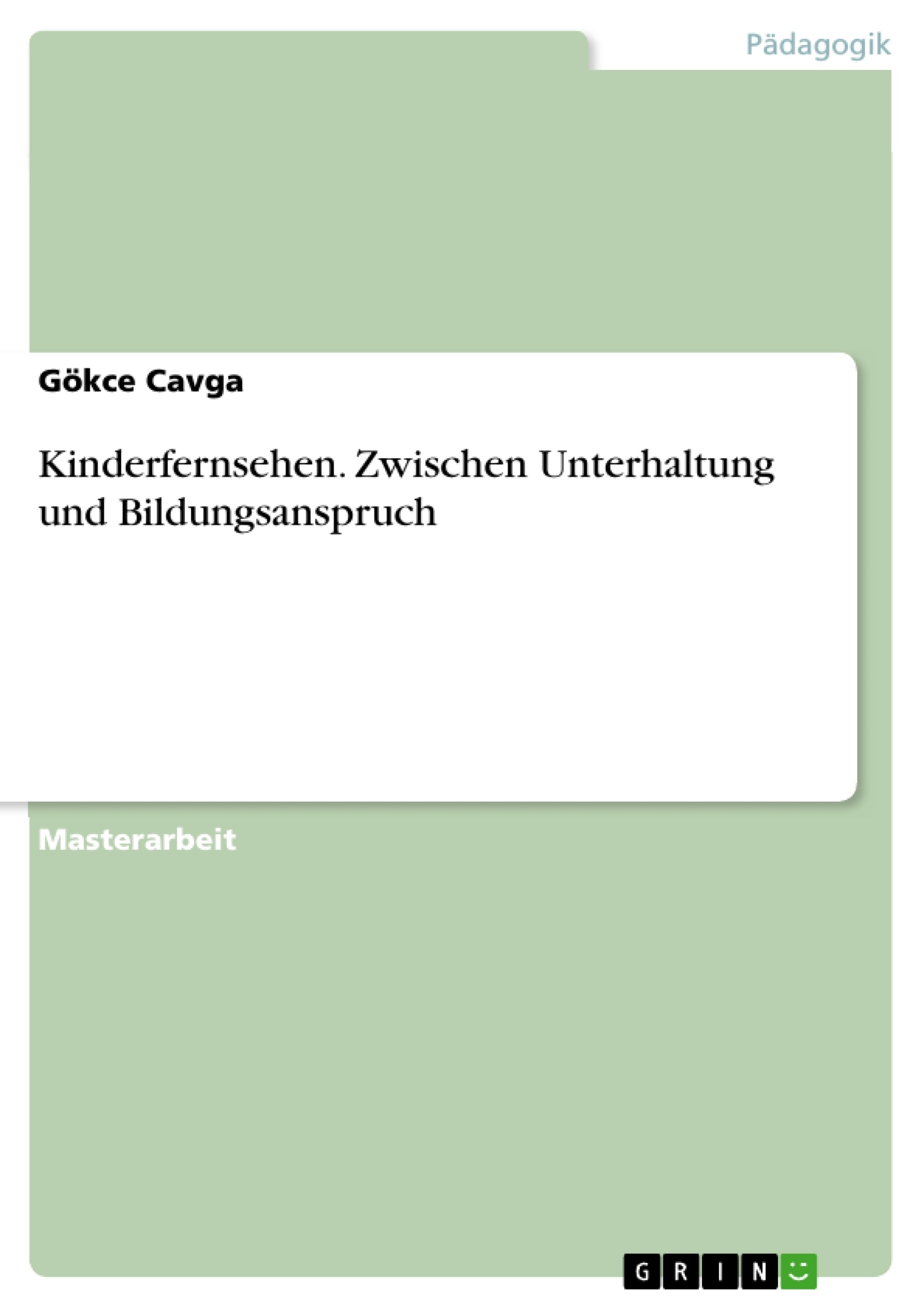Das Medium „Fernsehen“ ist in der heutigen Zeit nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Es wird von jedem Nutzer entweder zu Unterhaltungszwecken, zur Gewinnung von Informationen oder als Aneignung von Wissen benutzt. Die Nutzung des Fernsehens dient mit seinen vielzähligen Sendungen dem Freizeitvertreib oder dem Informationsbezug.
Die spezielle Form des Kinderfernsehens kann für die kindliche Entwicklung eine Bedeutung erhalten, wenn Sendungen ausgestrahlt werden, die wissensvermittelnde und lehrreiche Angebote enthalten. Aber nicht jedes Kind nutzt diese Angebote, die speziell für Kinder produziert werden. Viele Kinder präferieren Sendungen für Erwachsene, um wieder etwas Neues zu lernen oder sich subjektiv besser unterhaltet zu fühlen. Für die Kinder hat sich das Fernsehen als allerwichtigstes Alltagsmedium entfaltet. Nach neueren Untersuchungen nutzen 79% aller Kinder das Fernsehen als vorrangiges Medium (vgl. http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf14/KIM14.pdf, 2014, S. 20, Stand: 28.04.2015). Somit ist das Fernsehen der Spitzenreiter unter allen genutzten Medien. In jedem Haushalt gibt es zur Zeit mindestens ein Fernsehgerät (vgl. KIM-Studie, mpfs 2014, S.9).
Heutzutage können Kinder vom „Fern-Sehen“ sehr schwer ferngehalten werden, vor allem Kinder von sechs bis dreizehn Jahren besitzen schon zu 35% einen eigenen Fernseher (vgl. KIM-Studie, mpfs 2014, S.9). Deshalb gewinnen Fragen zur Qualität und sinngebendem Inhalt des Kinderfernsehens an Bedeutung. Insbesondere sollte aus der Elternperspektive ein geeignetes Kinderprogramm „lehrreich" sein, so die Studie „Kinderwelten 2000" (vgl. http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/ televizion/14_2001_1/goetz.pdf, S.3, Stand: 28.04.2015). Gert Müntefering - einer der erfolgreichen Mitgründer „der Sendung mit der Maus“ - beschrieb das Kinderfernsehen Anfang der 70er Jahre wie folgt: „Kinderfernsehen ist, wenn Kinder fernsehen" (Erlinger, 1998, S. 641). Dieses bekannte Zitat zeigt, dass das Kinderfernsehen sich nicht nur auf Sendungen beschränkt, die für Kinder gedacht sind. Gerne unterbreiten die Fernsehanstalten und Programmmacher auch Unterhaltsangebote wie Spielfilme, Gameshows, Sportsendungen, etc.
Vor dem beschriebenen Hintergrund stellt sich die Frage, wann das Fernsehen für Kinder „gut“ ist? Wie sind die Lernsendungen strukturiert? Auf was achten die Programmmacher? Lernen die Kinder durch diese Sendungen?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Kinderfernsehens
- 1980iger Jahre: „Konkurrenz”
- 1970iger Jahre: „die erste Vorschulserie”
- 1950-1966: „Die ARD als Alleinanbieter”
- 1967-1973: „Kinder haben ein Recht auf Unterhaltung und Bildung”
- 1997 bis heute: „Die Geburtsstunde des Kinderkanals”
- Die wichtigen Merkmale und Aspekte des Kinderfernsehens
- Wann handelt es sich um „gutes Kinderfernsehen”?
- Vorstrukturierung einer Kinderlernsendung
- Die vielfältigen Einstiegspunkte einer Kinderlernsendung
- Die Anwendung der Merkmale und Aspekte an einer Magazinsendung
- Das Format Magazinsendung
- Die Sendung „pur+” vom 11.04.2015: „Eric kassiert die Handys ein”
- Der Vorspann: Eine Vorstellung und Analyse
- Einführung in das Thema der Sendung: Der erste Beitrag und Analyse
- Der zweite Beitrag und Analyse
- Der dritte Beitrag und Analyse
- Das Ende der Sendung und Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Rolle von Bildung und Unterhaltung im deutschen Kinderfernsehen. Sie analysiert, ob öffentlich-rechtliche Sender ihrem Bildungsauftrag gerecht werden und inwieweit Kinder durch speziell für sie konzipierte Fernsehprogramme lernen. Die Arbeit betrachtet die Geschichte des Kinderfernsehens, analysiert Merkmale guter Kindersendungen und untersucht eine exemplarische Magazinsendung.
- Die Entwicklung des Kinderfernsehens in Deutschland
- Merkmale und Kriterien für "gutes" Kinderfernsehen
- Das Verhältnis von Unterhaltung und Bildung im Kinderfernsehen
- Analyse einer exemplarischen Magazinsendung
- Der Bildungsauftrag öffentlich-rechtlicher Sender
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Kinderfernsehens ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Unterhaltung und Bildung in diesem Medium. Sie verweist auf die hohe Relevanz des Fernsehens für Kinder und die damit verbundene Bedeutung der Programmqualität. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz und die zentralen Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen.
Die Entwicklung des Kinderfernsehens: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Kinderfernsehens in Deutschland, beginnend mit der ARD als Alleinanbieter bis hin zur heutigen Situation mit dem Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Es beschreibt die Veränderungen im Programmformat und den Einfluss des dualen Rundfunksystems auf die Qualität und den Inhalt des Kinderfernsehens. Die zunehmende Konkurrenz führte zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Programmqualität und den Bedürfnissen von Kindern und Eltern. Die Kapitel analysiert die sich ändernden Ansprüche an Kinderprogramme, die von Pädagogen und Eltern gestellt werden.
Die wichtigen Merkmale und Aspekte des Kinderfernsehens: Dieses Kapitel befasst sich mit den Merkmalen und Aspekten, die "gutes" Kinderfernsehen auszeichnen. Es definiert Kriterien für die Qualität von Kindersendungen und untersucht den Aufbau und die Struktur lehrreicher Programme. Die Vielfältigkeit von Einstiegspunkten für Kinder unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten wird hierbei genauer analysiert. Es wird dargelegt, wie kindgerechte Präsentationen und die Berücksichtigung von Entwicklungsphasen zu erfolgreichem Lernen beitragen.
Die Anwendung der Merkmale und Aspekte an einer Magazinsendung: Dieses Kapitel analysiert eine konkrete Magazinsendung aus dem Kinderprogramm „ZDF-tivi“, um die im vorherigen Kapitel erörterten Kriterien auf einen praktischen Fall anzuwenden. Es untersucht die Struktur der Sendung, die einzelnen Beiträge und deren didaktische Qualität. Der Vorspann, die Einführung in das Thema, die einzelnen Beiträge und das Ende der Sendung werden einzeln analysiert und auf ihre Wirkung auf Kinder eingegangen. Die Analyse fokussiert auf die Balance zwischen Unterhaltung und Bildung.
Schlüsselwörter
Kinderfernsehen, Bildungsauftrag, Unterhaltung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Medienpädagogik, qualitative Inhaltsanalyse, Kinderprogramm, Lernprogramm, Mediennutzung, Entwicklungsphasen, Altersadäquanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Analyse einer Magazinsendung im deutschen Kinderfernsehen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Rolle von Bildung und Unterhaltung im deutschen Kinderfernsehen, insbesondere die Frage, ob öffentlich-rechtliche Sender ihrem Bildungsauftrag gerecht werden und wie Kinder durch spezielle Fernsehprogramme lernen. Die Arbeit analysiert die Geschichte des Kinderfernsehens, Merkmale guter Kindersendungen und eine exemplarische Magazinsendung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des deutschen Kinderfernsehens, Kriterien für "gutes" Kinderfernsehen (Verhältnis von Unterhaltung und Bildung), die Analyse einer konkreten Magazinsendung und den Bildungsauftrag öffentlich-rechtlicher Sender.
Welche Zeiträume der Entwicklung des Kinderfernsehens werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des Kinderfernsehens von den 1950er Jahren (ARD als Alleinanbieter) bis heute, mit Fokus auf wichtige Entwicklungsphasen wie die 1970er (erste Vorschulserie), 1980er (zunehmende Konkurrenz) und die Zeit nach 1997 (Kinderkanal).
Welche Kriterien definieren "gutes" Kinderfernsehen?
Die Arbeit definiert Kriterien für "gutes" Kinderfernsehen, die den Aufbau und die Struktur lehrreicher Programme, kindgerechte Präsentationen und die Berücksichtigung von Entwicklungsphasen umfassen. Die Vielfältigkeit von Einstiegspunkten für Kinder unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten wird ebenfalls analysiert.
Welche Sendung wird exemplarisch analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch die Magazinsendung „pur+“ vom 11.04.2015 („Eric kassiert die Handys ein“) vom ZDF-tivi. Die Analyse umfasst den Vorspann, die Einführung, die einzelnen Beiträge und das Ende der Sendung hinsichtlich ihrer didaktischen Qualität und der Balance zwischen Unterhaltung und Bildung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse der exemplarischen Magazinsendung, um die im theoretischen Teil entwickelten Kriterien auf einen praktischen Fall anzuwenden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung des Kinderfernsehens, ein Kapitel zu Merkmalen guten Kinderfernsehens, ein Kapitel zur Analyse der ausgewählten Magazinsendung und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderfernsehen, Bildungsauftrag, Unterhaltung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Medienpädagogik, qualitative Inhaltsanalyse, Kinderprogramm, Lernprogramm, Mediennutzung, Entwicklungsphasen, Altersadäquanz.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist das Verhältnis von Unterhaltung und Bildung im deutschen Kinderfernsehen und die Frage, inwieweit öffentlich-rechtliche Sender ihrem Bildungsauftrag gerecht werden.
- Quote paper
- Gökce Cavga (Author), 2015, Kinderfernsehen. Zwischen Unterhaltung und Bildungsanspruch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314661