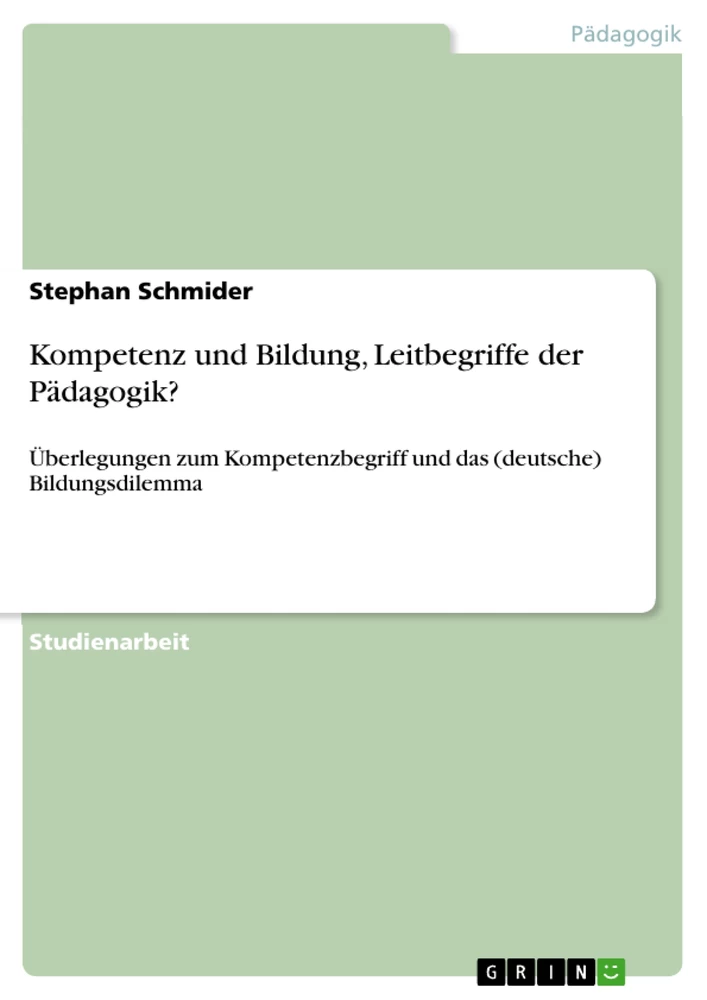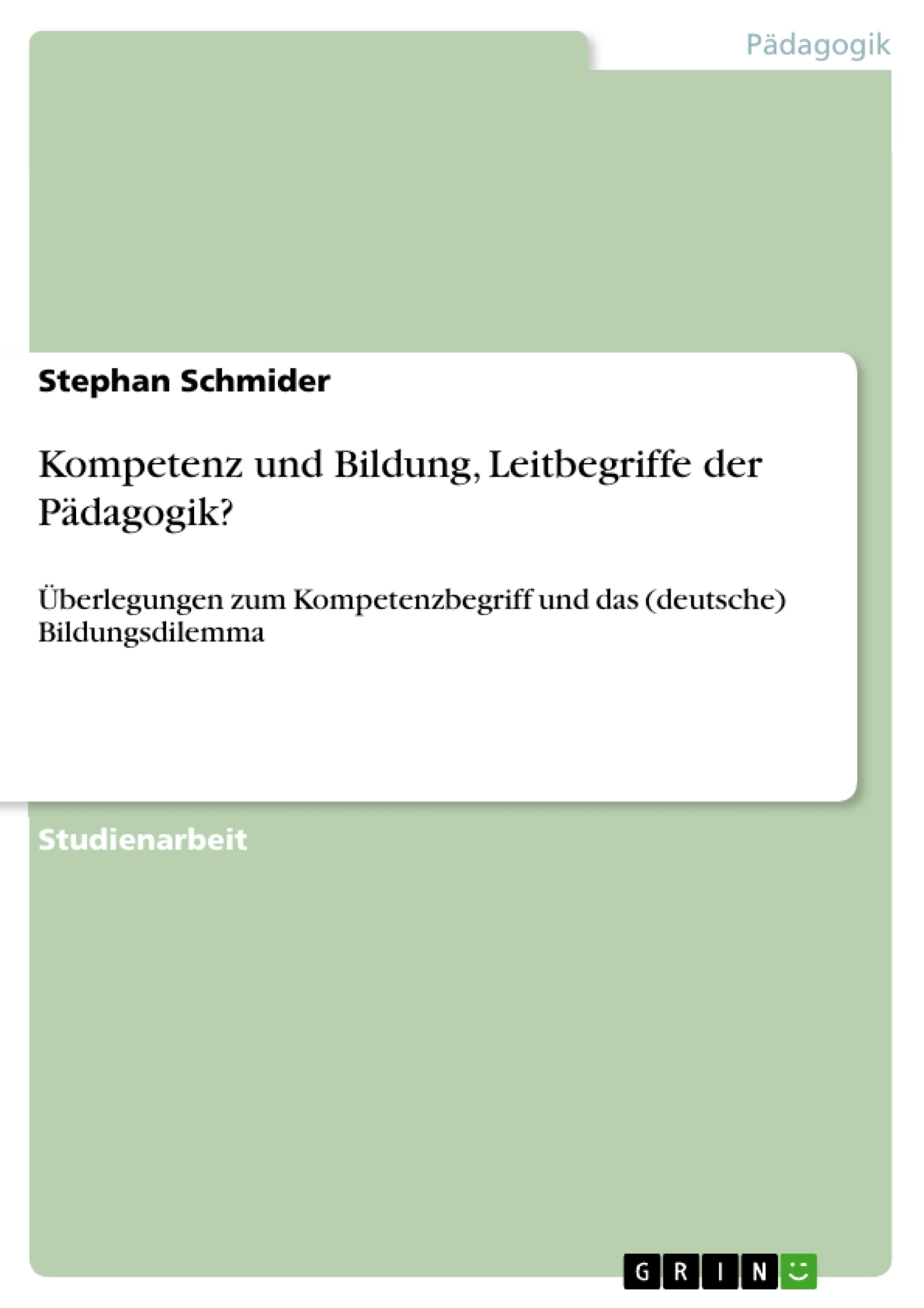Wie lässt sich der Begriff "Kompetenz" in den pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen Diskurs um Bildung, Erziehung und Lernen einbringen?
Um diese und weitere Fragen zu beantworten, wird zu Beginn der Arbeit der Kompetenzbegriff und dessen Fokussierung durch die europäische Lissabon-Strategie erläutert. Hierfür werden einzelne Beispiele und Maßnahmen herausgenommen (z.B. der Europäische Qualifikationsrahmen), um einen allgemeinen Überblick über Funktionen der Wissensgesellschaft in der EU zu geben und deutlich werden zu lassen, warum es hierbei so stark um Kompetenzen geht und warum der Begriff hierdurch eine breite Aufmerksamkeit errungen hat.
Im dritten Kapitel wird darauf aufbauend die Kritik an den erläuterten Maßnahmen und damit die Kritik an der Kompetenzorientierung erläutert. Es soll deutlich werden, was kritisiert wird und welche Folgen diese Kritik (für den Kompetenzbegriff und den Bildungsbegriff) hat. Des Weiteren wird das traditionelle deutsche Dilemma um Bildung erörtert, um deutlich werden zu lassen, wie die beiden Begriffe "Bildung" und "Kompetenz" zueinander stehen. Was sind Gemeinsamkeiten, was Unterschiede und was Paradoxe der beiden Begriffe?
Im letzten Teil soll dann die Vereinbarkeit zwischen Bildung und Kompetenz erläutert werden, um die Frage zu beantworten, ob beide sich ausschließen oder miteinander gebraucht werden können? Wie kann sich hierbei die Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin verorten und beide Begriffe ver- und anwenden, um als Disziplin Anerkennung und Fortschritt im Sinne von wissenschaftlichem Fortschritt zu fördern? Es folgt ein Resumée der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Kompetenzbegriff und die EU
- 2.1 Fokussierungen auf Kompetenz in der Wissensgesellschaft
- 2.2 Der Europäische und deutsche Qualifikationsrahmen und das Lebenslange Lernen
- 3. Kompetenz als ökonomisierte Bildung?
- 3.1 Ökonomie und Humankapital
- 3.2 Bildungsideal und Wunschdenken
- 4. Dichotomie der beiden Begriffe Bildung und Kompetenz?
- 5. Kompetenz - Chance für den erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Diskurs
- 6. Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Kompetenzbegriff im Kontext der europäischen Bildungspolitik und seine Beziehung zum traditionellen deutschen Bildungsverständnis. Die Arbeit analysiert die kritischen Aspekte der Kompetenzorientierung und beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen Kompetenz und Bildung. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Vereinbarkeit beider Begriffe und deren Bedeutung für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs.
- Der Kompetenzbegriff im Kontext der Lissabon-Strategie und der Wissensgesellschaft
- Kritik an der Kompetenzorientierung und deren Folgen für Bildung
- Das deutsche Bildungsdilemma: Zweckfreiheit vs. Zweckgebundenheit
- Das Verhältnis zwischen Kompetenz und Bildung: Widerspruch oder Ergänzung?
- Die Rolle des Kompetenzbegriffs im erziehungswissenschaftlichen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Kompetenz und Bildung im Kontext der europäischen Bildungspolitik und des deutschen Bildungsverständnisses. Sie betont die weitverbreitete Verwendung des Kompetenzbegriffs in verschiedenen Bereichen und die Notwendigkeit einer kritischen Reflexion im pädagogischen Diskurs. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die methodischen Ansätze zur Beantwortung der Forschungsfrage.
2. Der Kompetenzbegriff und die EU: Dieses Kapitel beleuchtet den Kompetenzbegriff im Kontext der europäischen Lissabon-Strategie und der Wissensgesellschaft. Es untersucht die Fokussierung auf Kompetenzen als Reaktion auf die Herausforderungen der Globalisierung und den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Die Rolle des Europäischen Qualifikationsrahmens und des lebenslangen Lernens wird im Hinblick auf die Kompetenzorientierung erörtert. Die Kapitel analysiert den historischen Wandel des Kompetenzbegriffs und seine vielschichtigen Bedeutungen. Die zunehmende Bedeutung von Wissen und Information in der heutigen Gesellschaft wird hervorgehoben, sowie die damit verbundenen Risiken und Unsicherheiten im Kontext von Ulrich Becks Risikogesellschaft. Es wird eine Brücke zwischen der historischen Entwicklung und der aktuellen Verwendung im europäischen Kontext geschlagen.
3. Kompetenz als ökonomisierte Bildung?: Kapitel 3 analysiert die Kritik an der Kompetenzorientierung und ihren ökonomischen Implikationen. Es diskutiert das Konzept des Humankapitals und beleuchtet die Frage, inwieweit die Betonung von Kompetenzen zu einer Ökonomisierung von Bildung führt. Der kritische Diskurs um die Vereinbarkeit von Kompetenzorientierung mit traditionellen Bildungsidealen wird erörtert und die potenziellen Folgen für das deutsche Bildungsverständnis untersucht. Es werden die Spannungen zwischen den ökonomischen Bedürfnissen der Gesellschaft und den eigentlichen Zielen von Bildung beleuchtet und mögliche Kompromisse oder Konflikte aufgezeigt. Das Kapitel hinterfragt, ob eine rein ökonomisch ausgerichtete Kompetenzorientierung den eigentlichen Zielen von Bildung gerecht wird.
4. Dichotomie der beiden Begriffe Bildung und Kompetenz?: Kapitel 4 untersucht die Beziehung zwischen den Begriffen Bildung und Kompetenz. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sowie mögliche Widersprüche zwischen beiden Begriffen. Es wird hinterfragt, ob Bildung und Kompetenz als gegensätzliche Konzepte verstanden werden müssen oder ob sie sich ergänzen können. Die Diskussion über das deutsche Bildungsdilemma und die Spannungen zwischen Zweckfreiheit und Zweckgebundenheit wird eingebunden. Der Fokus liegt auf dem Klären des Verhältnisses beider Begriffe und möglichen Lösungsansätzen für die scheinbaren Widersprüche. Die Kapitel stellt die Frage, ob eine Synthese beider Begriffe möglich ist und welche Implikationen dies für die pädagogische Praxis hat.
5. Kompetenz - Chance für den erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Diskurs: Kapitel 5 bewertet das Potential des Kompetenzbegriffs für den erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Diskurs. Es erörtert die Möglichkeiten der Integration des Kompetenzbegriffs in die pädagogische Theorie und Praxis unter Berücksichtigung der Kritikpunkte aus den vorherigen Kapiteln. Es geht um die Frage, wie der Kompetenzbegriff für einen produktiven Fortschritt in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion genutzt werden kann, ohne die traditionellen Ziele der Bildung zu vernachlässigen. Die Kapitel sucht nach Wegen, wie die Pädagogik als Disziplin sowohl den Kompetenzbegriff als auch das traditionelle Bildungsverständnis sinnvoll integrieren kann.
Schlüsselwörter
Kompetenz, Bildung, Wissensgesellschaft, Lissabon-Strategie, Europäischer Qualifikationsrahmen, Lebenslanges Lernen, Ökonomisierung von Bildung, Bildungsideal, Zweckfreiheit, Zweckgebundenheit, pädagogischer Diskurs, Humankapital, Risikogesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kompetenz und Bildung im Kontext der europäischen Bildungspolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Kompetenzbegriff im Kontext der europäischen Bildungspolitik und seine Beziehung zum traditionellen deutschen Bildungsverständnis. Sie analysiert kritische Aspekte der Kompetenzorientierung und beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen Kompetenz und Bildung. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Vereinbarkeit beider Begriffe und deren Bedeutung für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Kompetenzbegriff im Kontext der Lissabon-Strategie und der Wissensgesellschaft; Kritik an der Kompetenzorientierung und deren Folgen für die Bildung; das deutsche Bildungsdilemma (Zweckfreiheit vs. Zweckgebundenheit); das Verhältnis zwischen Kompetenz und Bildung (Widerspruch oder Ergänzung?); die Rolle des Kompetenzbegriffs im erziehungswissenschaftlichen Diskurs; die Ökonomisierung von Bildung und das Konzept des Humankapitals; den Europäischen Qualifikationsrahmen und lebenslanges Lernen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der Kompetenzbegriff und die EU, Kompetenz als ökonomisierte Bildung?, Dichotomie der beiden Begriffe Bildung und Kompetenz?, Kompetenz - Chance für den erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Diskurs, und Abschluss. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt des Verhältnisses von Kompetenz und Bildung, beginnend mit einer Einführung in den Kompetenzbegriff im europäischen Kontext und endend mit einer Bewertung des Potenzials des Kompetenzbegriffs für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detaillierte Einblicke in den Inhalt jedes Kapitels. Kapitel 1 führt in die Thematik ein. Kapitel 2 beleuchtet den Kompetenzbegriff im Kontext der EU-Strategien. Kapitel 3 analysiert die Kritik an der ökonomischen Ausrichtung der Kompetenzorientierung. Kapitel 4 untersucht die Beziehung zwischen Bildung und Kompetenz. Kapitel 5 bewertet das Potential des Kompetenzbegriffs für den pädagogischen Diskurs.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Kompetenz, Bildung, Wissensgesellschaft, Lissabon-Strategie, Europäischer Qualifikationsrahmen, Lebenslanges Lernen, Ökonomisierung von Bildung, Bildungsideal, Zweckfreiheit, Zweckgebundenheit, pädagogischer Diskurs, Humankapital, Risikogesellschaft.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie verhält sich der Kompetenzbegriff zur Bildung im Kontext der europäischen Bildungspolitik und des deutschen Bildungsverständnisses? Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit beider Begriffe und deren Bedeutung für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit benennt zwar nicht explizit die verwendeten Methoden, aber aus dem Inhalt lässt sich schließen, dass es sich um eine kritische Auseinandersetzung mit der Literatur und den bestehenden Diskursen zu Kompetenz und Bildung handelt, eine Analyse bestehender Konzepte und eine kritische Bewertung des Verhältnisses von beiden Begriffen.
- Arbeit zitieren
- Stephan Schmider (Autor:in), 2014, Kompetenz und Bildung, Leitbegriffe der Pädagogik?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314562