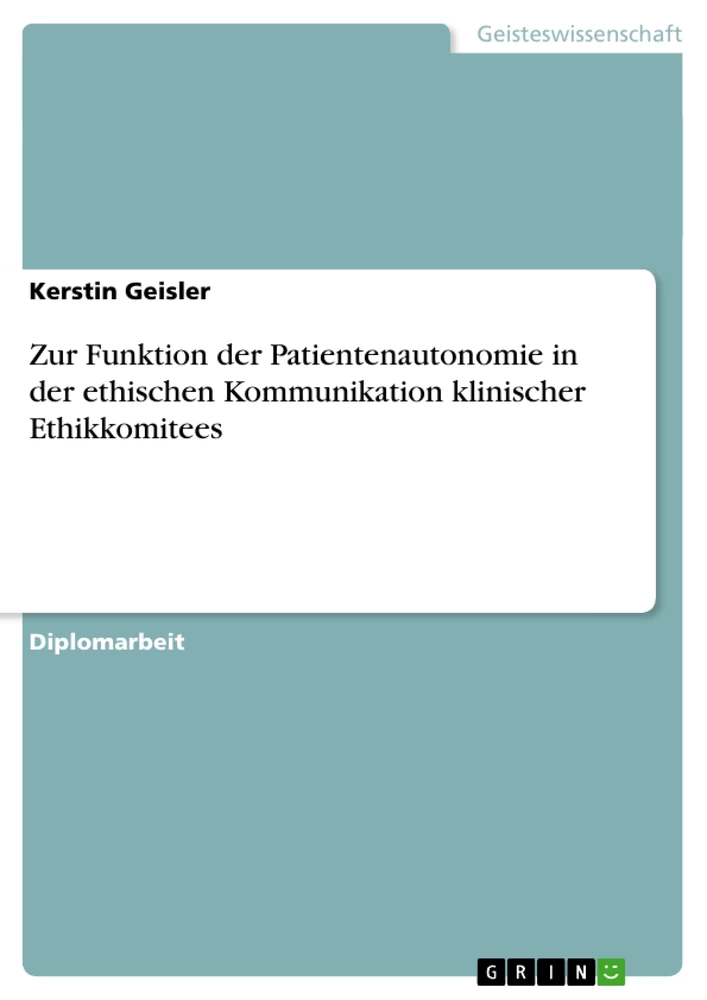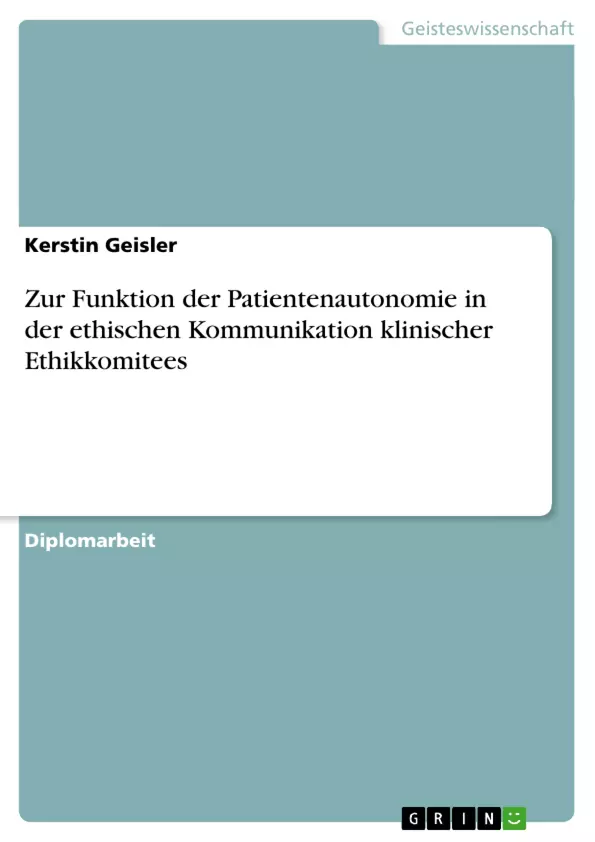Profession und Deprofessionalisierung, Paternalismus und Patientenautonomie, ärztliche
Entscheidung und Patientenwille, Verantwortungsübernahme und Verantwortungsabgabe,
Belastung und Entlastung, Distanz und Nähe, Experte und Laie, Wissen und Nichtwissen...
Diese Aufzählung ließe sich natürlich noch verlängern, aber das Entscheidende wird auch an
den dargestellten Paaren sichtbar: Die Gegensätzlichkeit.
Diese Gegensätzlichkeit wird in dieser Arbeit verwendet, um sich der Ausgangsfrage dieser
Arbeit zu nähern. Es wird also Wert auf eine kontroverse Argumentation gelegt.
Um dies zu erreichen, wurde als Bearbeitungsmethode die funktionale Analyse gewählt,
welche in Kapitel 2 vorgestellt wird. Sie impliziert bereits die kontroverse Darstellung durch
die Problem- bzw. Problemlösungszuschreibung zu gesellschaftlichen Phänomenen. Durch
diese Methode soll aufgezeigt werden, welche Probleme innerhalb des medizinischen
Systems bestanden bzw. bestehen und welche Entwicklungen dadurch notwendig geworden
sind. Außerdem wird in diesem Kapitel auf die Perspektive des Beobachters zweiter Ordnung
und des wissenschaftlichen Forschers eingegangen, um meine Position in dem
Forschungsprozess deutlich zu machen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit medizinsoziologischen Entwicklungen. Dabei sollen zunächst
die Entwicklungen dargestellt werden, die zu einer Autonomiesteigerung des Patienten
geführt haben. Es soll also aufgezeigt werden, warum Patientenautonomie überhaupt ein
Thema der Kommunikation geworden ist. Dabei wird expliziert, welche Schwierigkeiten im
medizinischen System entstanden sind, die die Entwicklung des autonomen Patienten
ermöglicht bzw. notwendig gemacht haben. So soll in diesem Kapitel auch aufgezeigt
werden, welche Dynamik sich aufgrund der asymmetrischen Arzt-Patienten-Beziehung
entwickelt hat und wie sich das Verhältnis zwischen diesen beiden Akteuren durch die
Entstehung des autonomen Patienten verändert hat.
Bei diesen Überlegungen spielen die aufgezählten Antipoden dahingehend eine wichtige
Rolle, da sie einerseits die Schwierigkeiten des medizinischen Systems allgemein und
andererseits speziell die Probleme im Umgang mit dem Patienten sichtbar machen.
Schwierigkeiten also, welche teilweise die Entwicklung des Patienten zu einem autonomen
Patienten vorangetrieben haben, teilweise aber erst durch den autonomen Patienten
hervorgebracht wurden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Das Religionssoziologische dieser Arbeit
- Methode
- Talcott Parsons Kausalitätskonzept und Robert Mertons Dysfunktionalität
- Niklas Luhmann – Entwicklung der funktionalen Methode
- Die Anwendung der funktionalen Methode zur Auswertung der teilnehmenden Beobachtungsprotokolle
- Beobachtung
- Beobachtung erster Ordnung
- Beobachtung zweiter Ordnung
- Untersuchung der teilnehmenden Beobachtungsprotokolle – eine Beobachtung zweiter Ordnung
- Die wissenschaftliche Perspektive dieser Arbeit
- Medizinsoziologische Entwicklungen
- Die Medizin als Profession
- Die klassische Rolle des Arztes
- Universalismus
- Funktionale Spezifität
- Affektive Neutralität
- Kollektivitätsorientierung
- Leistungsorientierung
- Arzt-Patienten-Beziehung
- Pflege-Patienten-Beziehung
- Arzt-Patienten-Beziehung versus Pflege-Patienten-Beziehung
- Die Exklusion der menschlichen Seite des Patienten
- Die klassische Rolle des Arztes
- Deprofessionalisierung der Medizin
- Der Patient als Mensch
- Auswirkungen der Deprofessionalisierung auf die Arzt-Patienten-Beziehung
- Entstehung einer neuen Ethik in der Medizin
- Die Auswirkungen der Legitimationskrise der Medizin auf die Organisation Krankenhaus
- Paternalismus versus Patientenautonomie
- Paternalismus
- Starker Paternalismus
- Neopaternalismus
- Kriterien der ärztlichen Dominanz
- Macht als Ausdrucksmedium der ärztlichen Dominanz
- Autorität als positive Ausdrucksform der ärztlichen Dominanz
- Individualisierung
- Patientenautonomie
- Verschiedene Arten der Patientenautonomie
- Patientenverfügungen
- Patientenbetreuer
- Zusammenfassung der Funktion der Patientenautonomie
- Verschiedene Arten der Patientenautonomie
- Paternalismus
- Klinisches Ethikkomitee
- Zielsetzung eines Ethikkomitees
- Zusammensetzung eines Ethikkomitees
- Funktionsweise eines Ethikkomitees
- Welche Ethik wird in einem Ethikkomitee vertreten?
- Das Verfahren eines Ethikkomitees aus soziologischer Sicht
- Erhaltung der sozialen Ordnung
- Untersuchung der Beobachtungsprotokolle
- Problem: Die falsche Entscheidung (Sachdimension)
- Lösungsmöglichkeiten für die Umsetzung der falschen Entscheidung
- Patientenverfügungen
- Patientenverfügung – Transparenz des Patientenwillens
- Patientenverfügung - Rechtfertigung vor den Angehörigen
- Schriftliche Fixierung des Patientenwillens - rechtlicher Beweis
- Aufklärung als Voraussetzung für die Entscheidungsfindung des Patienten
- Patientenverfügungen
- Problem: Die falsche Beziehung (Sozialdimension)
- Das Fürsorgeprinzip der Pflege
- Ärzte als Techniker
- Lösungsmöglichkeiten für die sozialdimensionalen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Patientenautonomie
- Das gute Gespräch des Seelsorgers
- Die Würde des Patienten als höchstes Gebot
- Problem: Der falsche Zeitpunkt (Zeitdimension)
- Die Notfallsituation als falscher Zeitpunkt
- Die körperliche Stabilität als Lösung
- Der falsche Zeitpunkt der Aufklärung über Patientenverfügungen
- Die Beachtung der Person als Lösung für die Probleme der Umsetzung der Patientenautonomie
- Die Funktion des klinischen Ethikkomitees in der ethischen Kommunikation
- Die ,,helle Seite" des Ethikkomitees
- Ethikkomitee als Raum zur Kommunikation und Entscheidungsfindung
- Ganzheitliche Kommunikation
- Interdisziplinarität
- Gute Entscheidungsfindung qua Verfahren
- Das Ethikkomitee als Instanz zur Feststellung von Krisensymptomen im Krankenhaus
- Die Zeit ist das Problem
- Kommunikations- und Hierarchisierungsprobleme unter dem Klinikpersonal
- Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Arzt und Patient
- Probleme im Umgang mit dem Patienten
- Ethikkomitee als Raum zur Kommunikation und Entscheidungsfindung
- Die ,,dunkle Seite" des Ethikkomitees
- Das Nicht-Bezeichnete
- Dysfunktionen des Ethikkomitees
- Einschränkung der Kommunikation durch Erhalt der krankenhausinternen Hierarchie
- Zu wenig Ethik
- Häufige Absenzen
- Das Ethikkomitee als Förderer der Patientenautonomie
- wissenschaftliches Arbeiten: Entdecken von Strukturen, die den Praktikern verborgen bleiben
- Die ,,helle Seite" des Ethikkomitees
- Auswirkungen der Wissenskluft zwischen Arzt und Patient aus soziologischer Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Patientenautonomie im Kontext der Arzt-Patienten-Beziehung und untersucht deren Auswirkungen auf die Organisation Krankenhaus. Ziel ist es, das Konzept der Patientenautonomie aus soziologischer Sicht zu beleuchten und dessen Einfluss auf die ethische Kommunikation in klinischen Ethikkomitees zu analysieren.
- Die Entwicklung der Patientenautonomie im Spannungsfeld zwischen Paternalismus und Autonomie
- Die Auswirkungen der Patientenautonomie auf die Arzt-Patienten-Beziehung und die Organisation Krankenhaus
- Die Rolle klinischer Ethikkomitees in der ethischen Kommunikation und Entscheidungsfindung
- Die Analyse der Kommunikation in Ethikkomitees anhand empirischer Beobachtungsprotokolle
- Die Herausforderungen und Chancen der Patientenautonomie im Kontext der modernen Medizin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau der Arbeit und das religionssoziologische Fundament der Untersuchung darstellt. Das zweite Kapitel widmet sich der Methode, wobei Talcott Parsons Kausalitätskonzept, Robert Mertons Dysfunktionalität sowie die funktionalistische Methode von Niklas Luhmann erläutert werden. Anschließend werden die Anwendung der funktionalen Methode zur Auswertung der Beobachtungsprotokolle sowie die Beobachtung erster und zweiter Ordnung im Detail beschrieben. Das dritte Kapitel beleuchtet die medizinsoziologischen Entwicklungen, mit Fokus auf die Deprofessionalisierung der Medizin, den Wandel der Arzt-Patienten-Beziehung und die Entstehung einer neuen Ethik in der Medizin. Im vierten Kapitel werden die Konzepte des Paternalismus und der Patientenautonomie gegenübergestellt, wobei verschiedene Arten der Patientenautonomie, wie Patientenverfügungen und Patientenbetreuer, erörtert werden. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem klinischen Ethikkomitee und dessen Zielsetzung, Zusammensetzung, Funktionsweise und ethischen Grundlagen. Im sechsten Kapitel erfolgt eine Untersuchung der Beobachtungsprotokolle, wobei verschiedene Probleme in der Umsetzung der Patientenautonomie in den Bereichen Sach-, Sozial- und Zeitdimension beleuchtet werden. Die Arbeit endet mit einer Analyse der Auswirkungen der Wissenskluft zwischen Arzt und Patient aus soziologischer Sicht.
Schlüsselwörter
Patientenautonomie, Paternalismus, Arzt-Patienten-Beziehung, Ethikkomitee, Organisation Krankenhaus, Soziologie, Beobachtungsprotokolle, Kommunikation, Deprofessionalisierung der Medizin, ethische Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Patientenautonomie?
Das Recht des Patienten, nach umfassender Aufklärung selbst über medizinische Behandlungen und Eingriffe zu entscheiden.
Welche Aufgabe hat ein klinisches Ethikkomitee?
Es berät bei ethischen Konfliktfällen im Krankenhaus, um eine für alle Beteiligten tragfähige und moralisch begründete Entscheidung zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen Paternalismus und Autonomie?
Paternalismus bedeutet, dass der Arzt „väterlich“ für den Patienten entscheidet; Autonomie stellt den Willen des Patienten in das Zentrum.
Wie helfen Patientenverfügungen im Krankenhausalltag?
Sie machen den Patientenwillen transparent, wenn dieser sich selbst nicht mehr äußern kann, und dienen als rechtliche Absicherung für Ärzte.
Was sind die „dunklen Seiten“ eines Ethikkomitees?
Die Arbeit thematisiert mögliche Dysfunktionen, wie die Zementierung bestehender Hierarchien oder eine rein pro forma geführte Ethik-Diskussion.
Warum führt die Wissenskluft zwischen Arzt und Patient zu Problemen?
Die asymmetrische Beziehung erschwert eine echte Teilhabe des Patienten an Entscheidungen, da der Arzt über das Expertenwissen verfügt.
- Die Medizin als Profession
- Citation du texte
- Kerstin Geisler (Auteur), 2004, Zur Funktion der Patientenautonomie in der ethischen Kommunikation klinischer Ethikkomitees, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31448