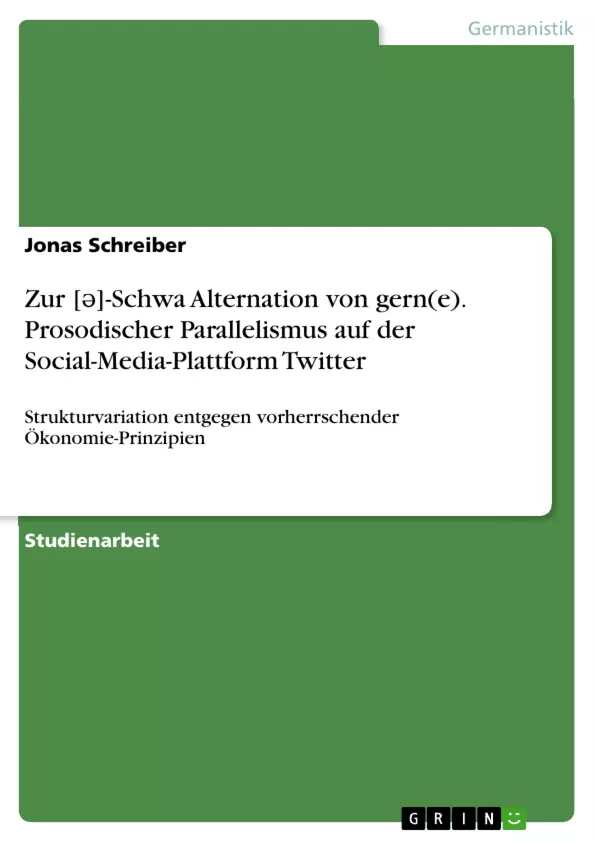Das Adverb gern(e) kommt im Standarddeutschen in zwei Varianten vor: in einer einsilbigen (gern) und in einer zweisilbigen Form (gerne), wobei letztere durch einen Schwa-Laut eine trochäische Struktur annimmt (ϭs-ϭw, ‚betont-unbetont‘). Wiese / Speyer (2015) stellen unter anderem für diese Variation hohe Frequenz-Unterschiede im gegenwärtigen Deutsch fest (ebd.:542). In ihrer Arbeit konzentrieren sie sich speziell auf das Phänomen der Schwa-Null-Alternation, wobei sie eine Untersuchung zur Distribution von Schwa- und Schwa-loser Form in Abhängigkeit der jeweiligen prosodischen Umgebung anstellen.
Wiese / Speyer (2015) betonen zunächst, dass eine Register-bedingte Variation nicht der Fall sein kann, da diese auch im Standarddeutschen vorgefunden wird (vgl. ebd.:526); Raffelsiefen (2003) bezeichnet dieses Phänomen der Distribution von Schwa- und Schwa-loser Form sogar als idiosynkratisch (vgl. ebd.:125). Auch eine andere Bedeutung oder grammatische Funktion der einsilbigen oder der zweisilbigen Form schließen Wiese / Speyer (2015) aus.
Betrachtet man das Phänomen aus diachroner Perspektive, so stellt man fest, dass diverse Lautwandelerscheinungen in der Entwicklung vom Althochdeutschen über das Mittelhochdeutsche hin zum Neuhochdeutschen diese Variation grundlegend erklären können (vgl. dazu genauer 2.), die Stabilität des Vorkommens bei-der Formen über 900 Jahre hinweg jedoch nicht (vgl. Wiese / Speyer 2015:548).
Nun ist die Schwa-lose Form ausdrucksseitig kürzer als die ursprüngliche Form mit Schwa. Man könnte also annehmen, dass dies in bestimmten Kontexten des Sprachgebrauchs dahingehend operationalisiert werden kann, um Zeit beziehungsweise Zeichen zu sparen, benutzt der Sprecher die Schwa-lose, also kürzere Form.
Die Kommunikation auf Twitter stellt einen ebensolchen Kontext da, wobei im Rahmen dieser Arbeit festgestellt werden soll, welche der beiden Formen häufiger genutzt wird und inwiefern sich der telegrammartige Stil (vgl. dazu genauer 3.) von Twitter, der auf Kürzungen und Einsparungen auf der Zeichenebene wegen der Twitter-spezifischen Restriktion der Zeichenanzahl auf 140 Zeichen beruht, darauf auswirkt; dafür werde ich im Rahmen dieser Arbeit Korpus-basierte Auswertungen anstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung von gern(e) – diachrone Perspektive
- Prosodischer Parallelismus
- Twitter-Kommunikation
- Beschreibung der Daten
- Prüfung der Hypothesen
- H1: Twitter-User verwenden gern häufiger als gerne
- H2: Die trochäische Form wird der einsilbigen Form bevorzugt
- H3: Schwa-Null-Alternation abhängig vom jeweiligen Sprecher
- H4: Prosodisch parallel konstruierten Strukturen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Variation des Adverbs „gern(e)“ im Kontext der Twitter-Kommunikation. Ziel ist es, die Häufigkeit der einsilbigen ("gern") und zweisilbigen ("gerne") Form zu analysieren und den Einfluss des telegrammartigen Stils von Twitter auf diese Variation zu untersuchen. Weiterhin wird die Abhängigkeit der Schwa-Null-Alternation vom jeweiligen Sprecher und von prosodisch parallelen Strukturen geprüft.
- Variation des Adverbs "gern(e)"
- Einfluss des Twitter-Stils auf Sprachgebrauch
- Schwa-Null-Alternation und Sprecherabhängigkeit
- Prosodischer Parallelismus und seine Auswirkungen
- Diachrone Entwicklung von "gern(e)"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schwa-Null-Alternation des Adverbs „gern(e)“ ein und stellt die Forschungsfrage nach der Häufigkeit der beiden Varianten im Kontext von Twitter dar. Sie skizziert die bisherigen Forschungsergebnisse zu Register-bedingter Variation und der idiosynkratischen Natur des Phänomens. Die Arbeit formuliert Hypothesen zu den Einflussfaktoren wie Kürze, Sprecherpräferenz und prosodischem Parallelismus und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Historische Entwicklung von gern(e) - diachrone Perspektive: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Adverbs „gern(e)“ vom Althochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen. Es beschreibt die Lautwandelprozesse, die zur Entstehung der zweisilbigen Form mit Schwa führten, und diskutiert, warum trotz dieser historischen Entwicklung beide Formen bis heute koexistieren. Es werden verschiedene Theorien zur Erklärung der anhaltenden Variation, wie Synkopen und Apokopen sowie die Tendenz zur Trochäusform im Standarddeutschen, erörtert.
Prosodischer Parallelismus: Dieses Kapitel beschreibt die Theorie des prosodischen Parallelismus, die besagt, dass die Wahl zwischen „gern“ und „gerne“ von der prosodischen Struktur der umgebenden Wörter beeinflusst wird. Es wird erläutert, wie die Wahl der einsilbigen oder zweisilbigen Form von der prosodischen Struktur vorhergehender Wörter abhängt (trochäische Struktur vs. einsilbige Wörter) und wie diese Theorie auf die Daten angewendet wird.
Twitter-Kommunikation: Das Kapitel analysiert die Besonderheiten der Kommunikation auf Twitter, insbesondere den Einfluss der Zeichenbeschränkung auf den Sprachgebrauch. Es stellt die These auf, dass der telegrammartige Stil und der Drang zur Zeichenersparnis die Präferenz für die kürzere Form "gern" begünstigt. Es wird auf die Relevanz von Twitter als Korpus für die Untersuchung der Schwa-Null-Alternation eingegangen.
Schlüsselwörter
Schwa-Null-Alternation, gern(e), Twitter, Prosodischer Parallelismus, Sprachvariation, diachrone Entwicklung, Korpuslinguistik, Sprachökonomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse der Variation von "gern(e)" in Twitter-Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Variation des Adverbs „gern(e“ im Kontext der Twitter-Kommunikation. Im Fokus steht die Analyse der Häufigkeit der einsilbigen ("gern") und zweisilbigen ("gerne") Form und der Einfluss von Faktoren wie dem telegrammartigen Stil von Twitter, Sprecherpräferenz und prosodischem Parallelismus auf diese Variation.
Welche Hypothesen werden geprüft?
Die Arbeit prüft folgende Hypothesen: H1: Twitter-User verwenden "gern" häufiger als "gerne". H2: Die trochäische Form ("gerne") wird der einsilbigen Form ("gern") bevorzugt. H3: Die Schwa-Null-Alternation ist abhängig vom jeweiligen Sprecher. H4: Prosodisch parallel konstruierte Strukturen beeinflussen die Wahl zwischen "gern" und "gerne".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur diachronen Entwicklung von "gern(e)", ein Kapitel zum prosodischen Parallelismus, ein Kapitel zur Twitter-Kommunikation, ein Kapitel zur Datenanalyse und Hypothesentestung und einen Schluss. Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen vor. Die Kapitel behandeln die historische Entwicklung, die theoretischen Grundlagen des prosodischen Parallelismus und die Besonderheiten der Twitter-Kommunikation. Abschließend werden die Ergebnisse der Datenanalyse präsentiert und interpretiert.
Welche Daten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Twitter-Daten, um die Häufigkeit der Varianten "gern" und "gerne" zu untersuchen und die oben genannten Hypothesen zu überprüfen. Eine detaillierte Beschreibung der Daten findet sich im entsprechenden Kapitel der Arbeit.
Welche Rolle spielt der prosodische Parallelismus?
Die Arbeit untersucht, ob die Wahl zwischen "gern" und "gerne" von der prosodischen Struktur der umgebenden Wörter beeinflusst wird. Die Theorie des prosodischen Parallelismus besagt, dass die Wahl der einsilbigen oder zweisilbigen Form von der prosodischen Struktur vorhergehender Wörter abhängt (trochäische Struktur vs. einsilbige Wörter).
Wie wirkt sich der Twitter-Stil auf die Sprachverwendung aus?
Die Arbeit geht davon aus, dass der telegrammartige Stil von Twitter und die Zeichenbeschränkung die Präferenz für die kürzere Form "gern" begünstigen. Die Zeichenersparnis wird als möglicher Einflussfaktor auf die Schwa-Null-Alternation betrachtet.
Welche Bedeutung hat die diachrone Perspektive?
Das Kapitel zur diachronen Entwicklung beleuchtet die historische Entwicklung von "gern(e)" vom Althochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen. Es analysiert die Lautwandelprozesse, die zur Entstehung der zweisilbigen Form führten, und diskutiert, warum beide Formen bis heute koexistieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schwa-Null-Alternation, gern(e), Twitter, Prosodischer Parallelismus, Sprachvariation, diachrone Entwicklung, Korpuslinguistik, Sprachökonomie.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der Hypothesentests zusammen und diskutiert deren Implikationen für das Verständnis von Sprachvariation und des Einflusses von online-Kommunikation auf die Sprache. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse zur Schwa-Null-Alternation im Kontext von Twitter und tragen zum Verständnis der Interaktion zwischen sprachlichen und soziolinguistischen Faktoren bei.
- Citation du texte
- Jonas Schreiber (Auteur), 2015, Zur [ǝ]-Schwa Alternation von gern(e). Prosodischer Parallelismus auf der Social-Media-Plattform Twitter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314142

![Titre: Zur [ǝ]-Schwa Alternation von gern(e). Prosodischer Parallelismus auf der Social-Media-Plattform Twitter](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/314142/large.webp)