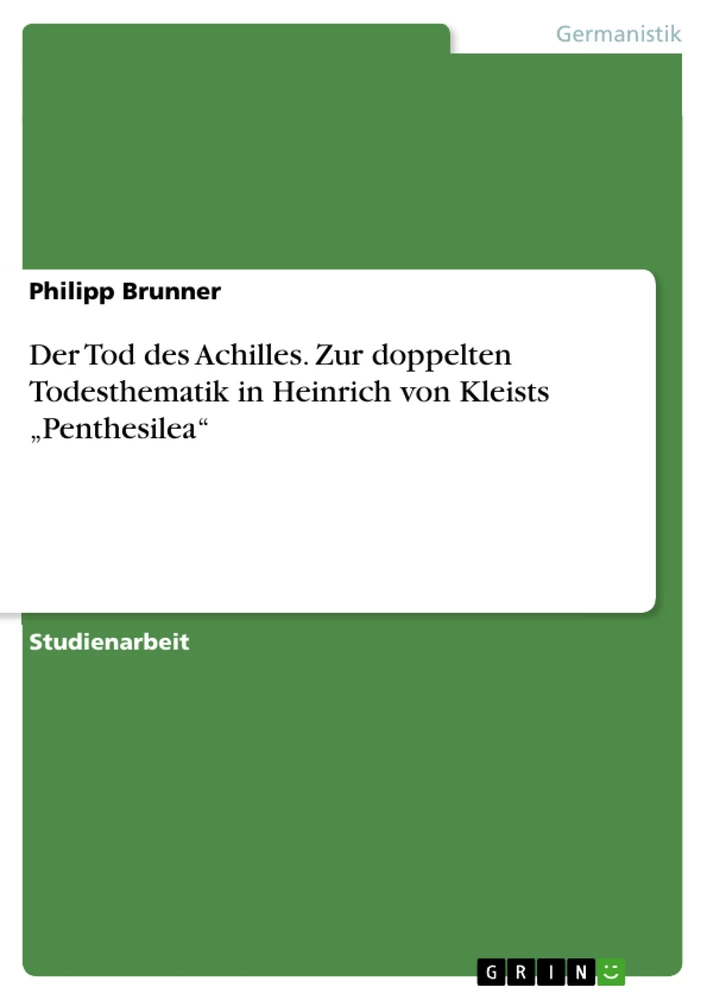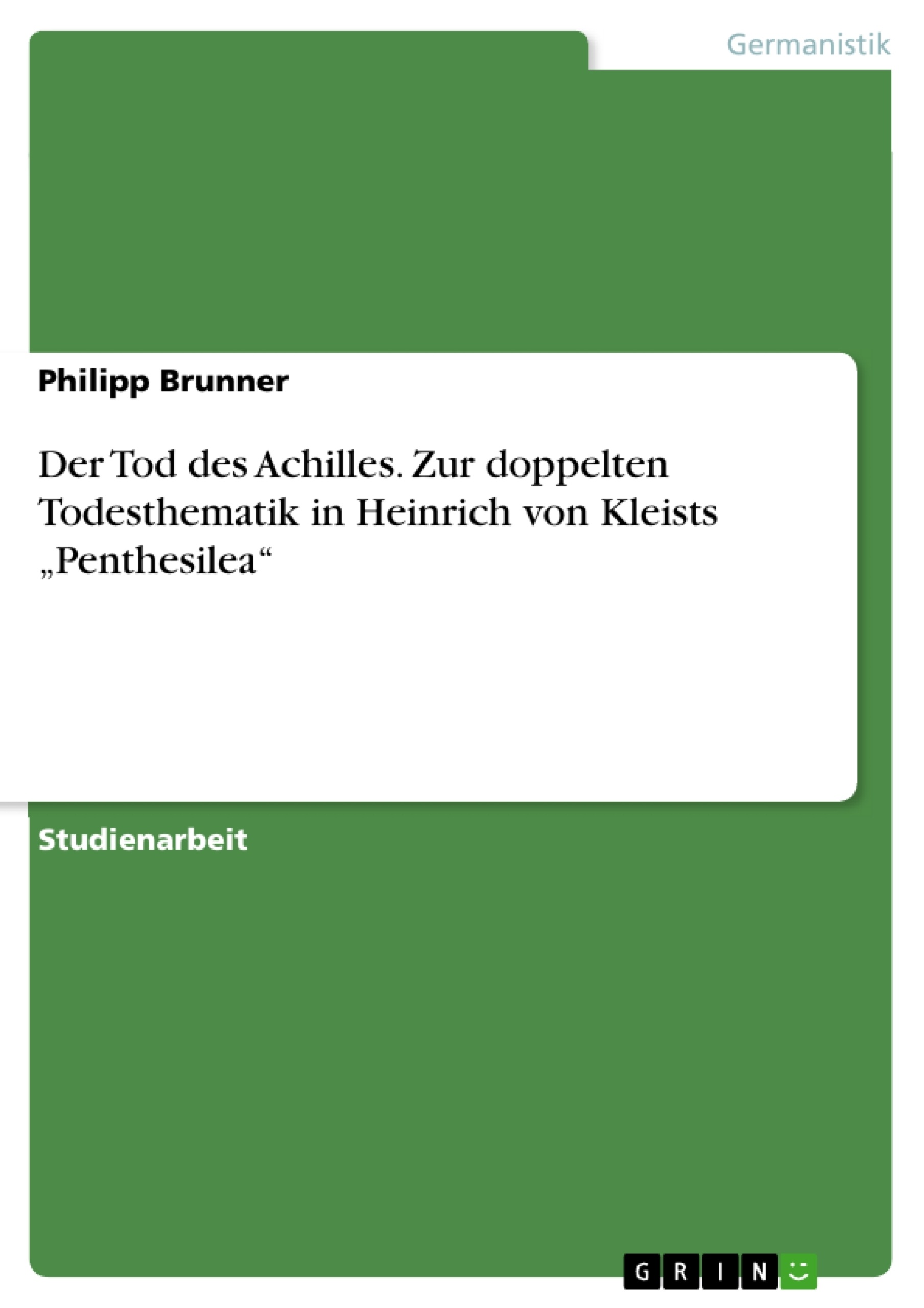Achilles ist tot – wenigstens am Schluss von Heinrich von Kleists „Penthesilea“. Achilles wird in einem kannibalischen Akt von Penthesilea aufgefressen. Vielleicht bringt sie Achilles mit der Hilfe ihrer Hundemeute aber auch nur um, wenn es heisst, „[d]ie Glieder des Achills reisst sie in Stücken!“. Gemäss der Sage gestaltet sich ebengenanntes Verhältnis jedoch ein wenig anders. Als die Amazonen auf Seiten Trojas in den Krieg eingreifen, verwundet Achilles deren Königin Penthesileia tödlich und verliebt sich dabei in die Sterbende. Das Schlachtfeld ist aber in beiden Fällen identisch: Vor den Toren Trojas tobt der Krieg, die Trojaner verteidigen sich scheinbar chancenlos gegen die Griechen. In dieser Situation eilen ihnen die Amazonen mit ihrer Königin Penthesilea zu Hilfe – wenn auch aus etwas unterschiedlichen Motiven in den beiden erwähnten Fassungen. Der Kriegsschauplatz ist blutgetränkt, die Krieger trauern um die gefallenen Freunde und bereiten sich bereits auf weitere, unausweichliche Kämpfe vor. Überall lauert der Tod.
In einem Aufsatz zum Thema „Tod und Trauer“ sagt Thomas Macho: „Der Tod ist ein widerspenstiges Thema. Seine wissenschaftliche Theoretisierung und Diskussion wird aus verschiedenen Gründen erschwert“ und nennt u.a. den Umstand, dass ein „wissenschaftlicher Blick auf Sterben und Tod nur aus einer externen Perspektive“ möglich sei. In der vorliegenden Arbeit soll auf weitere Auslegungen zur Todesthematik auf einer kulturwissenschaftlich-komparatistischen Basis eingegangen werden. Diese Darlegungen sollen als tertium comparationis für den nachfolgenden Vergleich dienen. Dabei werden – nach zwei Interpretationen des Todes des Achill in Auftritt 23 – Aspekte von Achilles’ Tod in von Kleists „Penthesilea“ untersucht und analysiert. Dabei sollen Parallelen zu von Kleists eigenen Lebensdaten nicht mit in die Diskussion einbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Im Tod ist auch der Tote tot.
- Der Tod: Einige kulturtheoretische Überlegungen
- Das brutale Ende in Kleists „Penthesilea“.
- Die Ermordung des Achilles als kannibalischer Akt
- Die Ermordung des Achilles aus Liebe
- Schlussbemerkungen..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die doppelte Todesthematik in Heinrich von Kleists „Penthesilea“ zu beleuchten und zu analysieren. Insbesondere wird untersucht, wie der Tod des Achilles in zwei verschiedenen Interpretationen dargestellt wird: einerseits als kannibalischer Akt und andererseits als Folge von Penthesileas Liebe.
- Die Darstellung des Todes in der Literatur
- Der Tod als kulturelles Phänomen
- Die Rolle des Wissens und der Sterblichkeit
- Die Bedeutung von Kultur im Umgang mit dem Tod
- Die Interpretation des Todes in Kleists „Penthesilea“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den Tod des Achilles in Kleists „Penthesilea“. Das zweite Kapitel befasst sich mit kulturtheoretischen Überlegungen zum Tod. Dabei wird die ambivalente Haltung des Menschen gegenüber dem Tod beleuchtet und die Rolle von Wissen und Kultur im Umgang mit der Sterblichkeit hervorgehoben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Tod, Sterblichkeit, Kultur, Wissen, "Penthesilea", Heinrich von Kleist, Kannibalismus, Liebe, Mythos, Todesthematik, Kulturwissenschaft, Literatur, Interpretation, Anthropologie.
- Quote paper
- BA Philipp Brunner (Author), 2010, Der Tod des Achilles. Zur doppelten Todesthematik in Heinrich von Kleists „Penthesilea“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313614