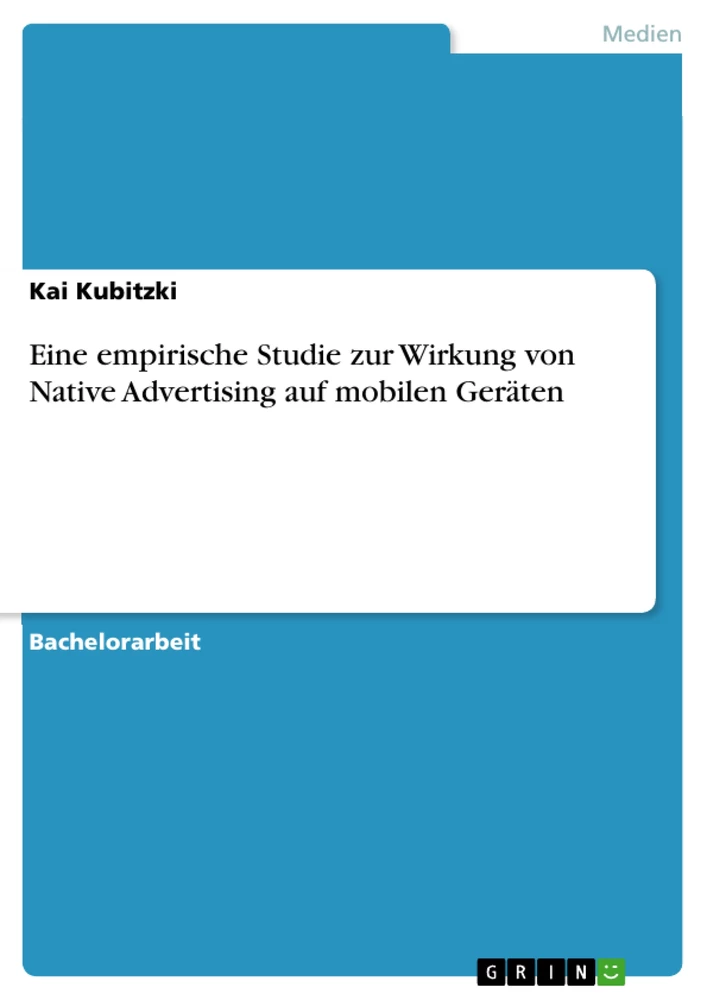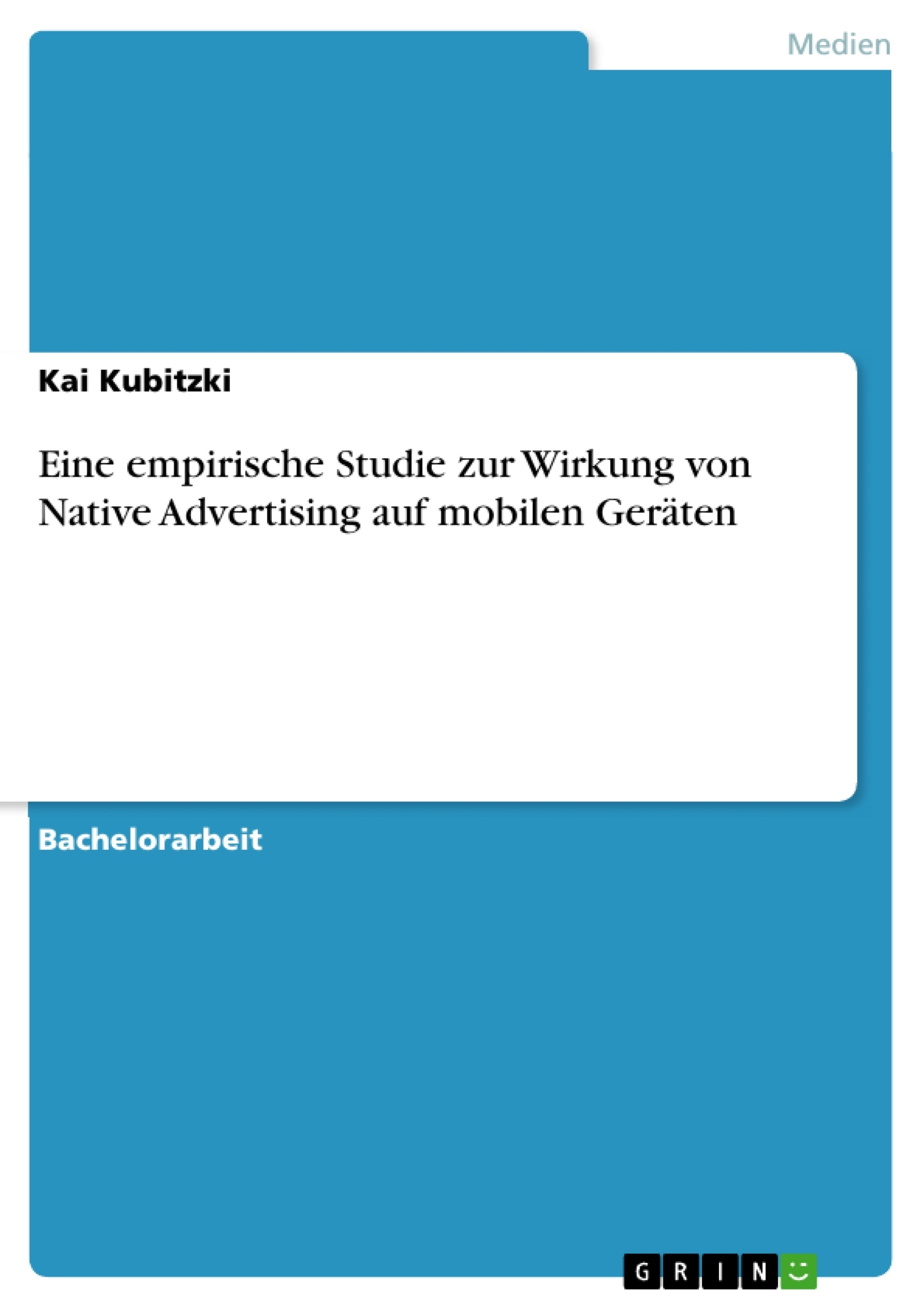Werbung beginnt Geschichten zu erzählen und es entstehen laufend neue Werbeformen. Eine dieser neuen Werbeformen ist Native Advertising, also Werbung im natürlichen Umfeld. Dabei werden Werbeinhalte als journalistische Inhalte getarnt und in das Umfeld redaktioneller Beiträge eingebettet. Digitales Dialogmarketing steht in Anbetracht der Reaktanz gegenüber Online-Werbung vor der Herausforderung, User effizient zu erreichen. Native Advertising soll gegenüber der schlechten Performance von Display Ads Abhilfe schaffen und mit Inhalten Mehrwerte bieten. Zudem wollen Publisher und Werbungtreibende mit Native Advertising auch das Smartphone erobern. Die Budgets für Native Advertising im Mobile-Bereich werden sich 2015 weltweit verdoppeln. Das Segment wird im aktuellen Jahr also 13% des gesamten globalen Budgets für Mobile-Werbung stellen.
Die Werbeform hat das Ziel sich derart an die Umgebung anzupassen, dass die Werbung nicht mehr als solche erkennbar ist. Dieser Pluspunkt ist zugleich aber auch die eigentliche Schwäche dieser Werbeform, denn dadurch findet keine klare Abgrenzung mehr zwischen redaktionellen und werblichen Inhalten statt. Dies führt zu einiger Kritik an der Werbeform. Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden in welcher Ausprägung die Abgrenzung zwischen redaktionellen und werblichen Inhalten bei der Werbeform Native Advertising erfolgen muss, um ein optimales Gleichgewicht zwischen der Klickrate und der positiven Bewertung dieser Werbeform zu erreichen.
Zur theoretischen Grundlage der empirischen Studie werden zuerst wichtige Begriffe definiert und die Rahmenbedingungen zur rechtlichen Regulierung von Native Advertising, sowie die Entwicklung des Online-Marketings dargestellt. Anschließend werden Modelle, Indikatoren und angewandte Messverfahren der Werbewirkungsforschung erläutert. Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes zum Thema Native Advertising wird eine Forschungslücke definiert, woraus Hypothesen zur Beantwortung der gebildeten Forschungsfrage abgeleitet werden. Diese werden dann anhand geeigneter Indikatoren untersucht. Das Forschungsdesign wird erläutert und anschließend werden die gewonnenen Daten dargestellt und analysiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehen und Gliederung der Arbeit
- 2. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Diskussion wichtiger Begriffe
- 2.1.1 Online-Marketing
- 2.1.2 Content-Marketing
- 2.1.3 Native Advertising
- 2.1.4 Mobile Endgeräte
- 2.1.5 Werbewirkung
- 2.1.6 Glaubwürdigkeit im journalistischen Kontext
- 2.2 Rahmenbedingungen und Entwicklungen
- 2.2.1 Rechtliche Aspekte zur Regulierung von Native Advertising
- 2.2.2 Aktuelle Entwicklungen des Online / Mobile Marketing und die daraus resultierenden Herausforderungen für Publisher von journalistischen Inhalten
- 2.3 Werbewirkungsmessung im Kontext von Native Advertising
- 2.3.1 Erklärungstheoretische Modelle der Werbewirkungsforschung
- 2.3.2 Operationalisierung der Werbewirkung
- 2.3.3 Werbeerfolgsmessung mit der Messmethode Eyetracking
- 3. Forschungsstand und Herleitung der Forschungsfrage
- 3.1 Aktueller Forschungsstand
- 3.2 Abgrenzung des Forschungsfeldes
- 3.3 Herleitung und Darstellung der Forschungsfrage und den daraus abgeleiteten Hypothesen
- 4. Empirische Untersuchung
- 4.1 Untersuchungsdesign
- 4.1.1 Wahl der Methode
- 4.1.2 Auswahl des Untersuchungsgegenstandes
- 4.1.3 Auswahl der Probanden
- 4.2 Durchführung der Untersuchung
- 4.2.1 Untersuchungssaufbau des Eyetrackings
- 4.2.2 Konzipierung und Aufbau des Fragebogens
- 4.3 Darstellung der Ergebnisse
- 4.4 Diskussion der Ergebnisse und Kritik am Untersuchungsaufbau
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Native Advertising, einer neuen Form der Online-Werbung, die sich durch ihre Integration in journalistische Inhalte auszeichnet. Ziel der Arbeit ist es, die Wirkung von Native Advertising auf mobilen Geräten zu untersuchen und deren Einfluss auf die Glaubwürdigkeit im journalistischen Kontext zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung von Native Advertising im Vergleich zu anderen Werbeformen
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und ethischen Herausforderungen von Native Advertising
- Untersuchung der Werbewirkung von Native Advertising anhand des Elaboration Likelihood Model und der Messmethode Eyetracking
- Bedeutung von Mobile Devices im Kontext von Native Advertising und deren Einfluss auf das Nutzerverhalten
- Glaubwürdigkeit und Vertrauen in journalistische Inhalte im Kontext von Native Advertising
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die Zielsetzung und die Gliederung der Arbeit darlegt. Anschließend werden in Kapitel 2 die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen von Native Advertising, Online-Marketing und Content-Marketing beleuchtet. Die rechtlichen Aspekte und aktuelle Entwicklungen im Bereich von Native Advertising werden ebenfalls in diesem Kapitel erörtert. Kapitel 3 behandelt den aktuellen Forschungsstand zu Native Advertising und leitet die Forschungsfrage sowie die Hypothesen ab. Die empirische Untersuchung in Kapitel 4 beinhaltet die Beschreibung des Untersuchungsdesigns, die Durchführung der Untersuchung mit der Methode Eyetracking sowie die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse. Abschließend bietet Kapitel 5 ein Fazit der Arbeit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Native Advertising, Online-Marketing, Mobile Advertising, Werbewirkung, Glaubwürdigkeit, Eyetracking, Journalismus, Content-Marketing und Mediennutzung.
- Quote paper
- Kai Kubitzki (Author), 2015, Eine empirische Studie zur Wirkung von Native Advertising auf mobilen Geräten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313452