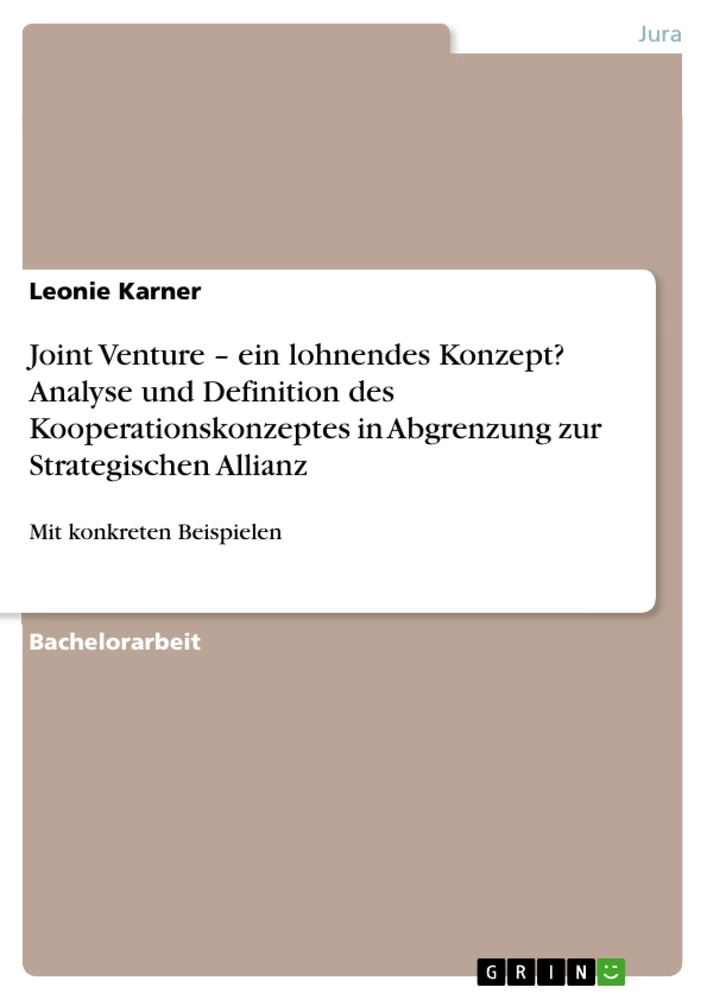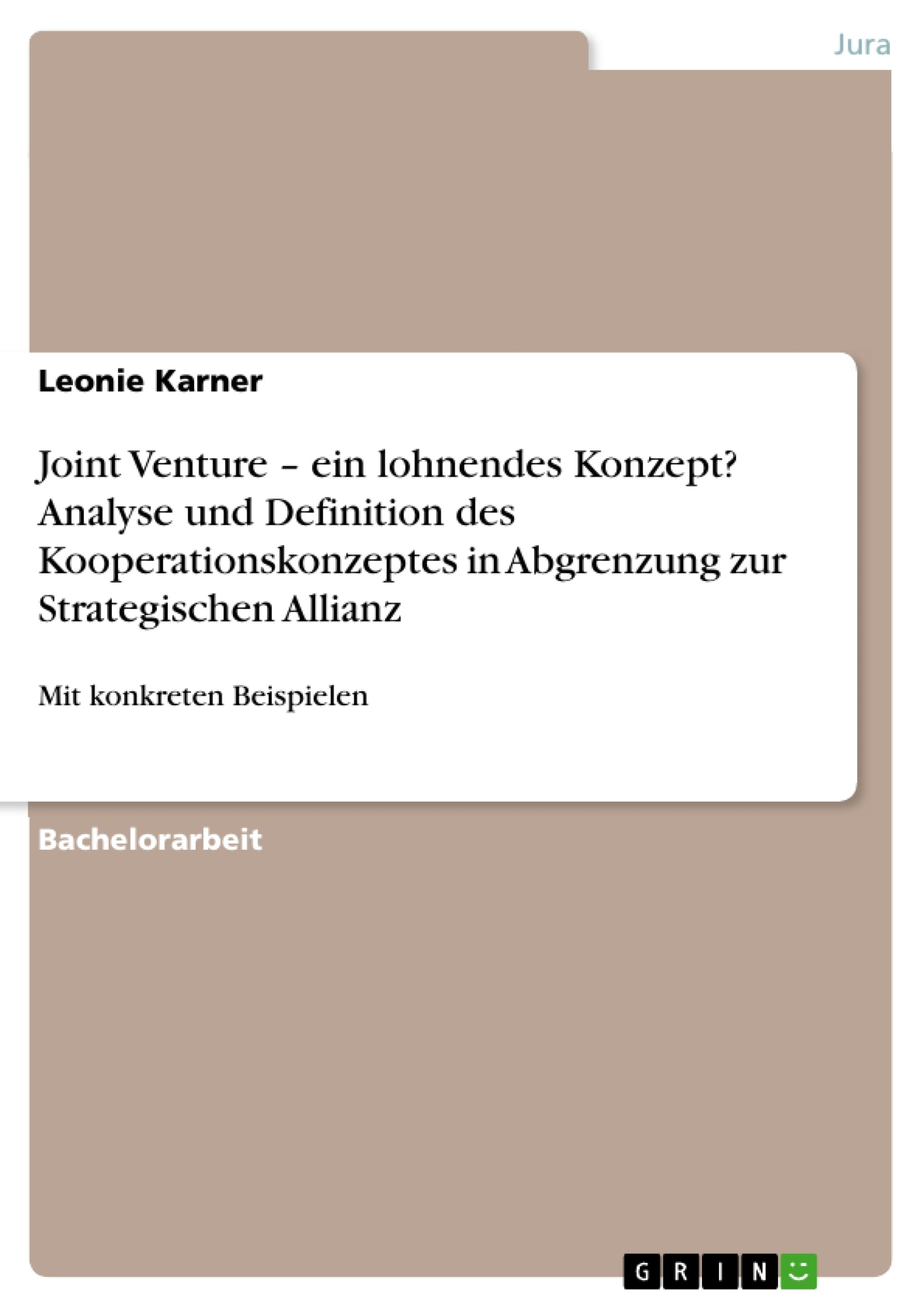Gegenstand der Arbeit ist die Untersuchung des Joint Venture im Vergleich zur Strategischen Allianz. Die Arbeit ist damit dem Fachgebiet des Handels- und Gesellschaftsrechts zuzuordnen und wird sich mit unternehmerischen internationalen Joint Ventures befassen und diejenigen auf den Gebieten Forschung und Wissenschaft nur am Rande betrachten.
Nachdem zunächst die Einordnung von Kooperationen als Form von Internationalisierungsstrukturen angesichts der Herausforderungen des globalen Marktes analysiert wird, beschäftigt sich die Arbeit mit den juristischen Grundlagen von Strategischer Allianz und Joint Venture. Hierbei werden die jeweiligen Erscheinungsformen, die Motive und die Vor- und Nachteile detailliert dargestellt. Aus den ermittelten wesentlichen Erfolgsfaktoren, belegt durch eine intensive Analyse von zwei Praxisbeispielen, können für die Überlegung zur Gründung eines Joint Ventures wertvolle Hinweise gegeben werden. Da jedes Joint Venture von unterschiedlichen Faktoren motiviert ist, lässt sich jedoch kein allgemeingültiges Konzept ableiten. Darum wurde auch auf die Darstellung eines verbindlichen Konzeptes, z. B. in Form eines Fragebogens, Muster-Checks oder ähnliches, verzichtet. Es werden lediglich Hinweise gegeben, unter Beachtung welcher Bedingungen sich ein Joint Venture erfolgreich gestalten lässt.
Wesentliche Bedeutung für die Arbeit hatte die Herausarbeitung einer für die Rechtswissenschaften empfehlenswerten Definition eines „Joint Venture“. Diese wurde in Anlehnung an bereits vorhandene wirtschaftswissenschaftliche Definitionen und in Abgrenzung zur Strategischen Allianz vorgenommen.
Die Arbeit kommt zu folgendem Schluss: Wenn bei der Vertragsanbahnung und -abschluss die noch darzustellenden Erfolgsfaktoren Berücksichtigung gefunden haben, stellt ein Joint Venture eine durchaus lohnenswerte alternative Kooperationsform zur Strategischen Allianz dar. Der Erfolg lässt sich neben den eindeutigen, das heißt messbaren wirtschaftlichen Faktoren (z. B. Gewinn, Verlust, Return on Investment), aus Sicht der Rechtswissenschaft nur in eher weichen Faktoren formulieren, z. B.:
• Geringer nachgängiger Regelungsbedarf;
• Geringe bis keine juristische Auseinandersetzung;
• Gelebtes Änderungs- und Nachtragsmanagement.
Diese Arbeit wird versuchen die unterschiedlichen Sichtweisen zu kombinieren und daraus ein einheitliches Bild und klare Empfehlungen zu zeichnen bzw. abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Überblick der Internationalisierungsstrukturen
- I. Globalisierung und Internationalisierung der Wirtschaft
- II. Kooperationsformen als Internationalisierungsstrukturen
- C. Die Strategische Allianz
- I. Begriffliche Grundlagen
- II. Rechtliche Grundlagen Strategischer Allianzen
- III. Vor- und Nachteile Strategischer Allianzen
- 1. Vorteile und mögliche Motive
- 2. Nachteile und mögliche Probleme
- D. Das Joint Venture
- I. Begriffliche Grundlagen
- II. Erscheinungsformen
- 1. Anzahl der Kooperationspartner
- 2. Position der Wertschöpfungskette
- 3. Kooperationsrichtung
- 4. Internationalität
- 5. Kapitalbeteiligung
- 6. Zeitlicher Horizont
- III. Vertragliche Gestaltung von Joint Ventures
- 1. Joint Venture Vertrag
- 2. Gesellschaftsvertrag
- IV. Motive
- 1. Interne Dimension
- 2. Wettbewerbsbezogene Dimension
- 3. Strategische Dimension
- V. Nachteile und Risiken als Gründe für ein mögliches Scheitern
- 1. Allgemeine Nachteile und Risiken
- 2. Die richtige Partnerwahl
- E. Abgrenzung: Strategische Allianz - Joint Venture
- I. Gemeinsamkeiten von Strategischen Allianzen und Joint Ventures
- II. Unterschiede der beiden Kooperationsformen
- III. Definition „Joint Venture“
- F. Erfolgsfaktoren eines Joint Ventures
- I. Der Erfolgsbegriff
- II. Die Erfolgsfaktoren
- 1. Interne Erfolgsfaktoren
- 2. Externe Erfolgsfaktoren
- G. Analyse der Praxisbeispiele
- I. Erfolgreiche Kooperation: WINGAS GmbH & Co. KG
- 1. Allgemeine Informationen
- 2. Asset-Tausch zwischen OAO GAZPROM und BASF SE
- 3. Konkrete Erfolgsfaktoren des WINGAS Joint Ventures
- II. Gescheiterte Kooperation: Fujitsu Siemens Computers GmbH
- 1. Allgemeine Informationen
- 2. Das Scheitern von Fujitsu Siemens Computers GmbH
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Kooperationskonzept „Joint Venture“ und grenzt es von der Strategischen Allianz ab. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile beider Konzepte zu beleuchten und anhand konkreter Beispiele deren Erfolgspotential zu untersuchen. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis für die Struktur und die Erfolgsfaktoren von Joint Ventures vermitteln.
- Begriffliche Abgrenzung von Joint Venture und Strategischer Allianz
- Rechtliche Grundlagen und vertragliche Gestaltung von Joint Ventures
- Interne und externe Erfolgsfaktoren von Joint Ventures
- Analyse erfolgreicher und gescheiterter Joint Ventures anhand von Praxisbeispielen
- Motive und Risiken im Kontext von Joint Ventures
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein. Es beschreibt die Problemstellung, welche die Analyse und Definition des Joint Venture-Konzeptes im Vergleich zur Strategischen Allianz betrifft, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
B. Überblick der Internationalisierungsstrukturen: Der Abschnitt gibt einen Überblick über die Globalisierung und Internationalisierung der Wirtschaft, bevor er verschiedene Kooperationsformen als wichtige Internationalisierungsstrategien einordnet. Dies bildet die Grundlage für das tiefere Verständnis der Strategischen Allianz und des Joint Ventures in den folgenden Kapiteln.
C. Die Strategische Allianz: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Strategischen Allianz, beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und analysiert ausführlich die Vor- und Nachteile solcher Kooperationen. Es werden mögliche Motive für die Bildung einer Strategischen Allianz erörtert, aber auch potenzielle Probleme und Risiken angesprochen, um ein ganzheitliches Bild zu bieten. Der Abschnitt dient als wichtiger Vergleichspunkt für das anschließende Kapitel über Joint Ventures.
D. Das Joint Venture: Dieses Kernkapitel befasst sich umfassend mit dem Joint Venture. Es definiert den Begriff, analysiert verschiedene Erscheinungsformen hinsichtlich der Anzahl der Partner, der Position in der Wertschöpfungskette, der Kooperationsrichtung, der Internationalität und der Kapitalbeteiligung. Die vertragliche Gestaltung durch Joint-Venture-Verträge und Gesellschaftsverträge wird ebenso detailliert beleuchtet wie die Motive (interne, wettbewerbsbezogene und strategische Dimensionen) für die Bildung eines Joint Ventures und die potenziellen Nachteile und Risiken, die zum Scheitern führen können. Das Kapitel legt einen Schwerpunkt auf die vielschichtigen Aspekte des Joint Venture-Konzeptes.
E. Abgrenzung: Strategische Allianz - Joint Venture: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die klare Unterscheidung zwischen Strategischen Allianzen und Joint Ventures. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt, um eine präzise Definition des Joint Ventures zu ermöglichen und die beiden Kooperationsformen klar voneinander abzugrenzen. Die Unterschiede in rechtlichen und organisatorischen Aspekten werden besonders hervorgehoben.
F. Erfolgsfaktoren eines Joint Ventures: Hier wird der Begriff „Erfolg“ im Kontext von Joint Ventures definiert und die relevanten Erfolgsfaktoren analysiert. Das Kapitel differenziert zwischen internen und externen Faktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg eines Joint Ventures beitragen. Diese Unterscheidung ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der Einflussgrößen.
G. Analyse der Praxisbeispiele: In diesem Kapitel werden zwei Praxisbeispiele analysiert – eine erfolgreiche (WINGAS GmbH & Co. KG) und eine gescheiterte (Fujitsu Siemens Computers GmbH) Kooperation. Die detaillierte Untersuchung dieser Fallstudien verdeutlicht die in den vorherigen Kapiteln erörterten theoretischen Konzepte und zeigt, wie Erfolgsfaktoren in der Praxis zum Tragen kommen oder eben fehlen. Die Gegenüberstellung dient dem Vergleich und soll Schlussfolgerungen über den Erfolg von Joint Ventures ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Strategische Allianzen und Joint Ventures
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit analysiert das Kooperationskonzept „Joint Venture“ und grenzt es von der Strategischen Allianz ab. Ziel ist es, Vor- und Nachteile beider Konzepte zu beleuchten und anhand konkreter Beispiele deren Erfolgspotential zu untersuchen. Die Arbeit vermittelt ein umfassendes Verständnis für die Struktur und die Erfolgsfaktoren von Joint Ventures.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Abgrenzung von Joint Venture und Strategischer Allianz, rechtliche Grundlagen und vertragliche Gestaltung von Joint Ventures, interne und externe Erfolgsfaktoren von Joint Ventures, Analyse erfolgreicher und gescheiterter Joint Ventures anhand von Praxisbeispielen sowie Motive und Risiken im Kontext von Joint Ventures.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Überblick der Internationalisierungsstrukturen, Strategische Allianzen, Joint Ventures (inklusive Begriff, Erscheinungsformen, Vertragsgestaltung, Motive, Nachteile und Risiken), Abgrenzung Strategische Allianz – Joint Venture, Erfolgsfaktoren von Joint Ventures und Analyse von Praxisbeispielen (WINGAS GmbH & Co. KG als erfolgreiches und Fujitsu Siemens Computers GmbH als gescheitertes Beispiel).
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen einer Strategischen Allianz und einem Joint Venture?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Kooperationsformen. Der Fokus liegt auf der rechtlichen und organisatorischen Abgrenzung, um eine präzise Definition des Joint Ventures zu ermöglichen.
Welche Erfolgsfaktoren für Joint Ventures werden analysiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen internen und externen Erfolgsfaktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg eines Joint Ventures beitragen. Diese werden detailliert untersucht, um ein umfassendes Bild der Einflussgrößen zu liefern.
Welche Praxisbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die WINGAS GmbH & Co. KG als Beispiel für ein erfolgreiches und die Fujitsu Siemens Computers GmbH als Beispiel für ein gescheitertes Joint Venture. Die detaillierte Untersuchung dieser Fallstudien verdeutlicht die theoretischen Konzepte und zeigt, wie Erfolgsfaktoren in der Praxis zum Tragen kommen oder fehlen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen Strategischer Allianzen und die vertragliche Gestaltung von Joint Ventures, inklusive Joint-Venture-Verträgen und Gesellschaftsverträgen.
Welche Motive und Risiken werden im Zusammenhang mit Joint Ventures betrachtet?
Die Arbeit erörtert interne, wettbewerbsbezogene und strategische Motive für die Bildung von Joint Ventures und analysiert potenzielle Nachteile und Risiken, die zum Scheitern führen können. Die richtige Partnerwahl wird als besonders kritischer Faktor hervorgehoben.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels, die die behandelten Inhalte und Schwerpunkte prägnant zusammenfassen.
- Quote paper
- Leonie Karner (Author), 2013, Joint Venture – ein lohnendes Konzept? Analyse und Definition des Kooperationskonzeptes in Abgrenzung zur Strategischen Allianz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312000