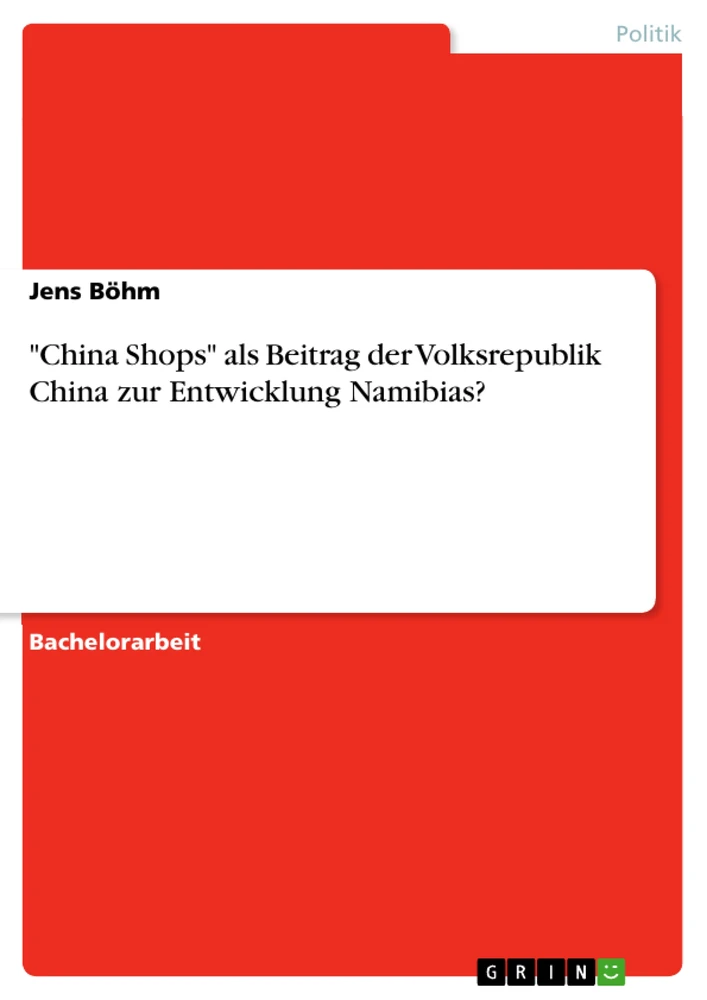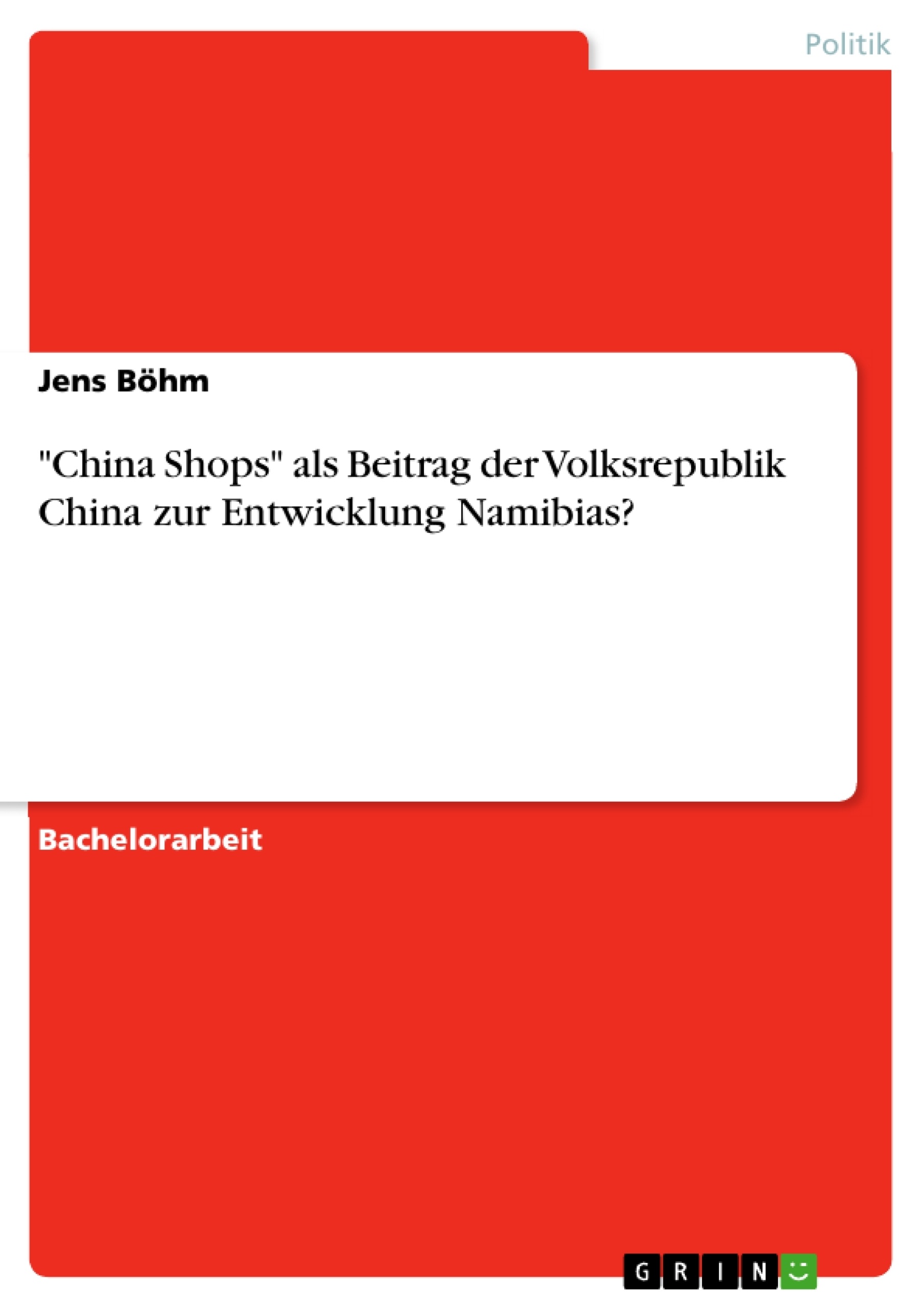Die europäische und internationale Entwicklungshilfe setzt sich seit Jahrzehnten mit der Förderung des afrikanischen Kontinents auseinander. Trotz dieser Bemühungen befindet sich in Afrika die größte Anzahl der failed states.
Während sich die westliche Hemisphäre nach der Beendigung des Kalten Krieges anderen Schwerpunkten widmet, intensiviert China seine Bemühungen im wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Sektor. China bietet ein attraktives Gegenmodell zu den sanktionierten Forderungen des Westens. Während der westliche Ansatz die good gouvernance-Strategie verfolgt, setzt China auf die Politik der strikten Nichteinmischung.
Die unterschiedliche Herangehensweise beider Akteure hat sowohl positive als auch negative Folgen für die afrikanischen Staaten. Ziel dieser Arbeit soll es sein herauszufinden, ob das chinesische Modell der Entwicklungshilfe, Handel und Investitionen, nach dem oben genannten Prinzip der Nichteinmischung, die Entwicklung von Demokratie und Menschenrechten gefährdet oder stimuliert.
Dabei erfolgt die Auseinandersetzung dieser Problematik mit dem theoretischen Ansatz des good-gouvernance-Konzepts. Auf Grundlage von politischen Dokumenten wie den chinesischen Weißbüchern und der Auswertung von Primär- und Sekundärliteratur soll die sino-afrikanische Kooperation näher betrachtet werden.
Afrika ist durch Vielfalt gekennzeichnet, ebenso ist das chinesische Engagement in Afrika durch diese Vielfalt geprägt. Die Fülle allein würde den Rahmen der Arbeit erheblich sprengen, lediglich Angola wird im Rahmen des dritten Kapitels genannt, um das Set der chinesischen Entwicklungsstrategien näher zu erläutern. Wenn in dieser Arbeit von Afrika gesprochen wird, so werden lediglich Länder südlich der Sahara gemeint sein, von denen eine Vielzahl auf Entwicklungshilfe angewiesen ist. Die direkte Konkurrenz des westlichen Modells der Entwicklungshilfe und des chinesischen Pendants haben einen wesentlichen Einfluss auf die good gouvernance in Afrika.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Eine alte Freundschaft lebt wieder auf“ - Chinas Reorientierung nach Afrika
- 2.1 Historie in Kurzform
- 2.2 Die Prinzipien der chinesischen Auslandshilfe
- 2.2.1 Politische Strategien
- 2.2.2 Wirtschaftliche Strategien
- 3. Institutionen und Instrumentarien der chinesischen Afrikapolitik
- 3.1 Institutionen und Organisationen der chinesischen Entwicklungshilfe
- 3.2 Die Finanzierung der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit
- 4. Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika
- 4.1 Allgemeine Auswirkungen
- 4.2 Auswirkungen der Konsumgüterausfuhr nach Afrika
- 5. Fallstudie: „China Shops“ in Namibia
- 5.1 Länderprofil Namibia
- 5.2 Die Beziehungen zwischen China und Namibia
- 5.3 „China Shops“ in Namibia
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die chinesische Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, insbesondere deren Auswirkungen und Strategien. Der Fokus liegt auf der Analyse der chinesischen Durchdringung des afrikanischen Kontinents und den Zielen dieser Politik. Eine Fallstudie zu „China Shops“ in Namibia dient als konkretes Beispiel zur Veranschaulichung der theoretischen Ergebnisse.
- Chinas Reorientierung nach Afrika und die historischen Hintergründe
- Die Prinzipien der chinesischen Auslandshilfe (politische und wirtschaftliche Strategien)
- Institutionen und Instrumentarien der chinesischen Afrikapolitik
- Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika
- Fallstudie: „China Shops“ in Namibia und deren Bedeutung im Kontext der chinesischen Entwicklungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Entwicklungshilfepolitik im Allgemeinen und positioniert die Arbeit im Kontext der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Sie betont die begrenzte vorhandene Literatur, insbesondere zu Namibia, und benennt wichtige Quellen für die Untersuchung, darunter Aufsätze von Jauch/Sakaria und Dobler, die Interviews mit Betroffenen enthalten. Die Arbeit fokussiert sich auf die chinesische Entwicklungshilfe und analysiert deren Maßnahmen, Ziele und Auswirkungen in Afrika, mit einem Schwerpunkt auf der Fallstudie zu „China Shops“ in Namibia als Vergleich zwischen Theorie und Praxis.
2. „Eine alte Freundschaft lebt wieder auf“ – Chinas Reorientierung nach Afrika: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Afrika, beginnend mit frühen Kontakten bis hin zur intensivierten Zusammenarbeit in den 1990er Jahren. Es betont Chinas Wandel vom Rohstoffexporteur zum -importeur und die daraus resultierende Hinwendung zu Afrika als Rohstoffquelle. Die gemeinsame koloniale Vergangenheit wird als Grundlage für die gleichberechtigten Beziehungen zwischen China und afrikanischen Staaten hervorgehoben. Das zunehmende Handelsvolumen und die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen durch China werden als wichtige Aspekte der chinesischen Afrikapolitik dargestellt.
3. Institutionen und Instrumentarien der chinesischen Afrikapolitik: Dieses Kapitel (auf Basis des Inhaltsverzeichnisses vermutet) wird vermutlich die Institutionen und Organisationen (z.B. MOFCOM, MOFA, MOF, China EXIM Bank) beschreiben, die an der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sind, sowie die Finanzierungsmechanismen der chinesischen Entwicklungshilfe.
4. Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika: Dieses Kapitel (auf Basis des Inhaltsverzeichnisses vermutet) wird voraussichtlich die generellen und spezifischen Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika untersuchen, beispielsweise die Auswirkungen auf den Konsumgütermarkt.
5. Fallstudie: „China Shops“ in Namibia: Diese Fallstudie wird sich eingehend mit dem Phänomen der „China Shops“ in Namibia auseinandersetzen. Sie wird das Länderprofil Namibias skizzieren, die Beziehungen zwischen China und Namibia (politisch, wirtschaftlich, im Bereich Bildung, Kultur und Gesundheit) analysieren und den Zusammenhang zwischen den „China Shops“ und der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit untersuchen. Der Fokus liegt auf der Wirkung der „China Shops“ in Namibia, sowohl positiv als auch negativ.
Schlüsselwörter
Chinesische Entwicklungszusammenarbeit, Afrika, Namibia, „China Shops“, Rohstoffe, Auslandshilfe, politische Strategien, wirtschaftliche Strategien, Institutionen, Finanzierungsmechanismen, Auswirkungen, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Chinesische Entwicklungszusammenarbeit in Afrika - Fallstudie Namibia
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die chinesische Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, insbesondere deren Auswirkungen und Strategien. Der Fokus liegt auf der Analyse der chinesischen Durchdringung des afrikanischen Kontinents und den Zielen dieser Politik. Eine Fallstudie zu „China Shops“ in Namibia dient als konkretes Beispiel zur Veranschaulichung der theoretischen Ergebnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Afrika, die Prinzipien der chinesischen Auslandshilfe (politische und wirtschaftliche Strategien), die beteiligten Institutionen und Finanzierungsmechanismen, die Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika und eine detaillierte Fallstudie zu den „China Shops“ in Namibia.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Chinas Reorientierung nach Afrika, Institutionen und Instrumentarien der chinesischen Afrikapolitik, Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika, Fallstudie: „China Shops“ in Namibia und Resümee. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detaillierter beschrieben.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Chinas Reorientierung nach Afrika"?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Afrika von den frühen Kontakten bis zur intensivierten Zusammenarbeit in den 1990er Jahren. Es betont Chinas Wandel vom Rohstoffexporteur zum -importeur und die daraus resultierende Hinwendung zu Afrika als Rohstoffquelle. Die gemeinsame koloniale Vergangenheit und die gleichberechtigten Beziehungen zwischen China und afrikanischen Staaten werden hervorgehoben. Das zunehmende Handelsvolumen und die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen werden als wichtige Aspekte dargestellt.
Welche Institutionen und Instrumentarien werden behandelt?
Dieses Kapitel (auf Basis des Inhaltsverzeichnisses vermutet) beschreibt die Institutionen und Organisationen (z.B. MOFCOM, MOFA, MOF, China EXIM Bank), die an der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sind, sowie die Finanzierungsmechanismen der chinesischen Entwicklungshilfe.
Welche Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe werden analysiert?
Dieses Kapitel (auf Basis des Inhaltsverzeichnisses vermutet) untersucht die generellen und spezifischen Auswirkungen der chinesischen Entwicklungshilfe auf Afrika, beispielsweise die Auswirkungen auf den Konsumgütermarkt.
Was ist der Fokus der Fallstudie zu den "China Shops" in Namibia?
Die Fallstudie analysiert eingehend das Phänomen der „China Shops“ in Namibia. Sie skizziert das Länderprofil Namibias, analysiert die Beziehungen zwischen China und Namibia (politisch, wirtschaftlich, im Bereich Bildung, Kultur und Gesundheit) und untersucht den Zusammenhang zwischen den „China Shops“ und der chinesischen Entwicklungszusammenarbeit. Der Fokus liegt auf der Wirkung der „China Shops“, sowohl positiv als auch negativ.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chinesische Entwicklungszusammenarbeit, Afrika, Namibia, „China Shops“, Rohstoffe, Auslandshilfe, politische Strategien, wirtschaftliche Strategien, Institutionen, Finanzierungsmechanismen, Auswirkungen, Fallstudie.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit nennt explizit Aufsätze von Jauch/Sakaria und Dobler, die Interviews mit Betroffenen enthalten, als wichtige Quellen. Weitere Quellen sind implizit im Text enthalten.
- Quote paper
- Jens Böhm (Author), 2015, "China Shops" als Beitrag der Volksrepublik China zur Entwicklung Namibias?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309127