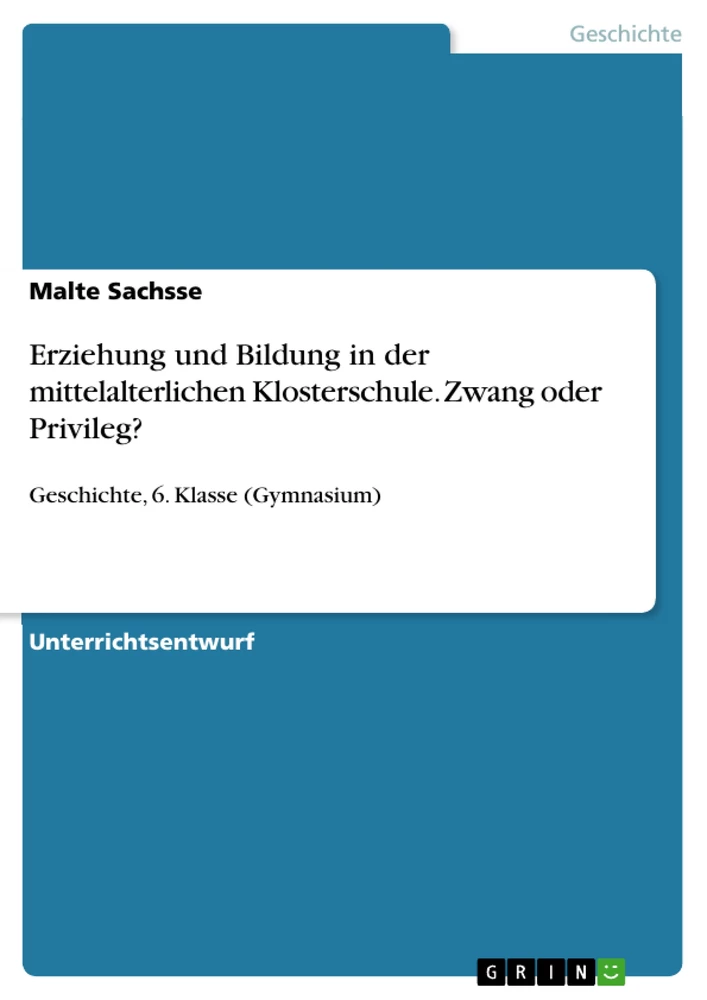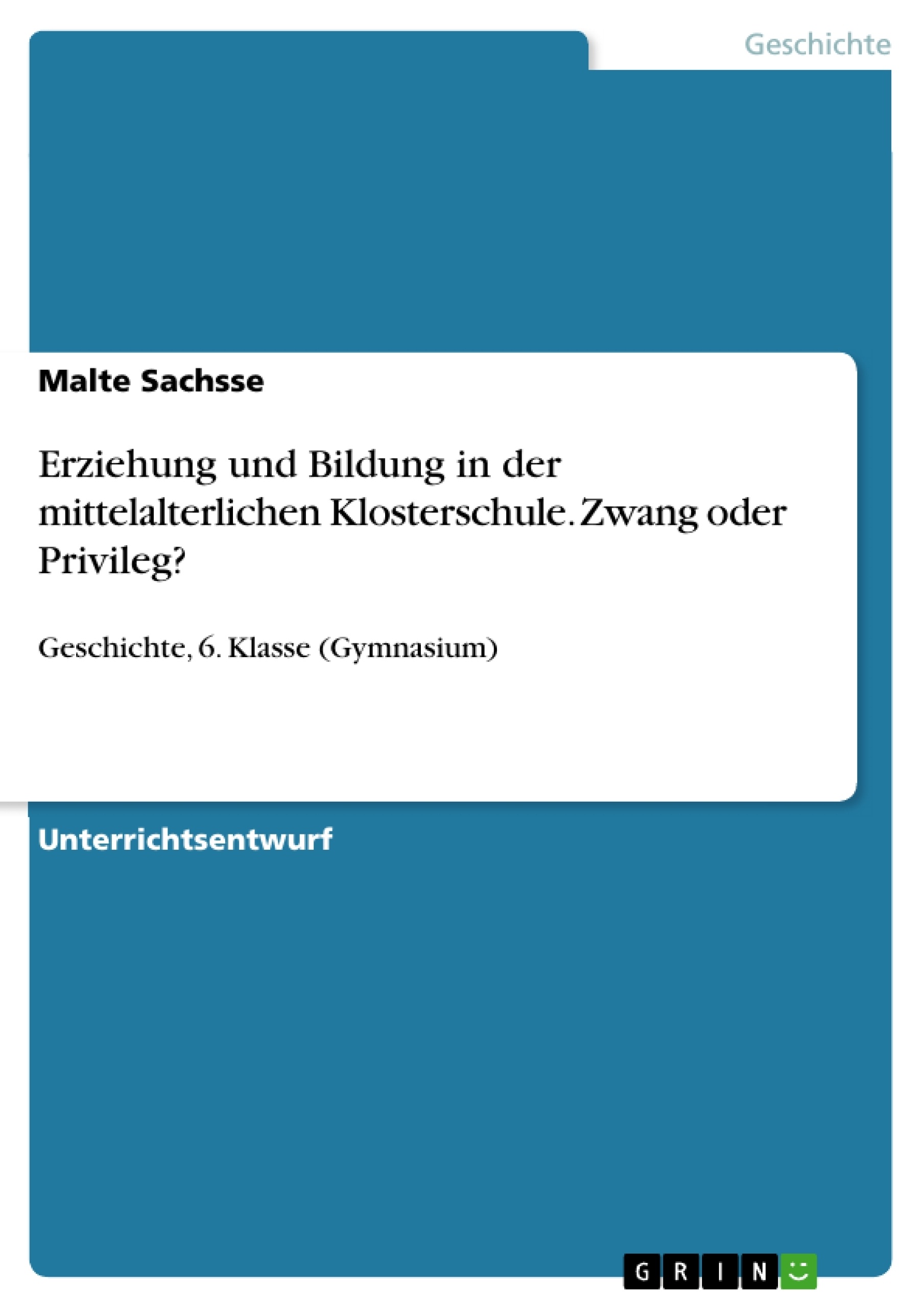Indem die Schülerinnen und Schüler den fiktiven Brief eines Klosterschülers im Mittelalter zusammenfassen und der dort geschilderten Situation ihren eigenen Schulalltag gegenüberstellen, erkennen sie zentrale Charakteristika mittelalterlicher Bildungs- und Erziehungspraxen. Sie erweitern ihre historische Sachkompetenz.
[...]
Die Auseinandersetzung mit „Lebenswelten in der Ständegesellschaft“ im Mittelalter ist – im Rahmen der durch den KLP G8 festgesetzten Obligatorik des Geschichtsunterrichts in der Orientierungsstufe – Teil des 4. Inhaltsfelds „Europa im Mittelalter“.
Die Unterrichtsstunde greift sich aus diesem Inhaltsfeld das Kloster als Teil mittelalterlicher Lebenswelten heraus und thematisiert diesen unter dem Aspekt von Erziehung und Bildung. Dieser Aspekt wurde gewählt, da er den SuS Möglichkeiten zur Perspektivübernahme sowie zum Vergleich mit ihrer eigenen schulischen Lebenswelt bietet. Indem die SuS sich in die Lage eines Klosterschülers hineinversetzen und mit ihrer eigenen Situation vergleichen, lernen sie nicht nur die Eigenarten einer mittelalterlichen Klosterschule kennen, sondern können auf dieser Basis (in Ansätzen) Bildungschancen und Möglichkeitsspielräume von Kindern im Mittelalter reflektieren. Der Zugewinn an Sachwissen soll auf dieser Weise zumindest Perspektiven für die Bildung eines historischen Werturteils eröffnen.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Lernausgangslage
- Leitgedanken und Intention der Unterrichtsreihe
- Überblick über die Reihe (Synopse)
- Begründung der wesentlichen Planungsentscheidungen der Unterrichtsstunde (Didaktisch-methodischer Kommentar)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtsstunde besteht darin, Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse zentrale Charakteristika mittelalterlicher Bildungs- und Erziehungspraxen anhand eines fiktiven Briefes eines Klosterschülers aufzuzeigen. Durch den Vergleich mit ihrem eigenen Schulalltag sollen sie ein Verständnis für die Andersartigkeit und Fremdheit mittelalterlicher Lebenswelten entwickeln.
- Mittelalterliche Bildungslandschaft
- Vergleich mittelalterlicher und heutiger Schulsysteme
- Bildung als Privileg oder Zwang im Mittelalter
- Perspektivübernahme und Empathie
- Entwicklung historischer Urteilsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge: Dieses Kapitel beschreibt die Lernausgangslage der Lerngruppe (6. Klasse), bestehend aus leistungsstarken und lernwilligen Schülern, inklusive eines Schülers mit Hörgerät und einem neu hinzugekommenen Schüler, der noch nicht vollständig integriert ist. Es erläutert die Leitgedanken der Unterrichtsreihe "Lebenswelten in der Ständegesellschaft" im Mittelalter, die den Fokus auf Sachkompetenz, Urteilskompetenz und den längerfristigen Erziehungsauftrag des Faches legt. Ein Überblick über die Reihe mit den einzelnen Unterrichtseinheiten wird gegeben, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Sachkompetenz der Schüler liegt und die Thematik des "Spagats" zwischen Gegenwartsbezug und dem Verständnis der Andersartigkeit des Mittelalters angesprochen wird.
Begründung der wesentlichen Planungsentscheidungen der Unterrichtsstunde (Didaktisch-methodischer Kommentar): Dieser Abschnitt detailliert die didaktisch-methodischen Entscheidungen für die Unterrichtsstunde. Die Wahl des Themas "Erziehung und Bildung in der mittelalterlichen Klosterschule" wird begründet durch die Möglichkeit der Perspektivübernahme und des Vergleichs mit dem eigenen Schulalltag. Die Verwendung einer fiktiven Quelle wird als geeignetes Mittel zur Motivation und zum Zugang zu dem für die Schüler fremden Thema hervorgehoben. Die Stunde zielt auf die Entwicklung von Empathie, Sachkompetenz und - in Ansätzen - historischer Urteilsfähigkeit ab. Es wird die methodische Vorgehensweise von Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppengespräch erläutert und die Herausforderungen bei der Gestaltung des Unterrichtsverlaufs und der Sicherung des Lernfortschritts diskutiert. Die didaktische Gestaltung der Stunde basiert auf problemorientiertem Geschichtsunterricht, wobei der Fokus auf der Entwicklung historischer Sachkompetenz liegt.
Schlüsselwörter
Mittelalter, Klosterschule, Erziehung, Bildung, Privileg, Zwang, Vergleich, Gegenwartsbezug, Sachkompetenz, Urteilskompetenz, Historisches Werturteil, Perspektivübernahme, Fremdverstehen, Partnerarbeit, Problemorientierter Geschichtsunterricht.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf "Mittelalterliche Bildungs- und Erziehungspraxen"
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Dieser Unterrichtsentwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde für die 6. Klasse zum Thema mittelalterliche Bildungs- und Erziehungspraxen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen dem mittelalterlichen Schulalltag (am Beispiel einer Klosterschule) und dem heutigen Schulsystem, um bei den Schülern ein Verständnis für die Andersartigkeit mittelalterlicher Lebenswelten zu entwickeln.
Welche Ziele werden mit der Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, den Schülern zentrale Charakteristika mittelalterlicher Bildungs- und Erziehungspraxen aufzuzeigen. Sie sollen Vergleichsfähigkeiten entwickeln, Perspektivübernahme und Empathie üben und ihre historische Urteilsfähigkeit schulen. Die Schüler sollen Sachkompetenz im Bereich des Mittelalters erwerben und einen Gegenwartsbezug herstellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind: Mittelalterliche Bildungslandschaft, Vergleich mittelalterlicher und heutiger Schulsysteme, Bildung als Privileg oder Zwang im Mittelalter, Perspektivübernahme und Empathie, und die Entwicklung historischer Urteilsfähigkeit. Die Unterrichtsstunde nutzt einen fiktiven Brief eines Klosterschülers als Grundlage.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf gliedert sich in die Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge (Lernausgangslage, Leitgedanken der Unterrichtsreihe, Überblick über die Reihe) und die Begründung der wesentlichen Planungsentscheidungen der Unterrichtsstunde (didaktisch-methodischer Kommentar). Er beschreibt die Lernausgangslage der Lerngruppe, die didaktisch-methodischen Entscheidungen (z.B. die Wahl der Quelle, die Methoden), und diskutiert Herausforderungen bei der Umsetzung.
Welche Methoden werden eingesetzt?
Die Unterrichtsstunde verwendet verschiedene Methoden wie Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppengespräche. Der Unterricht ist problemorientiert angelegt, wobei der Fokus auf der Entwicklung historischer Sachkompetenz liegt.
Welche Materialien werden verwendet?
Als zentrales Material dient ein fiktiver Brief eines Klosterschülers. Dieser Brief soll die Motivation der Schüler fördern und den Zugang zu dem für sie fremden Thema erleichtern.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler erwerben?
Die Schüler sollen Sachkompetenz (Wissen über das Mittelalter), Urteilskompetenz (Vergleich und Bewertung) und - in Ansätzen - historische Urteilsfähigkeit entwickeln. Zusätzlich werden Kompetenzen im Bereich der Perspektivübernahme und Empathie gefördert.
Welche Besonderheiten der Lerngruppe werden berücksichtigt?
Der Entwurf berücksichtigt die Lerngruppe (6. Klasse) mit leistungsstarken und lernwilligen Schülern, inklusive eines Schülers mit Hörgerät und einem neu hinzugekommenen Schüler, der noch nicht vollständig integriert ist.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Mittelalter, Klosterschule, Erziehung, Bildung, Privileg, Zwang, Vergleich, Gegenwartsbezug, Sachkompetenz, Urteilskompetenz, Historisches Werturteil, Perspektivübernahme, Fremdverstehen, Partnerarbeit, Problemorientierter Geschichtsunterricht.
- Quote paper
- Dr. Malte Sachsse (Author), 2015, Erziehung und Bildung in der mittelalterlichen Klosterschule. Zwang oder Privileg?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308680