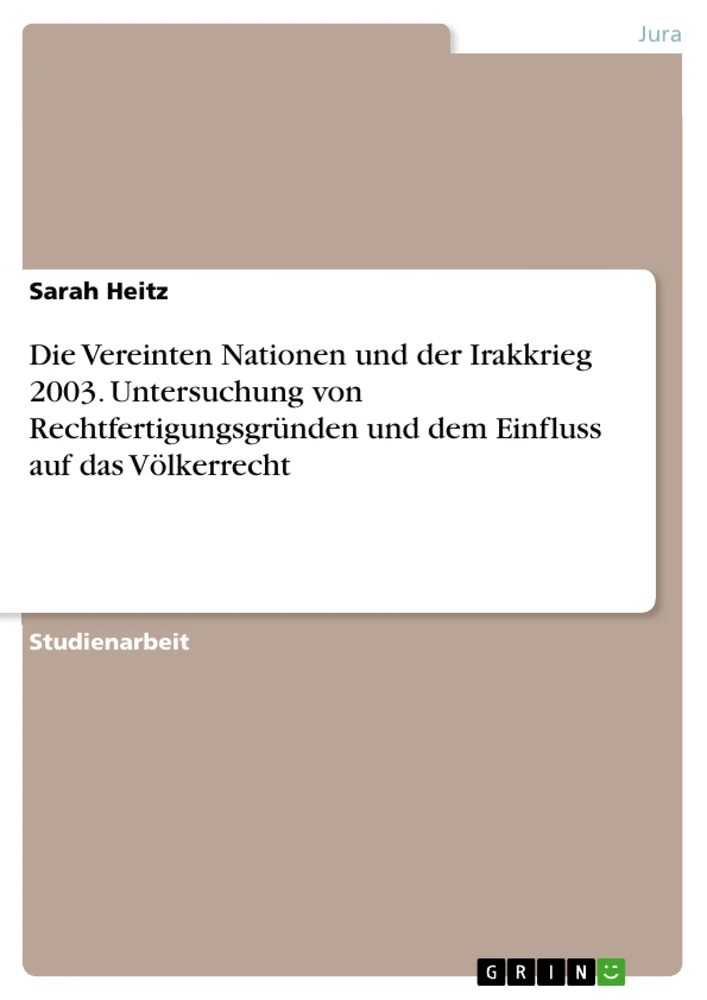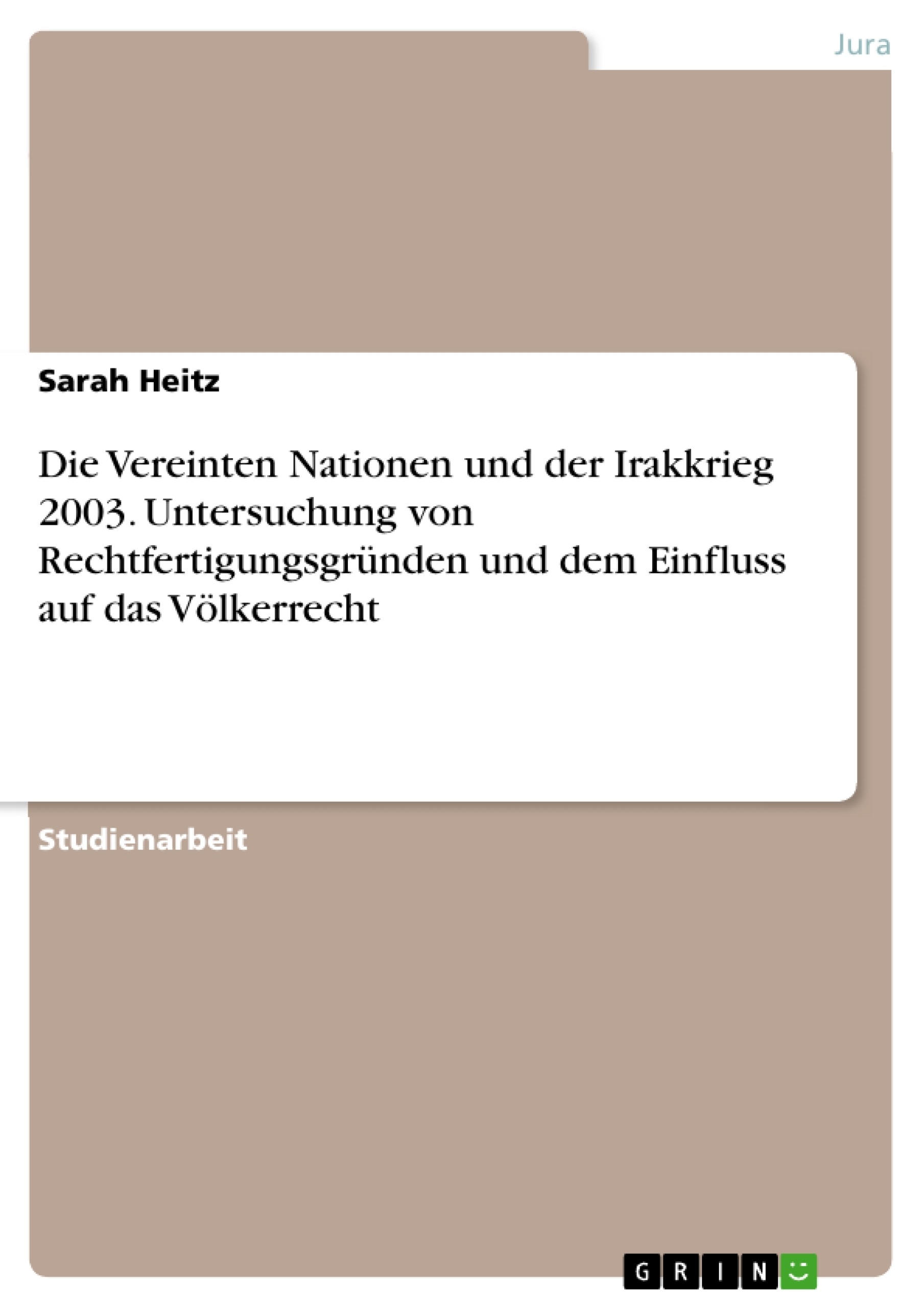Die vorliegende Arbeit befasst sich zuerst mit dem Friedenssicherungssystem der Vereinten Nationen unter geltendem Völkerrecht. In einem zweiten Schritt werden dann die vorgebrachten Rechtfertigungsgründe zum Eingreifen im Irak geprüft. Abschließend werden mögliche Folgen des Eingriffs auf Veränderungen im Völkerrecht und auf die Signifikanz der Vereinten Nationen erörtert.
Am 20. März 2003 begann der sogenannte 3. Golfkrieg, als amerikanische und britische Truppen in den Irak einmarschierten. Trotz entschiedener Ablehnung eines gewaltsamen Eingreifens im Irak von Seiten Frankreichs, Deutschlands und Russlands. Obwohl sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nach monatelanger, zäher Diskussion und wiederholten Überzeugungsversuchen seitens der USA und Großbritanniens, keine Mehrheit für einen militärischen Einsatz im Irak gewinnen ließ. Entgegen dem Einwand der drei ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates – China, Frankreich und Russland, die in einer gemeinsamen Erklärung, jeglichen Automatismus von Gewaltanwendung auf der Basis der Resolution 1441 ausschlossen, und die nachhaltige Zuständigkeit des Sicherheitsrats in der Irak-Frage betonten.
Das amerikanisch-britische Eingreifen im Irak 2003 erfolgte ultimativ ohne eine Mandat des Sicherheitsrats. Mittlerweile besteht im Schrifttum weitestgehend Einigkeit darüber, sieht man von einigen divergierenden Ansichten meist angelsächsischer Autoren einmal ab, dass das Eingreifen im Irak 2003 völkerrechtswidrig war. Darüber sollte man jedoch nicht vergessen, dass die amerikanische und britische Regierung im Vorfeld über verschiedene Rechtfertigungsgründe versuchten, ihr Vorgehen im Irak völkerrechtlich zu legitimieren, wie hier gezeigt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- A. Vorwort von Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen
- B. Einleitung: Die Vereinten Nationen und der Irak 2003
- C. Die Vereinten Nationen und das Völkerrecht - Schutz des Friedens durch Recht
- I. Ziele der Vereinten Nationen
- II. Das Gewaltverbot
- III. Das Souveränitätsprinzip
- IV. Das Interventionsverbot
- V. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
- VI. Zusammenfassung
- D. Rechtfertigungsversuche der US-Administration zugunsten eines militärischen Vorgehens im Irak
- I. Das Selbstverteidigungsrecht
- 1. Das Selbstverteidigungsrecht - restriktive Interpretation
- 2. Das Selbstverteidigungsrecht - extensive Interpretation
- 3. Ergebnis
- II. Ermächtigung durch bereits vorhandene Resolutionen
- III. Notwendigkeit eines Regimewechsel
- I. Das Selbstverteidigungsrecht
- E. Folgen des Irak-Krieges
- I. Folgen für das Völkerrecht
- II. Folgen für die Vereinten Nationen
- F. Resümée
- G. Schlusswort durch Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die völkerrechtliche Legitimität des amerikanischen und britischen Eingreifens im Irak im Jahr 2003. Sie analysiert das Vorgehen der USA und Großbritanniens im Kontext des Friedenssicherungssystems der Vereinten Nationen und prüft die vorgebrachten Rechtfertigungsgründe. Die Arbeit beleuchtet die Folgen des Krieges sowohl für das Völkerrecht als auch für die Vereinten Nationen.
- Das völkerrechtliche Gewaltverbot und seine Ausnahmen
- Die Rolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
- Die Rechtfertigungsstrategien der US-Administration
- Die Folgen des Irak-Krieges für das Völkerrecht
- Die Auswirkungen des Krieges auf die Vereinten Nationen
Zusammenfassung der Kapitel
B. Einleitung: Die Vereinten Nationen und der Irak 2003: Die Einleitung beschreibt den Beginn des Irakkrieges am 20. März 2003 und hebt die fehlende Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hervor. Sie betont die völkerrechtliche Problematik des militärischen Eingreifens ohne Mandat und kündigt die Struktur der Arbeit an: die Analyse des Friedenssicherungssystems der Vereinten Nationen, die Prüfung der Rechtfertigungsversuche der US-Administration und die Erörterung der Folgen des Krieges. Die Einleitung stellt klar, dass die weitverbreitete Ansicht im Schrifttum die völkerrechtswidrigkeit des Krieges bestätigt.
C. Die Vereinten Nationen und das Völkerrecht - Schutz des Friedens durch Recht: Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts im Zusammenhang mit dem Friedenssicherungssystem der Vereinten Nationen. Es analysiert die Ziele der Vereinten Nationen, das Gewaltverbot, das Souveränitätsprinzip, das Interventionsverbot und die Rolle des Sicherheitsrates. Das Kapitel legt den rechtlichen Rahmen dar, innerhalb dessen das Handeln der USA und Großbritanniens im Irak zu beurteilen ist. Der Fokus liegt auf den zentralen Prinzipien des Völkerrechts, die im Kontext des Irakkrieges besonders relevant sind, wie etwa die Einschränkungen des Rechts auf Selbstverteidigung.
D. Rechtfertigungsversuche der US-Administration zugunsten eines militärischen Vorgehens im Irak: Dieses Kapitel analysiert die von der US-Administration vorgebrachten Rechtfertigungsgründe für den Einmarsch im Irak. Es untersucht das Selbstverteidigungsrecht – sowohl in seiner restriktiven als auch in seiner extensiven Interpretation, inklusive präemptiver und präventiver Selbstverteidigung – und die Argumentation, dass bestehende Resolutionen des Sicherheitsrates eine implizite Ermächtigung zum militärischen Eingreifen darstellten. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit eines Regimewechsels als Rechtfertigung geprüft und im Kontext des Völkerrechts bewertet. Das Kapitel hinterfragt die juristische Tragfähigkeit dieser Argumente und stellt deren Schwächen dar.
E. Folgen des Irak-Krieges: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Irakkrieges auf das Völkerrecht und die Vereinten Nationen. Es analysiert die mögliche Entstehung von Völkergewohnheitsrecht, die Auswirkungen auf das Prinzip der souveränen Gleichheit und das Gewaltverbot. Weiterhin wird der Einfluss des Krieges auf das Ansehen und die Effektivität der Vereinten Nationen untersucht. Das Kapitel zeigt, wie der Krieg etablierte Normen des Völkerrechts in Frage stellte und neue Herausforderungen für die internationale Ordnung schuf.
Schlüsselwörter
Völkerrecht, Irak-Krieg 2003, Vereinte Nationen, Sicherheitsrat, Gewaltverbot, Selbstverteidigung, Souveränitätsprinzip, Interventionsverbot, Regimewechsel, Resolutionen, Völkergewohnheitsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Völkerrechtliche Legitimität des Irakkrieges 2003
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die völkerrechtliche Legitimität des militärischen Eingreifens der USA und Großbritanniens im Irak im Jahr 2003. Sie analysiert das Vorgehen der beiden Länder im Kontext des Friedenssicherungssystems der Vereinten Nationen und prüft die vorgebrachten Rechtfertigungsgründe. Die Arbeit beleuchtet zudem die Folgen des Krieges sowohl für das Völkerrecht als auch für die Vereinten Nationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen des Völkerrechts, wie das Gewaltverbot, das Souveränitätsprinzip, das Interventionsverbot und das Selbstverteidigungsrecht. Sie analysiert die Rolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und die Rechtfertigungsstrategien der US-Administration, einschließlich der Argumentation der Selbstverteidigung (restriktiv und extensiv) und der angeblichen Ermächtigung durch bestehende Resolutionen. Die Folgen des Krieges für das Völkerrecht und die Vereinten Nationen werden ebenfalls umfassend untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: ein Vorwort und Schlusswort von Kofi Annan, eine Einleitung, ein Kapitel über die Vereinten Nationen und das Völkerrecht, ein Kapitel über die Rechtfertigungsversuche der US-Administration, ein Kapitel über die Folgen des Irakkrieges und ein Resümee. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der völkerrechtlichen Legitimität des Krieges.
Wie werden die Rechtfertigungsversuche der US-Administration analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Rechtfertigungsversuche der US-Administration, darunter das Selbstverteidigungsrecht (sowohl restriktiv als auch extensiv interpretiert), die angebliche Ermächtigung durch bereits vorhandene Resolutionen des Sicherheitsrates und die Notwendigkeit eines Regimewechsels. Die juristische Tragfähigkeit dieser Argumente wird kritisch hinterfragt und deren Schwächen aufgezeigt.
Welche Folgen des Irakkrieges werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Irakkrieges auf das Völkerrecht (z.B. die mögliche Entstehung von Völkergewohnheitsrecht, Auswirkungen auf das Prinzip der souveränen Gleichheit und das Gewaltverbot) und auf die Vereinten Nationen (z.B. Auswirkungen auf das Ansehen und die Effektivität der Organisation). Es wird gezeigt, wie der Krieg etablierte Normen in Frage stellte und neue Herausforderungen für die internationale Ordnung schuf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Völkerrecht, Irak-Krieg 2003, Vereinte Nationen, Sicherheitsrat, Gewaltverbot, Selbstverteidigung, Souveränitätsprinzip, Interventionsverbot, Regimewechsel, Resolutionen, Völkergewohnheitsrecht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Irakkrieg völkerrechtswidrig war, da er ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates stattfand und die von der US-Administration vorgebrachten Rechtfertigungsgründe völkerrechtlich nicht haltbar waren. Die Arbeit betont die weitverbreitete Ansicht im Schrifttum, die die Völkerrechtswidrigkeit des Krieges bestätigt.
- Quote paper
- Sarah Heitz (Author), 2004, Die Vereinten Nationen und der Irakkrieg 2003. Untersuchung von Rechtfertigungsgründen und dem Einfluss auf das Völkerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308323