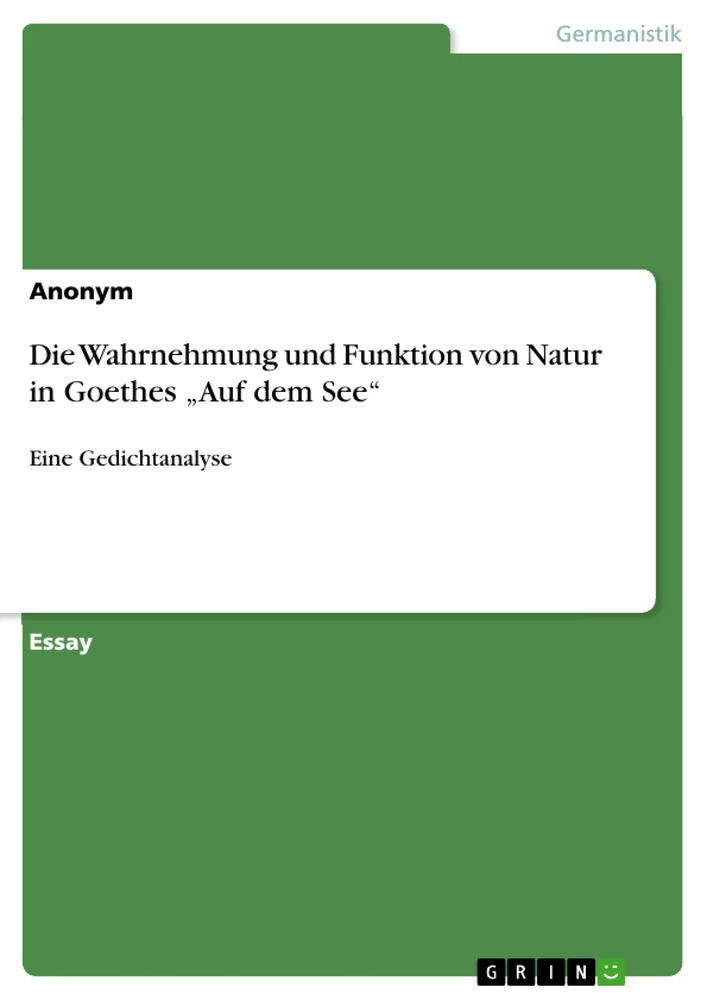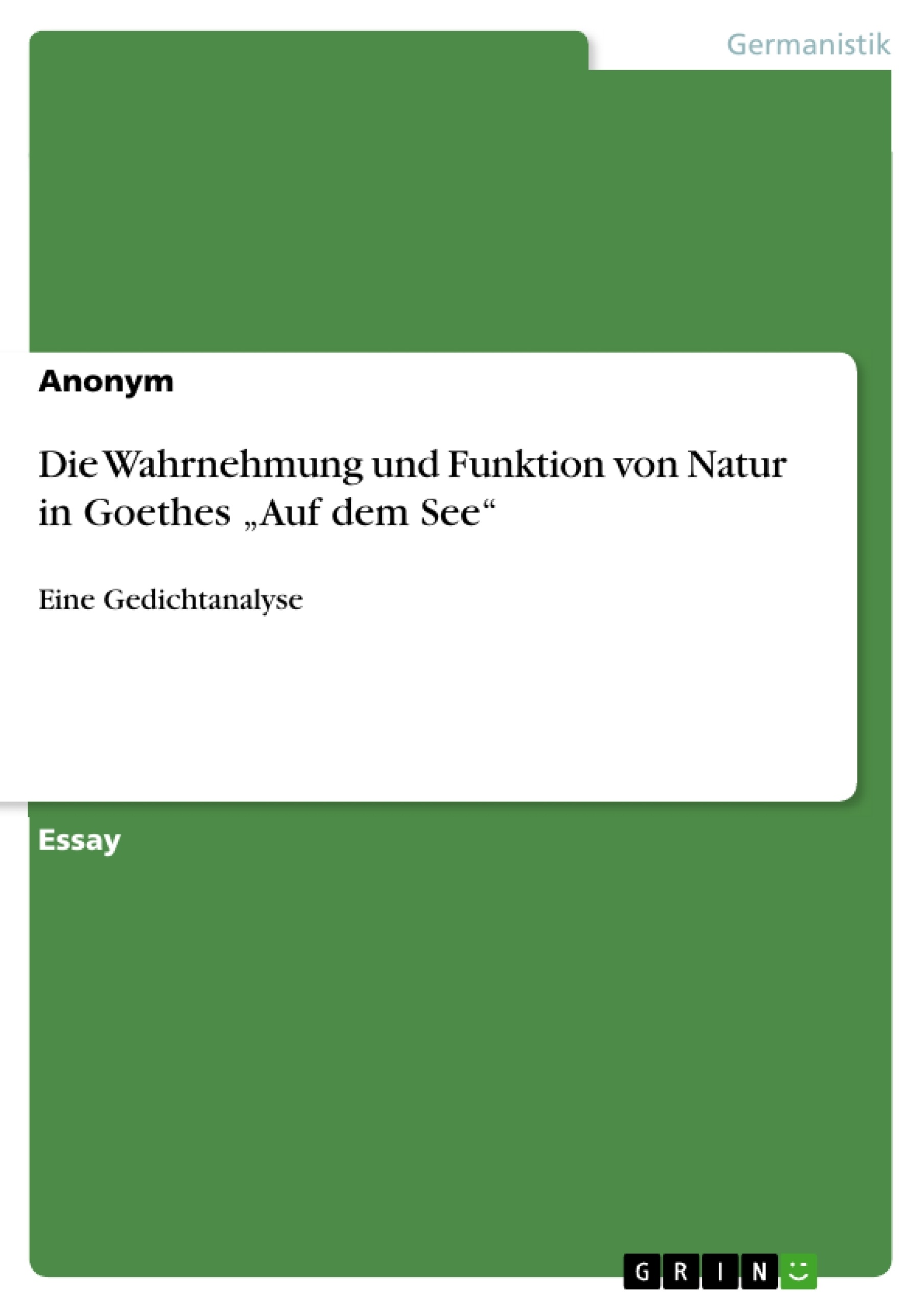Das Gedicht „Auf dem See“, was in dieser Arbeit analysiert wird, wurde 1775 von Johann Wolfgang von Goethe verfasst und nach einer Überarbeitung der in seinem Tagebuch notierten Schrift im Jahr 1789 veröffentlicht. Das in der Epoche des Sturm und Drang entstandene Gedicht thematisiert die Verbundenheit des lyrischen Ichs zur Natur und zugleich die Erinnerung und Verarbeitung dessen negativer Erfahrungen der Vergangenheit, die es zu überwinden gilt.
Die subjektiv-emotionale Perspektive der Sprecherinstanz dient nicht der objektiven Darstellung von Natur, sondern drückt innere Vorgänge und Gedanken aus, sodass das Gedicht der Natur- und Erlebnislyrik zuzuordnen ist. Im Mittelpunkt der folgenden Analyse soll daher vor allem die Frage nach der Gestaltung des Verhältnisses zwischen lyrischem Ich und der Natur stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Wahrnehmung und Funktion von Natur in Goethes "Auf dem See"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Analyse untersucht Goethes Gedicht "Auf dem See" und konzentriert sich auf die Darstellung des Verhältnisses zwischen dem lyrischen Ich und der Natur. Es wird die Frage nach der Gestaltung dieses Verhältnisses und dessen Entwicklung im Verlauf des Gedichts behandelt.
- Die formale Gestaltung des Gedichts (Metrum, Reimschema, Kadenz)
- Die Darstellung der Natur und ihre symbolische Bedeutung
- Die Verarbeitung von Erinnerungen und negativen Erfahrungen des lyrischen Ichs
- Die Entwicklung des lyrischen Ichs im Laufe des Gedichts
- Die Funktion der Natur als Raum der Verarbeitung und des Neubeginns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Wahrnehmung und Funktion von Natur in Goethes "Auf dem See": Das Gedicht "Auf dem See" von Goethe schildert die intensive Verbundenheit des lyrischen Ichs mit der Natur und die gleichzeitige Auseinandersetzung mit negativen Erinnerungen der Vergangenheit. Die Analyse fokussiert auf die Interaktion zwischen dem lyrischen Ich und der Natur, untersucht die formale Struktur des Gedichts (drei Strophen mit unterschiedlichen Metren und Reimschemata) und deren inhaltliche Entsprechung. Die erste Strophe zeigt eine harmonische Beziehung zwischen dem Ich und der Natur, die durch positive Bilder und einen regelmäßigen Jambus ausgedrückt wird. Die zweite Strophe markiert einen Bruch: traumatische Erinnerungen tauchen auf, die durch einen Wechsel des Metrums und des Reimschemas verdeutlicht werden. Das lyrische Ich versucht, diese Erinnerungen zu verdrängen. Die dritte Strophe zeigt die Rückkehr zu einer positiven Beziehung zur Natur, die nun aber eine schützende, tröstende Funktion hat. Die formale Struktur spiegelt diese Entwicklung wider: Obwohl die dritte Strophe formal Ähnlichkeiten zur ersten aufweist, bleibt der trochäische Rhythmus der zweiten Strophe erhalten, was auf die anhaltende Präsenz der verdrängten Erinnerungen hindeutet. Die Natur bietet dem lyrischen Ich einen Raum der Verarbeitung und des Neubeginns. Die Analyse betrachtet die Symbolik des Wassers, der Sonne, und des Windes und wie sie die emotionale Reise des lyrischen Ichs unterstützen.
Schlüsselwörter
Goethe, Auf dem See, Naturlyrik, Sturm und Drang, lyrisches Ich, Natur, Erinnerung, Verarbeitung, Metrum, Reimschema, Kadenz, Personifikation, Symbol, harmonisches Verhältnis, Bruch, Neubeginn.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Auf dem See"
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Analyse untersucht Goethes Gedicht "Auf dem See" und konzentriert sich auf die Darstellung des Verhältnisses zwischen dem lyrischen Ich und der Natur. Es wird die Frage nach der Gestaltung dieses Verhältnisses und dessen Entwicklung im Verlauf des Gedichts behandelt.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse untersucht die formale Gestaltung des Gedichts (Metrum, Reimschema, Kadenz), die Darstellung der Natur und ihre symbolische Bedeutung, die Verarbeitung von Erinnerungen und negativen Erfahrungen des lyrischen Ichs, die Entwicklung des lyrischen Ichs im Laufe des Gedichts und die Funktion der Natur als Raum der Verarbeitung und des Neubeginns.
Wie ist das Gedicht "Auf dem See" aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit unterschiedlichen Metren und Reimschemata. Die erste Strophe zeigt eine harmonische Beziehung zwischen dem Ich und der Natur. Die zweite Strophe markiert einen Bruch durch das Auftauchen traumatischer Erinnerungen. Die dritte Strophe zeigt die Rückkehr zu einer positiven Beziehung zur Natur, die nun eine schützende, tröstende Funktion hat. Die formale Struktur spiegelt diese Entwicklung wider.
Welche Rolle spielt die Natur im Gedicht?
Die Natur spielt eine zentrale Rolle im Gedicht. Sie dient als Spiegelbild der emotionalen Reise des lyrischen Ichs. In der ersten und dritten Strophe ist sie ein Ort der Harmonie und des Friedens. In der zweiten Strophe spiegelt sie den inneren Konflikt des lyrischen Ichs wider. Letztendlich bietet die Natur dem lyrischen Ich einen Raum der Verarbeitung und des Neubeginns.
Welche Symbole werden im Gedicht verwendet?
Die Analyse betrachtet die Symbolik des Wassers, der Sonne und des Windes und wie sie die emotionale Reise des lyrischen Ichs unterstützen. Diese Symbole tragen zur Gesamtbedeutung des Gedichts bei.
Wie entwickelt sich das lyrische Ich im Laufe des Gedichts?
Das lyrische Ich durchlebt im Gedicht eine emotionale Reise von Harmonie über Konfrontation mit traumatischen Erinnerungen hin zu einer erneuten, aber gewandelten, positiven Beziehung zur Natur. Diese Entwicklung wird sowohl inhaltlich als auch formal durch die Metrik und das Reimschema verdeutlicht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Auf dem See, Naturlyrik, Sturm und Drang, lyrisches Ich, Natur, Erinnerung, Verarbeitung, Metrum, Reimschema, Kadenz, Personifikation, Symbol, harmonisches Verhältnis, Bruch, Neubeginn.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Wahrnehmung und Funktion von Natur in Goethes „Auf dem See“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308281