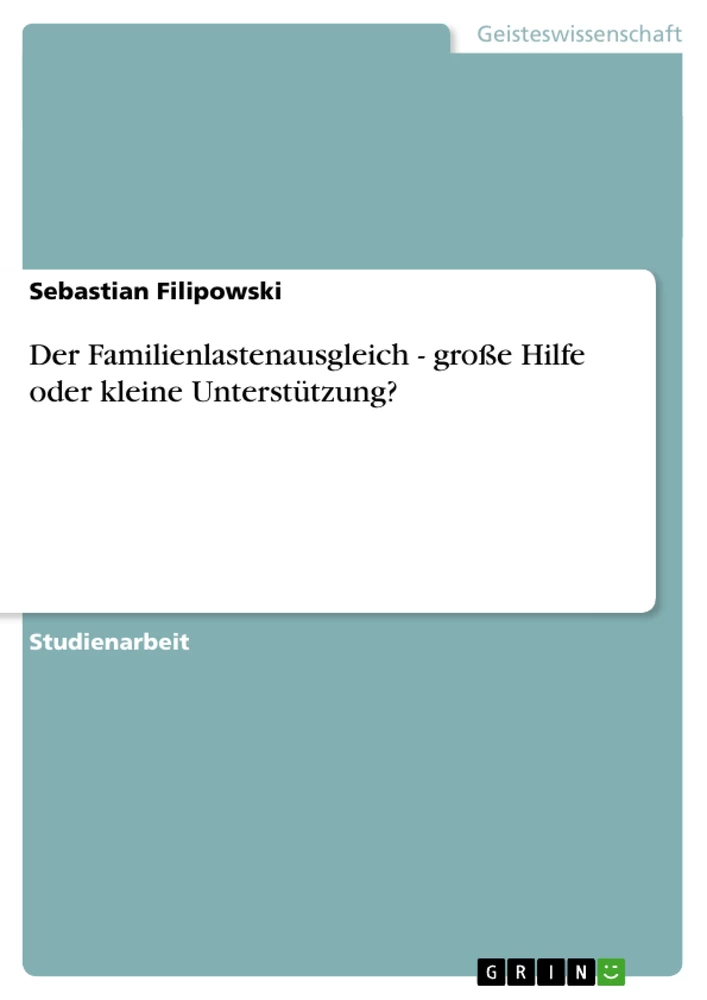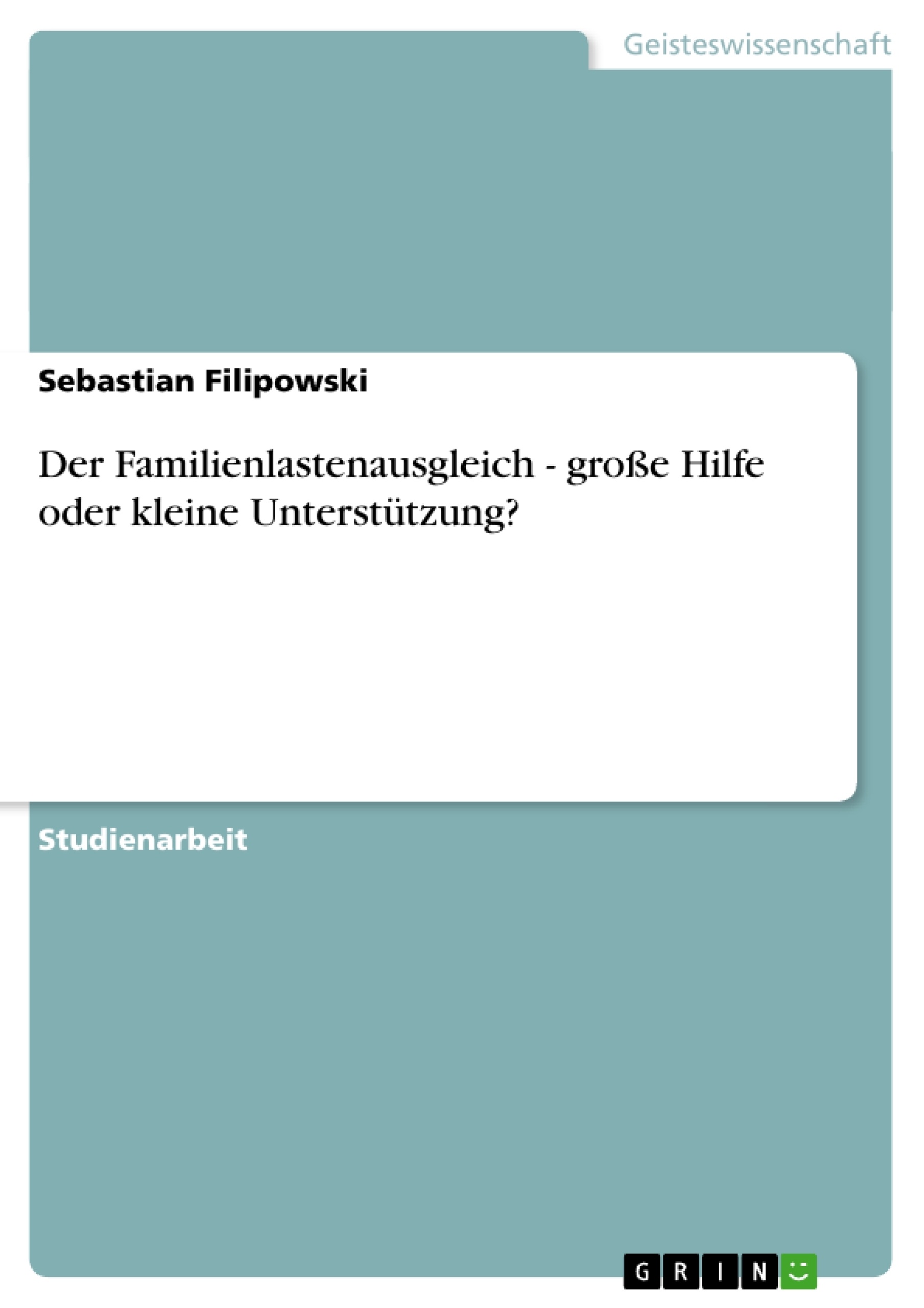"Die Bundesrepublik Deutschland ist ein [...] sozialer Bundesstaat." Durch diesen Artikel des Grundgesetzes steht die Bundesregierung vor der Aufgabe, eine familiengerechte Politik zu gestalten. Um jener gerecht zu werden, wurde der Familienlastenausgleich geschaffen. Dieser ist unter anderem definiert als eine Familienpolitik durch Geldleistungen. In der vorliegenden Arbeit wird nun gemäß dem Titel versucht, kritisch zu hinterfragen, ob es sich bei dem Familienlastenausgleich tatsächlich um eine große Hilfe handelt oder ob der Familienlastenausgleich als eine kleine Unterstützung angesehen werden kann ähnlich dem sprichwörtlichen „Tropfen auf dem heißen Stein“. Bei der Beantwortung dieser Frage wird in dieser Arbeit ein Schwerpunkt auf den Teilbereich der monetären Transfers des Familienlastenausgleichs gelegt, da sich eine Bearbeitung von zusätzlichen Teilbereichen des Familienlastenausgleichs als zu umfangreich gestalten würde.
Die Ausarbeitung ist so aufgebaut, dass zunächst der Begriff des Familienlastenausgleichs und die verschiedenen Teilbereiche kurz definiert und skizziert werden. Anschließend folgt eine Erläuterung der beiden Ziele des Familienlastenausgleichs, indem zuerst das Konzept des horizontalen Leistungsausgleich und danach die Idee des vertikalen Familienlastenausgleichs analysiert wird. Im Anschluss werden diese beiden Konzepte an konkreten Beispielen, an dem Kinderfreibetrag und an dem Kindergeld, erläutert und erklärt. Als letzter Punkt dieser Arbeit wird in der Fazitdiskussion versucht, die bereits erwähnte und im Titel voran gestellte Frage zu beantworten, ob der Familienlastenausgleich wirklich eine große Hilfe ist, oder nur als kleine Unterstützung angesehen werden kann. Ferner wird erweiternd versucht zu beleuchten, wo die Stärken und Schwächen des Familienlastenausgleichs liegen und welche Reformoptionen des Familienlastenausgleichs gegebenenfalls zur Verfügung stünden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Familienlastenausgleichs
- Ziele des Familienlastenausgleichs
- Aufgaben des horizontalen Familienlastenausgleichs
- Aufgaben des vertikalen Familienlastenausgleichs
- Materielle Familiensubvention an Beispielen
- Horizontaler Familienlastenausgleich am Beispiel des Kinderfreibetrags
- Vertikaler Familienlastenausgleich am Beispiel des Kindergeldes
- Fazitdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht kritisch den Familienlastenausgleich in Deutschland. Sie hinterfragt, ob dieser eine große Hilfe oder nur eine kleine Unterstützung für Familien darstellt. Der Fokus liegt auf den monetären Aspekten des Familienlastenausgleichs aufgrund des Umfangs des Themas. Die Arbeit analysiert die Definition und Ziele des Familienlastenausgleichs, unterscheidet zwischen horizontalem und vertikalem Ausgleich und beleuchtet diese anhand konkreter Beispiele.
- Definition und Konzeption des Familienlastenausgleichs
- Analyse des horizontalen und vertikalen Familienlastenausgleichs
- Bewertung der Effektivität des Familienlastenausgleichs
- Kosten der Kindererziehung (direkte und indirekte Kosten)
- Reformoptionen des Familienlastenausgleichs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Familienlastenausgleichs in Deutschland ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dessen Effektivität. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition des Familienlastenausgleichs, die Erläuterung seiner Ziele (horizontaler und vertikaler Ausgleich) und die Analyse konkreter Beispiele (Kinderfreibetrag, Kindergeld) umfasst. Abschließend wird die Absicht der Fazitdiskussion angekündigt, die die eingangs gestellte Frage beantworten und Stärken, Schwächen und mögliche Reformoptionen des Systems beleuchten soll. Die Auswahl der Literatur berücksichtigt sowohl ältere Quellen zur Erfassung der Ursprungsgedanken als auch aktuelle Quellen für konkrete Beispiele und Reformdiskussionen.
Definition des Familienlastenausgleichs: Dieses Kapitel definiert den Familienlastenausgleich als staatliche Maßnahme zur Korrektur der marktmäßigen Einkommensverteilung und zum Ausgleich zwischen Familien mit und ohne Kinder. Es wird zwischen dem finanziellen Lastenausgleich und dem Familienleistungsausgleich unterschieden, der die Anerkennung der Erziehungsleistung beinhaltet. Das Kapitel illustriert die hohen Kosten der Kindererziehung (direkte und indirekte Kosten) und deren Auswirkungen auf Familien, insbesondere Alleinerziehende. Es unterstreicht die Notwendigkeit des Familienlastenausgleichs zur Vermeidung sozialer Ungleichheit und zur Sicherung der Familienexistenz.
Ziele des Familienlastenausgleichs: In diesem Kapitel werden die Ziele des Familienlastenausgleichs erläutert, indem der horizontale und vertikale Ausgleich unterschieden und analysiert werden. Der horizontale Ausgleich zielt auf den Ausgleich zwischen Familien mit unterschiedlicher Kinderzahl ab, während der vertikale Ausgleich die Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen fokussiert. Die Kapitel erläutert die komplexen ökonomischen und sozialen Überlegungen, die diesen Ausgleichsmechanismen zugrunde liegen und die Herausforderungen, die mit ihrer Umsetzung verbunden sind. Die Bedeutung der staatlichen Verantwortung für die Familienförderung wird hervorgehoben.
Materielle Familiensubvention an Beispielen: Dieses Kapitel analysiert den horizontalen und vertikalen Familienlastenausgleich anhand konkreter Beispiele: den Kinderfreibetrag (horizontal) und das Kindergeld (vertikal). Es beleuchtet die Funktionsweise beider Instrumente, ihre Stärken und Schwächen und ihre Auswirkungen auf Familien. Die unterschiedlichen Ansätze und Zielsetzungen beider Systeme werden miteinander verglichen und diskutiert, und deren Beitrag zur Erreichung der Gesamtziele des Familienlastenausgleichs wird bewertet.
Schlüsselwörter
Familienlastenausgleich, horizontaler Familienlastenausgleich, vertikaler Familienlastenausgleich, Kinderfreibetrag, Kindergeld, Familienpolitik, soziale Ungleichheit, Kindererziehungskosten, monetäre Transfers, Reformoptionen, Sozialstaat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Familienlastenausgleich in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kritisch den Familienlastenausgleich in Deutschland und hinterfragt dessen Effektivität als Unterstützung für Familien. Der Fokus liegt dabei auf den monetären Aspekten aufgrund des Umfangs des Themas.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Ziele des Familienlastenausgleichs, unterscheidet zwischen horizontalem und vertikalem Ausgleich und beleuchtet diese anhand konkreter Beispiele wie Kinderfreibetrag und Kindergeld. Zusätzlich werden die Kosten der Kindererziehung (direkte und indirekte Kosten), die Effektivität des Systems und mögliche Reformoptionen analysiert.
Was ist der horizontale Familienlastenausgleich?
Der horizontale Familienlastenausgleich zielt auf den Ausgleich zwischen Familien mit unterschiedlicher Kinderzahl ab. Ein Beispiel hierfür ist der Kinderfreibetrag.
Was ist der vertikale Familienlastenausgleich?
Der vertikale Familienlastenausgleich fokussiert die Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen. Das Kindergeld dient als Beispiel für diese Form des Ausgleiches.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Kinderfreibetrag als Beispiel für den horizontalen und das Kindergeld als Beispiel für den vertikalen Familienlastenausgleich. Die Funktionsweise, Stärken, Schwächen und Auswirkungen beider Instrumente auf Familien werden im Detail untersucht.
Wie wird die Effektivität des Familienlastenausgleichs bewertet?
Die Arbeit bewertet die Effektivität des Familienlastenausgleichs durch die Analyse der konkreten Beispiele, die Betrachtung der Kosten der Kindererziehung und die Diskussion möglicher Reformoptionen. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob der Familienlastenausgleich eine große Hilfe oder nur eine kleine Unterstützung für Familien darstellt.
Welche Kosten werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt sowohl die direkten als auch die indirekten Kosten der Kindererziehung und deren Auswirkungen auf Familien, insbesondere Alleinerziehende.
Welche Reformoptionen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert mögliche Reformoptionen des Familienlastenausgleichssystems, um dessen Effektivität zu verbessern. Konkrete Vorschläge werden jedoch nicht explizit genannt, sondern lediglich als Thema der Fazitdiskussion angedeutet.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Auswahl der Literatur berücksichtigt sowohl ältere Quellen zur Erfassung der Ursprungsgedanken als auch aktuelle Quellen für konkrete Beispiele und Reformdiskussionen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist aufgebaut mit Einleitung, Definition des Familienlastenausgleichs, Zielen des Familienlastenausgleichs, materiellen Familiensubventionen an Beispielen und einer Fazitdiskussion. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage, der Hauptteil analysiert die Thematik und die Fazitdiskussion fasst die Ergebnisse zusammen und beleuchtet Stärken, Schwächen und mögliche Reformoptionen.
- Citation du texte
- Sebastian Filipowski (Auteur), 2004, Der Familienlastenausgleich - große Hilfe oder kleine Unterstützung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30822