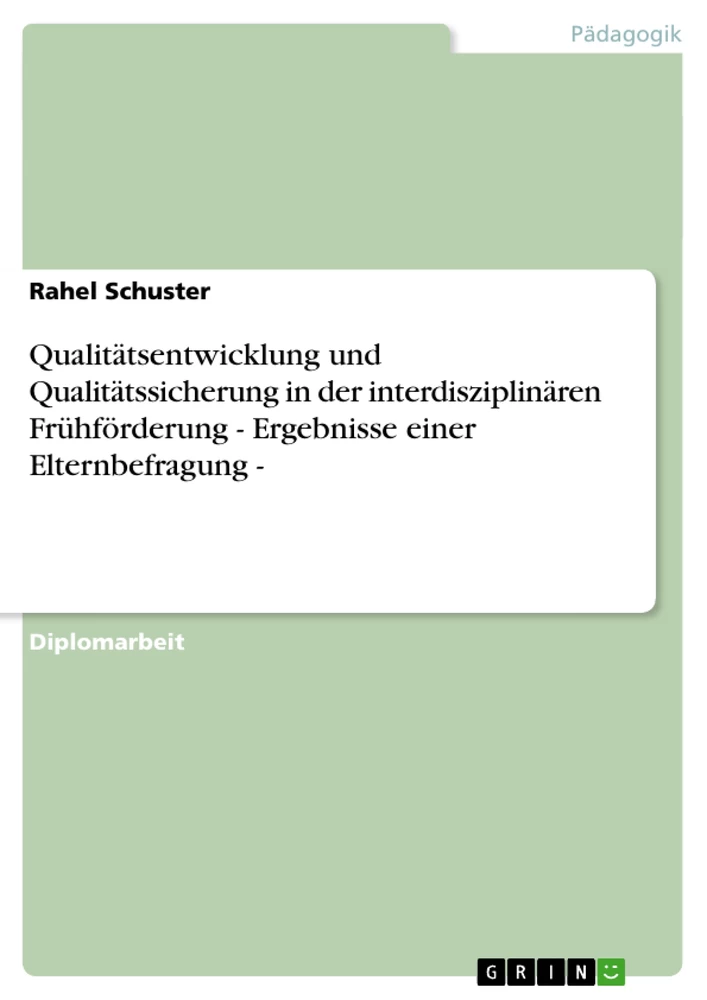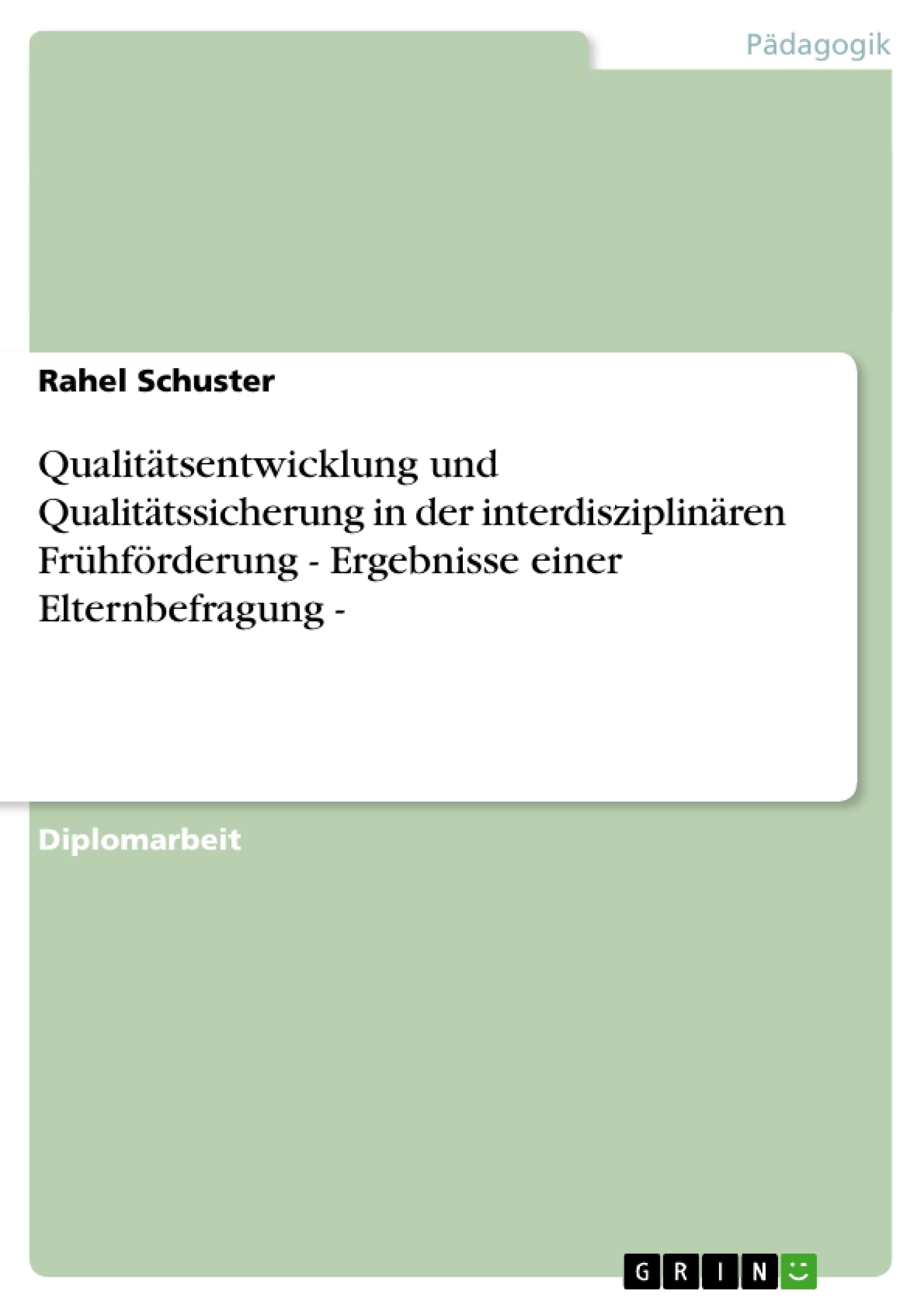Angeregt wurde die Beschäftigung mit dem Thema dieser Arbeit durch die Mitarbeiterinnen
der Beratungs- und Frühförderstelle der Arbeiterwohlfahrt Freiburg. Sie unterstützten
mich bei der Entwicklung des Fragebogens und der Durchführung der Elternbefragung
sowohl mit Ihrer Kompetenz als auch mit finanziellen Mitteln und standen darüber hinaus
jeder Zeit für Fragen zur Verfügung. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich dafür bedanken!
In vorliegender Arbeit wird in den Theorieteilen für alle Genusbezeichnungen die männliche
Form gewählt, die weiblichen Personen sind dabei aber jeweils immer mitgemeint. Im
Praxisteil, der sich speziell auf die Arbeit der Beratungs- und Frühförderstelle der Arbeiterwohlfahrt
Freiburg bezieht, wird die weibliche Bezeichnung gewählt, da in der betreffenden
Frühförderstelle nur Frauen beschäftigt sind.
In vielen der im Laufe der Arbeit zitierten Werken wurde die alte Rechtschreibung verwendet.
Auf Rechtschreibfehler in den Zitaten, die sich daraus ergeben, wird im Einzelfall
nicht gesondert hingewiesen.
Hervorhebungen in den Zitaten entsprechen, wenn nicht anders angegeben, denen im Original;
auch hierauf wird im Einzelfall nicht gesondert hingewiesen.
Im Verlauf der vorliegenden Arbeit taucht immer wieder der Begriff der „Frühförderin“/
des „Frühförderers“ auf. Offiziell existiert diese (Berufs-) Bezeichnung nicht und sie ist in
der Praxis auch umstritten, da die Identität der einzelnen Berufsgruppen in der Frühförderung
dadurch nicht gewahrt werden kann (persönliche Mitteilung einer Mitarbeiterin der
Frühförderung). Dass die Bezeichnung in der Literatur trotzdem immer öfter auftaucht,
führe ich darauf zurück, dass der Begriff einerseits das verbindende Zusammenarbeiten
unterschiedlicher Fachbereiche in der Frühförderung unterstreicht und andererseits eine
bequeme Kurzform für die lange Formulierung „Mitarbeiter/in der Frühförderung“ darstellt. [...] In vorliegender Arbeit soll nach einem ersten Teil, der auf die Stellung der Eltern in der
Frühförderung und ihre Bedürfnisse und Erwartungen eingeht, im zweiten Teil die aktuelle
Qualitätsdebatte im Sozialwesen dargestellt und ihr Nutzen für die Frühförderung diskutiert
werden. Ziel ist es, konkrete Anregungen zu geben, wie die Qualität in einer Frühfördereinrichtung
evaluiert werden kann und wie sich als notwendig erkannte Entwicklungsschritte
leicht realisieren lassen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung: Begründung des Themas
- 2. Eltern in der Frühförderung
- 2.1 Überblick über Frühförderung in Deutschland
- 2.1.1 Entwicklung der Frühförderung in Deutschland
- 2.1.2 Aufgaben und Ziele von Frühförderung
- 2.1.3 Grundsätze der Frühförderung
- 2.2 Elternbeteiligung in der Frühförderung
- 2.2.1 Laienmodell
- 2.2.2 Ko-Therapeuten-Modell
- 2.2.3 Partnerschaftlichkeitsmodell/Kooperationsmodell
- 2.3 Inhalte und Ziele der Elternarbeit
- 2.4 Was Eltern von der Frühförderung erwarten
- 2.5 Zufriedenheit der Eltern mit Frühförderung
- 2.5.1 Zufriedenheit – ein Konstrukt
- 2.5.2 Warum die Zufriedenheit der Eltern wichtig ist
- 2.5.3 Ergebnisse von Befragungen
- 3. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
- 3.1 Allgemeine Begriffsdefinition Qualität
- 3.2 Qualitätsdebatte in der sozialen Arbeit
- 3.2.1 Woher kommt die Diskussion um Qualität in der sozialen Arbeit?
- 3.2.2 Welche Effekte zeigt die Qualitätsdebatte?
- 3.2.3 Wurde nicht schon immer Wert auf Qualität gelegt?
- 3.2.4 Welche Entwicklungschancen bietet die aktuelle Qualitätsdebatte?
- 3.4 QM-Systeme und weitere Ansätze
- 3.4.1 Die Qualitätsnormenreihe DIN EN ISO 9000ff.
- 3.4.2 TQM/EFQM
- 3.4.3 weitere Konzepte
- 3.4.4 Evaluation
- 3.4.5 Bedeutung der Konzepte für die Frühförderung
- 3.5 Ebenen von Qualität
- 2.5.1 Strukturqualität
- 3.5.2 Konzeptqualität
- 3.5.3 Prozessqualität
- 3.5.4 Ergebnisqualität
- 4. Elternbeteiligung am Prozess der Qualitätsentwicklung
- 4.1 Ausgangsüberlegungen
- 4.2 Ziel der Befragung
- 4.3 Die Arbeit der Beratungs- und Frühförderstelle der AWO Freiburg
- 4.4 Arbeit mit mehrfach belasteten Familien
- 4.5 Qualitätsentwicklung in der Beratungs- und Frühförderstelle der AWO Freiburg
- 4.6 Auswahl des Evaluationsinstruments
- 4.7 Entwicklung des Fragebogens
- 4.7.1 Exkurs empirische Sozialforschung
- 4.7.2 Aspekte, die der Fragebogen erfasst
- 4.7.3 Kritik am Fragebogen
- 4.8 Auswertung
- 4.8.1 Rücklauf
- 4.8.2 Ergebnisse
- 4.8.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 4.8.4 Wie werden die Ergebnisse den Eltern transparent gemacht?
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der interdisziplinären Frühförderung und analysiert dabei die Ergebnisse einer Elternbefragung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Sichtweise der Eltern auf die Qualität der Frühförderung zu beleuchten und ihre Erfahrungen und Erwartungen in den Prozess der Qualitätsentwicklung einzubeziehen.
- Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Elternbeteiligung in der Frühförderung.
- Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle der Elternbeteiligung und deren Auswirkungen auf die Qualität der Frühförderung.
- Es werden verschiedene Konzepte zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Sozialwesen vorgestellt und auf ihre Relevanz für die Frühförderung untersucht.
- Die Arbeit erörtert die Entwicklung eines Fragebogens zur Erhebung der Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung.
- Die Ergebnisse der Elternbefragung werden analysiert und interpretiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Arbeit und ihr Thema vor und erläutert die Motivation für die Beschäftigung mit der Qualitätsentwicklung in der Frühförderung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Konzept der Frühförderung, erläutert verschiedene Modelle der Elternbeteiligung und geht auf die Erwartungen und die Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung ein. In Kapitel 3 werden verschiedene Konzepte der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Sozialwesen vorgestellt und deren Bedeutung für die Frühförderung diskutiert. Kapitel 4 befasst sich mit der Elternbeteiligung am Prozess der Qualitätsentwicklung, beschreibt die Entwicklung und Durchführung einer Elternbefragung und analysiert deren Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Qualitätssicherung, Frühförderung, Elternbeteiligung, Elternzufriedenheit, Qualitätsentwicklung, Sozialwesen, Evaluation, Fragebogen, empirische Sozialforschung.
- Arbeit zitieren
- Rahel Schuster (Autor:in), 2004, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der interdisziplinären Frühförderung - Ergebnisse einer Elternbefragung -, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30776