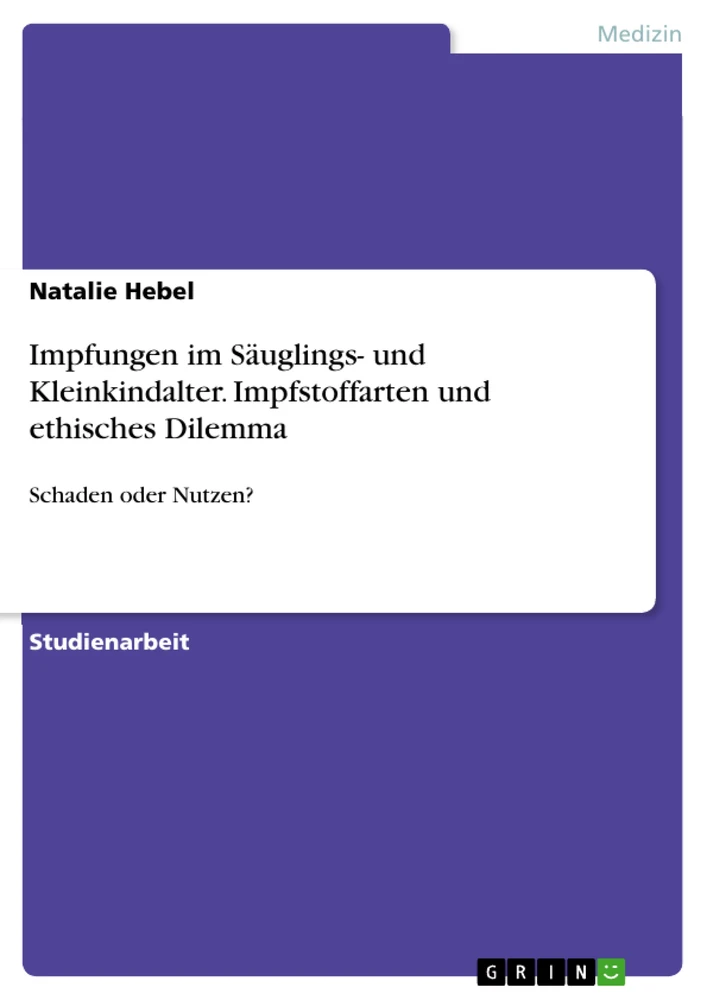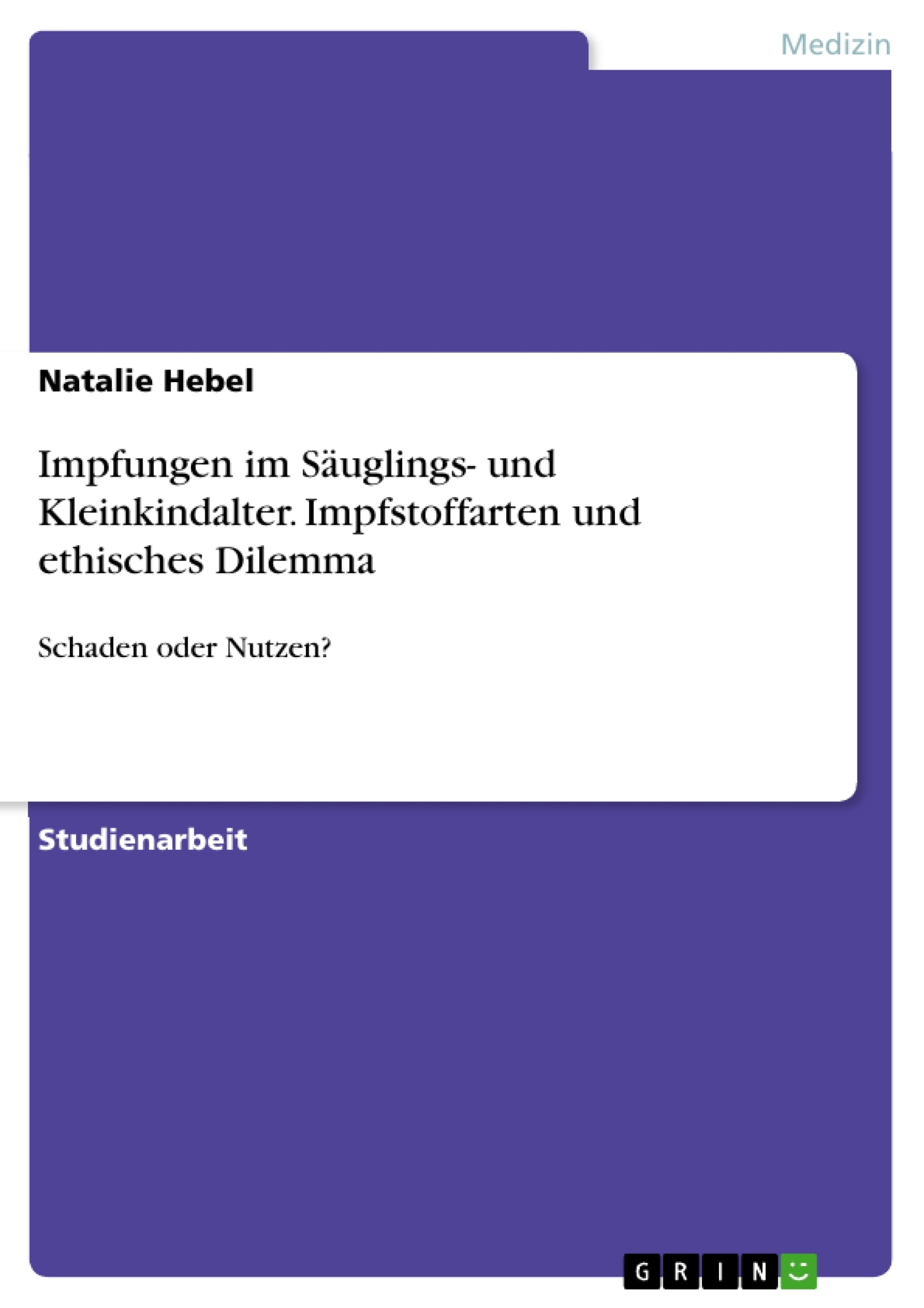In dieser Studienarbeit geht es um Impfungen von Säuglingen und Kleinkindern. Dabei lautet die Kernfrage: Wird dem Einzelnen und/oder den Mitgliedern der Gesellschaft durch Impfungen im Säuglings- oder Kleinkindalter eher Schaden zugefügt oder wird ein allgemeingültiger Nutzen (im Sinne einer ethischen Betrachtungsweise) gestiftet?
Grundlage für die kritische Auseinandersetzung mit der Impfthematik bietet bereits die ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts selbst. Deren Mitglieder unterliegen durch Tätigkeiten im pharmanahen Umfeld zum Teil selbst Interessenskonflikten. Darüber hinaus ist die Aufklärungsarbeit bzw. Risikokommunikation im Hinblick auf die individuelle Impfentscheidung, die meist sehr stark mithilfe von sogenannten Furchtappelltheorien gegenüber den „Impflingen“ bzw. gegenüber deren Sorgeberechtigten betrieben wird, nach Ansicht der Autorin sehr auffällig. Hinzu kommt, dass eine liberale Gesetzgebung zur Impfthematik in Deutschland, die Pharmaunternehmen - in Bezug auf ihre ethische Verantwortung - vor die Wahl möglicher eigener Ethik-Codices zur Reglementierung stellt.
Um die Fragestellung zu erörtern, wird in Kapitel eins auf die Grundlagen der Ethik in Zusammenhang mit Moral und Philosophie sowie unter Betrachtung von ethischen Konzepten (wie deskriptive und normative Ethik, Utilitarismus und Vertragstheorie, evolutionäre Ethik und Emotivismus) und angewandter Ethik (wie Medizin- und Wirtschaftsethik) eingegangen. Anschliessend verschafft Kapitel zwei einen Überblick über die Impfthematik mit einem kurzen Abriss zur rechtlichen Situation in Deutschland und Informationen zu ausgewählten medizinischen Aspekten zur „Impfung“ (Impfstoffarten, Impfzeitpunkt) sowie möglichen gesundheitlichen Auswirkungen (Impffolgen). Kapitel drei stellt die Gruppen der Hauptprotagonisten vor: die Pharmakonzerne, das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, die Haus- und Kinderärzten sowie die Impflinge und deren Sorgeberechtigten und geht dabei auf die Entstehung und Erklärung möglicher ethischer Dilemmata für die jeweiligen Gruppen ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Ethik, Moral und Philosophie
- 1.2 Ethische Konzepte
- 1.2.1 Deskriptive und normative Ethik
- 1.2.2 Utilitarismus & Vertragstheorie
- 1.2.3 Evolutionäre Ethik
- 1.2.4 Emotivismus
- 1.3 Angewandte Ethik
- 1.3.1 Medizinethik
- 1.3.2 Wirtschaftsethik
- 2. Impfthematik
- 2.1 Impfstoffarten
- 2.2 Rechtliche Situation in Deutschland
- 2.3 Impfzeitpunkt und Impffolgen
- 3. Ethische Dilemmata der einzelnen Konfliktparteien
- 3.1 Pharmakonzerne
- 3.1.1 Robert Koch-Institut und STIKO
- 3.1.2 Paul-Ehrlich-Institut
- 3.2 Haus- und Kinderärzte
- 3.3 Impfling und Sorgeberechtigte
- 4. Kritische Würdigung und Lösungsvorschläge
- 4.1 Aus Wirtschaftsethnischer Sicht für die Pharmakonzerne
- 4.2 Aus Medizinethischer Sicht für die Ärzte und aus Sicht der Individual- und Sozialethik für die Impfling und Sorgeberechtigten
- 5. Eigenes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die ethischen Implikationen von Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob Impfungen mehr Schaden oder Nutzen stiften, unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte. Die Arbeit analysiert die Positionen verschiedener Akteure und sucht nach Lösungsansätzen für ethische Dilemmata.
- Ethische Grundlagen der Impfentscheidung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und die Rolle der STIKO
- Ethische Konflikte von Pharmakonzernen, Ärzten und Eltern
- Wirtschaftsethische Aspekte der Pharmaindustrie
- Medizin- und Sozialethische Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit wird durch die persönlichen Erfahrungen der Autorin als Mutter initiiert, die mit der kritischen Diskussion um Impfungen in Bayern konfrontiert wurde. Sie beleuchtet den Interessenskonflikt von STIKO-Mitgliedern und die Furchtappelltheorien in der Impfaufklärung. Die zentrale Frage der Arbeit ist, ob Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter mehr Schaden oder Nutzen bringen, betrachtet aus ethischer Perspektive. Die Arbeit gliedert sich in die Darstellung ethischer Grundlagen, einen Überblick über die Impfthematik, die ethischen Dilemmata der beteiligten Parteien, eine kritische Würdigung mit Lösungsansätzen und ein persönliches Fazit.
2. Impfthematik: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Impfstoffarten, die rechtliche Situation in Deutschland bezüglich Impfungen und den Zeitpunkt sowie mögliche Folgen von Impfungen. Es legt die medizinischen Grundlagen für die spätere ethische Diskussion dar, indem es die verschiedenen Aspekte der Impfungen beleuchtet und den Kontext für die ethischen Überlegungen im folgenden Kapitel schafft.
3. Ethische Dilemmata der einzelnen Konfliktparteien: Dieses Kapitel analysiert die ethischen Herausforderungen, denen Pharmakonzerne (inklusive Robert Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut), Ärzte und Impfkandidaten/Sorgeberechtigte gegenüberstehen. Es untersucht die potenziellen Interessenskonflikte und die unterschiedlichen moralischen Überzeugungen und Verantwortlichkeiten jedes Akteurs. Die unterschiedlichen Perspektiven und die damit verbundenen ethischen Spannungsfelder bilden den Schwerpunkt dieses Kapitels.
4. Kritische Würdigung und Lösungsvorschläge: Dieses Kapitel fasst die ethischen Hauptprobleme der Impfthematik zusammen und präsentiert verschiedene Lösungsansätze. Es analysiert die ethischen Herausforderungen aus wirtschafts- und medizinethischer Sicht, sowie aus der Sicht der Individual- und Sozialethik. Die Diskussion möglicher Lösungen für die identifizierten Dilemmata steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Impfungen, Säuglinge, Kleinkinder, Ethik, Moral, Medizinethik, Wirtschaftsethik, STIKO, Robert Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, Interessenskonflikt, Furchtappelltheorien, Rechtliche Situation, Impfstoffarten, ethische Dilemmata, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Ethische Implikationen von Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die ethischen Implikationen von Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter. Sie beleuchtet die Frage, ob Impfungen mehr Nutzen oder Schaden stiften, unter Berücksichtigung verschiedener ethischer Perspektiven. Die Arbeit analysiert die Positionen verschiedener Akteure (Pharmakonzerne, Ärzte, Eltern) und sucht nach Lösungsansätzen für ethische Dilemmata.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt ethische Grundlagen der Impfentscheidung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rolle der STIKO, ethische Konflikte der beteiligten Parteien (Pharmakonzerne, Ärzte, Eltern), wirtschaftsethische Aspekte der Pharmaindustrie sowie medizin- und sozialethische Perspektiven. Sie umfasst verschiedene Impfstoffarten, die rechtliche Situation in Deutschland, den Impfzeitpunkt und mögliche Impffolgen.
Welche Akteure werden in der ethischen Analyse betrachtet?
Die Arbeit analysiert die ethischen Dilemmata von Pharmakonzernen (inkl. Robert Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut), Ärzten (Haus- und Kinderärzte) und Impfkandidaten/Sorgeberechtigten. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen dieser Akteure untersucht und die damit verbundenen ethischen Spannungsfelder beleuchtet.
Welche ethischen Theorien und Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene ethische Konzepte, darunter Deskriptive und normative Ethik, Utilitarismus, Vertragstheorie, evolutionäre Ethik und Emotivismus. Sie wendet diese Konzepte auf die spezifischen ethischen Herausforderungen der Impfthematik an, insbesondere im Kontext von Medizinethik und Wirtschaftsethik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Impfthematik, ein Kapitel zu den ethischen Dilemmata der einzelnen Konfliktparteien, ein Kapitel zur kritischen Würdigung und Lösungsvorschläge sowie ein persönliches Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Bringen Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter mehr Schaden oder Nutzen, betrachtet aus ethischer Perspektive?
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Lösungsansätze für die identifizierten ethischen Dilemmata, betrachtet aus wirtschafts- und medizinethischer Sicht sowie aus der Sicht der Individual- und Sozialethik. Die genauen Lösungsvorschläge werden im entsprechenden Kapitel detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Impfungen, Säuglinge, Kleinkinder, Ethik, Moral, Medizinethik, Wirtschaftsethik, STIKO, Robert Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, Interessenskonflikt, Furchtappelltheorien, Rechtliche Situation, Impfstoffarten, ethische Dilemmata, Lösungsansätze.
Welche Rolle spielen die persönlichen Erfahrungen der Autorin?
Die Arbeit wird durch die persönlichen Erfahrungen der Autorin als Mutter initiiert, die mit der kritischen Diskussion um Impfungen in Bayern konfrontiert wurde. Diese Erfahrungen liefern den Kontext und die Motivation für die wissenschaftliche Untersuchung der Thematik.
- Citar trabajo
- Natalie Hebel (Autor), 2014, Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter. Impfstoffarten und ethisches Dilemma, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305817