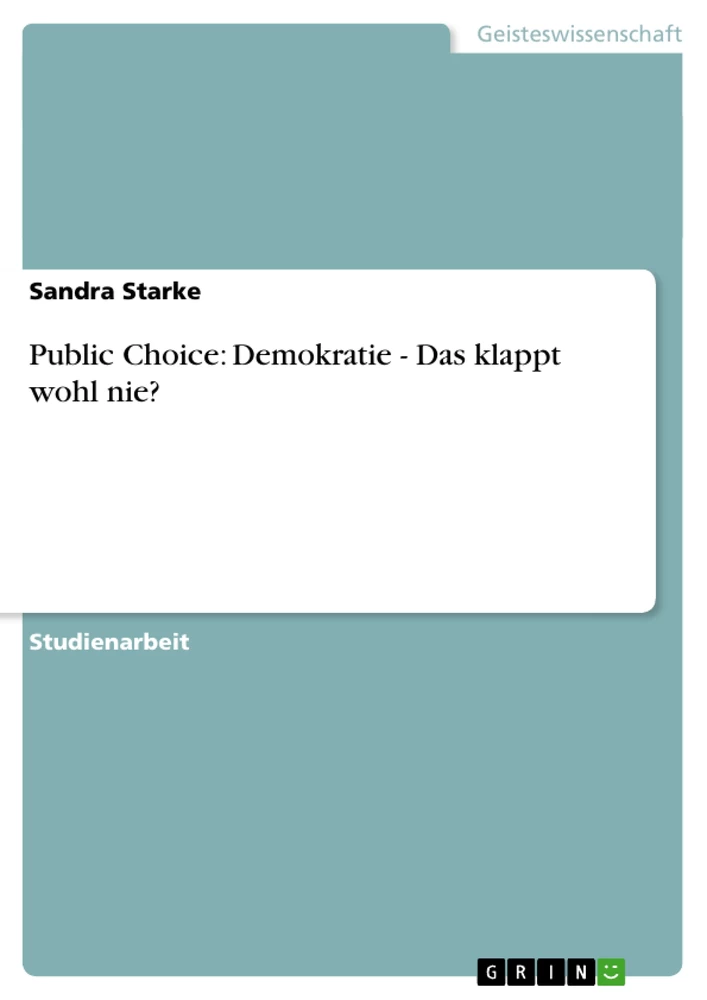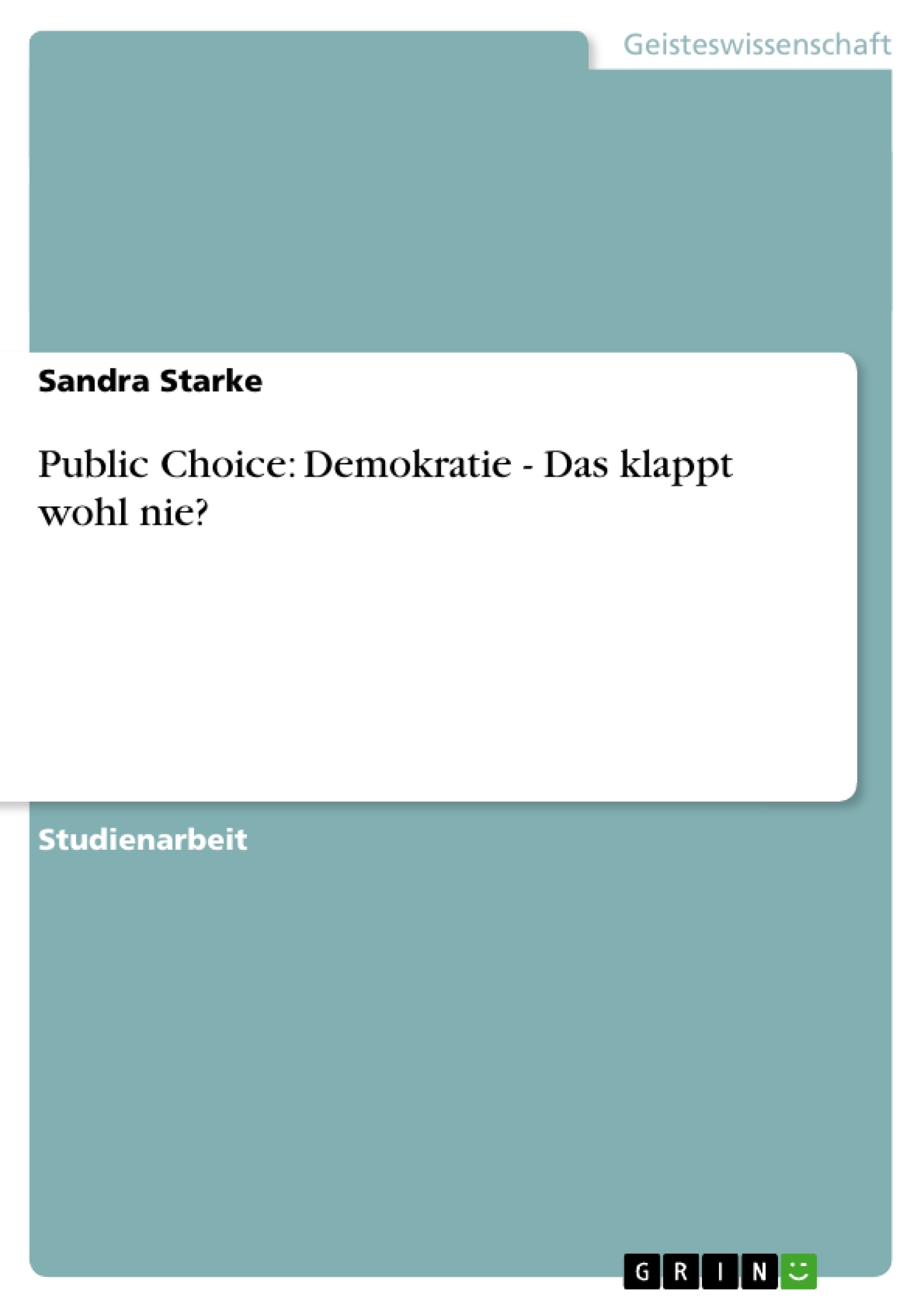Als ein fortschrittliches Land können wir als Regierungsform die Demokratie nennen. Alle sind gleichberechtigt, den Schwachen und Armen wird geholfen in Form von Unterstützung. Des weiteren bedeutet Demokratie, dass das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung des Staates teilhaben kann. Doch wie ist es zu erklären, dass sich in eben dieser Demokratie kleine Gruppen stärker durchsetzen können als große? Wieso können Monopole gebildet werden, die eigentlich entgegen den Interessen der allgemeinen Mehrheit stehen? Diese Fragen versucht die Arbeit mit Hilfe des „Public Choice – Ansatzes“ zu beantworten. Dabei wird unter anderem auf Mancur Olsons Gruppentheorie und Erich Weedes Rent-Seeking als Erklärungshilfen eingegangen, zudem wird James Buchanan mit einem Anwendungsbeispiel, welches die Theorie Olsons und Weedes miteinander verbindet, zum tragen kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Olsons Gruppentheorie
- Definitionen
- Kollektivgüter
- Individualgüter
- Staat
- Gruppen
- Free Rider Problem & Kollektives Handeln
- Weede: Rentseeking
- Begriffserläuterungen
- Auswirkungen des Rentseeking
- Buchanan - Anwendungsbeispiel
- Beispiel Wohlfahrtsstaat
- Lösungsvorschlag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, warum in Demokratien kleinere Gruppen trotz der Interessen der Mehrheit mehr Einfluss ausüben können. Sie beleuchtet dieses Phänomen anhand des „Public Choice“-Ansatzes, wobei die Gruppentheorie von Mancur Olson und das Rent-Seeking nach Erich Weede zentrale Erklärungshilfen liefern. James Buchanan wird mit einem Anwendungsbeispiel herangezogen, das Olsons und Weedes Theorien verbindet.
- Das Free-Rider-Problem im Kontext kollektiven Handelns
- Die Entstehung und Auswirkungen von Rent-Seeking
- Die Rolle von Interessengruppen in demokratischen Systemen
- Die Anwendung des Public Choice Ansatzes auf den Wohlfahrtsstaat
- Mögliche Lösungsansätze für die Diskrepanz zwischen Mehrheitsinteressen und politischem Einfluss
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Warum können sich in Demokratien kleine Gruppen stärker durchsetzen als große, obwohl dies den Interessen der Mehrheit widerspricht? Sie führt den „Public Choice“-Ansatz als methodischen Rahmen ein und kündigt die Verwendung der Gruppentheorie von Mancur Olson, des Rent-Seeking-Konzepts von Erich Weede und eines Anwendungsbeispiels von James Buchanan an, um die Fragestellung zu beantworten. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Olsons Gruppentheorie: Dieses Kapitel stellt Olsons Gruppentheorie vor, insbesondere seine „Logik des kollektiven Handelns“. Es definiert zentrale Begriffe wie Kollektivgüter und Individualgüter und beleuchtet das Problem des „Free-Riding“, also des Trittbrettfahrens, bei der Bereitstellung von Kollektivgütern. Die verschiedenen Gruppentypen nach Olson werden erläutert, und es wird dargelegt, unter welchen Bedingungen Interessengruppen zur Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstands beitragen.
Weede: Rentseeking: Das Kapitel widmet sich Erich Weedes Konzept des Rent-Seeking. Es erläutert den Begriff der Rente und des Rent-Seeking und beschreibt die Auswirkungen dieser Aktivitäten auf die Gesellschaft. Es wird analysiert, wie Rent-Seeking-Aktivitäten zu Ineffizienzen und einem verzerrten Ressourcenallokation führen und wie sie die demokratischen Prozesse beeinflussen können. Die Analyse konzentriert sich auf die Mechanismen und Folgen von Rent-Seeking-Verhalten.
Buchanan - Anwendungsbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein Anwendungsbeispiel von James Buchanan, das die Theorien von Olson und Weede verbindet. Es analysiert den Wohlfahrtsstaat unter dem Gesichtspunkt des Public Choice und zeigt, wie die Bereitstellung von Kollektivgütern durch den Staat zu Rent-Seeking-Aktivitäten führen kann. Das Kapitel legt dar, wie die Interaktion zwischen verschiedenen Interessengruppen die Gestaltung des Wohlfahrtsstaates beeinflusst und wie Ineffizienzen entstehen können. Darüber hinaus wird ein Lösungsvorschlag skizziert.
Schlüsselwörter
Public Choice, Mancur Olson, Gruppentheorie, Kollektivgüter, Individualgüter, Free Rider Problem, Erich Weede, Rent Seeking, Rent Seeking Society, James Buchanan, Wohlfahrtsstaat, Demokratie, Interessengruppen, kollektives Handeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Einflusses kleiner Gruppen in Demokratien
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, warum kleinere Gruppen in Demokratien trotz der Interessen der Mehrheit oft mehr politischen Einfluss ausüben können. Sie analysiert dieses Phänomen mithilfe des „Public Choice“-Ansatzes.
Welche Theorien werden zur Erklärung des Problems herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf die Gruppentheorie von Mancur Olson, das Rent-Seeking-Konzept von Erich Weede und ein Anwendungsbeispiel von James Buchanan. Diese Theorien werden kombiniert, um das Problem des überproportionalen Einflusses kleiner Gruppen zu erklären.
Was ist die „Logik des kollektiven Handelns“ nach Olson?
Olsons Gruppentheorie beschreibt die Herausforderungen bei der Bereitstellung von Kollektivgütern. Das „Free-Rider-Problem“ besagt, dass Individuen dazu neigen, von den Leistungen anderer zu profitieren, ohne selbst etwas beizutragen. Dies erschwert die Bildung und den Erfolg großer Interessengruppen.
Was ist Rent-Seeking nach Weede?
Rent-Seeking beschreibt Aktivitäten, die darauf abzielen, künstlich erzeugte Monopolrenten zu erlangen. Diese Aktivitäten führen zu Ineffizienzen, verzerrter Ressourcenallokation und beeinflussen demokratische Prozesse negativ.
Wie verbindet Buchanans Anwendungsbeispiel die Theorien von Olson und Weede?
Buchanans Beispiel analysiert den Wohlfahrtsstaat unter dem Gesichtspunkt des Public Choice. Es zeigt, wie die staatliche Bereitstellung von Kollektivgütern zu Rent-Seeking-Aktivitäten führen kann und wie die Interaktion verschiedener Interessengruppen die Gestaltung des Wohlfahrtsstaates beeinflusst.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Public Choice, Gruppentheorie (Olson), Kollektivgüter, Individualgüter, Free-Rider-Problem, Rent-Seeking, Wohlfahrtsstaat, Demokratie und Interessengruppen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Olsons Gruppentheorie, ein Kapitel zu Weedes Rent-Seeking-Konzept und ein Kapitel mit einem Anwendungsbeispiel von Buchanan zum Wohlfahrtsstaat. Jedes Kapitel fasst die jeweilige Theorie zusammen und analysiert deren Relevanz für die Fragestellung.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum können sich in Demokratien kleinere Gruppen stärker durchsetzen als große, obwohl dies den Interessen der Mehrheit widerspricht?
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit skizziert mögliche Lösungsansätze für die Diskrepanz zwischen Mehrheitsinteressen und dem politischen Einfluss kleiner Gruppen, die im Kapitel zu Buchanans Anwendungsbeispiel angedeutet werden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für politische Prozesse, die Funktionsweise von Demokratien, Interessengruppen und den „Public Choice“-Ansatz interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und verwandter Disziplinen.
- Citation du texte
- Sandra Starke (Auteur), 2002, Public Choice: Demokratie - Das klappt wohl nie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30569