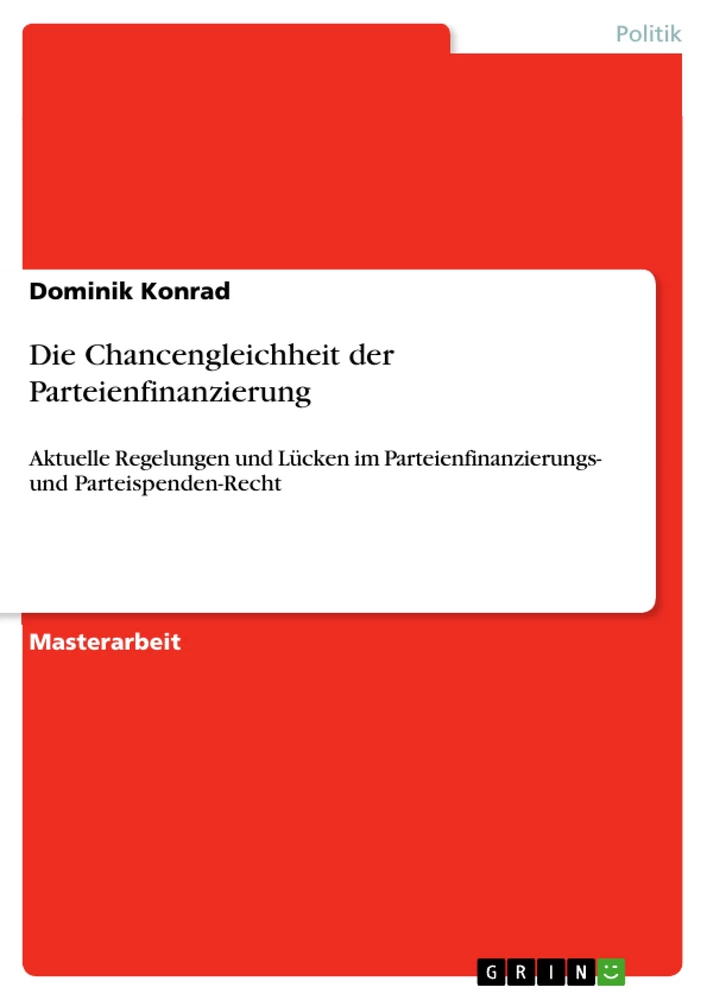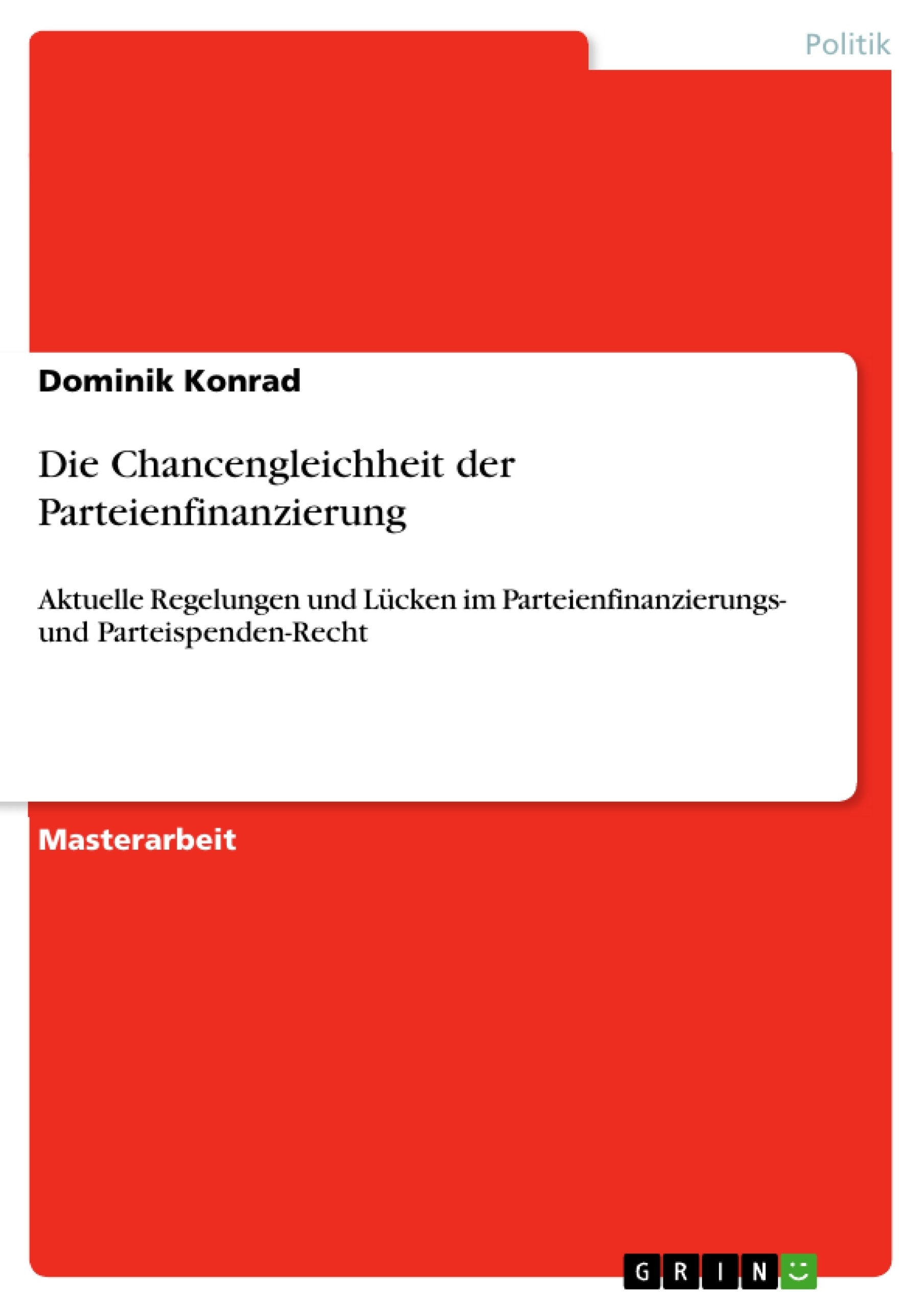Wettbewerb ist ein zentraler Aspekt der Politik. Die Konkurrenz zwischen verschiedenen Interessen und Überzeugungen bestimmt den politischen Alltag der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik. Die wichtigsten Träger dieses Wettbewerbs sind die politischen Parteien. Sie nehmen verschiedene gesellschaftliche und politische Strömungen ausgleichend in sich auf und vertreten diese nach außen hin und in Konkurrenz zu anderen Parteien. Um diese Aufgabe zu erfüllen, brauchen die Parteien Geld. Die staatlichen Regelungen zur Finanzierung der Parteien sind Teil der „Regeln des Machterwerbs“.
Parteien haben im gesamten Bereich des politischen Wettbewerbs einen Anspruch auf Chancengleichheit. Diese Gleichbehandlungspflicht gilt auch im Hinblick auf den Erwerb von Finanzmitteln. Eine Ungleichbehandlung von Parteien bei Fragen der Finanzierung kann diesen ungerechtfertigte Erfolge oder Misserfolge bei Wahlen bescheren. Ein finanzielles Ungleichgewicht würde so zu einem politischen Ungleichgewicht werden. Die Sicherung von gleichen Ausgangsbedingungen für die Parteien beim Erwerb von Finanzmitteln ist daher ein elementarer Bestandteil für die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, ob die politische Chancengleichheit in der Parteienfinanzierung gewahrt ist.
Hierzu wird zunächst die verfassungsrechtliche Herleitung der politischen Chancengleichheit erörtert. Sie stellt eine akademische Streitfrage dar und wurde zuletzt in dieser Ausführlichkeit von Andreas Kißlinger zur Mitte der neunziger Jahre untersucht. Daraufhin folgt eine systematische Untersuchung der Parteienfinanzierungsregelungen des Parteiengesetzes. Diese Arbeit wertet dabei eine Fülle an wissenschaftlicher Literatur aus. Sie orientiert sich an dem Urteil von Sachverständigen-Kommissionen zu Fragen der Parteienfinanzierung, Gesetzesbegründungen zu Änderungen des Parteiengesetzes, am zweijährlich erscheinenden Bericht des Bundestagspräsidenten zur finanziellen Entwicklung der Parteien, Entscheiden des Bundesverfassungsgerichts zu Fragen der Parteienfinanzierung, einer Vielzahl an Parteiengesetz- und Grundgesetzkommentaren, rechtswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Aufsätzen, Tagungsbänden und Monographien. Damit bietet sie erstmalig einen konzentrierten Blick auf alle, sich aus dem Parteiengesetz ergebenden Regelungsdefizite und Gesetzeslücken der Parteienfinanzierung.
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil: Das Parteienfinanzierungsrecht und der politische Wettbewerb
- 1.1 Chancengleichheit der Parteienfinanzierung und politischer Wettbewerb
- 1.2 Definition des Begriffs „Parteienfinanzierung“
- 1.3 Gang der Untersuchung
- Zweiter Teil: Politische Chancengleichheit und Verfassungsrecht
- 2.1 Die Bedeutung der politischen Chancengleichheit
- 2.2 Die verfassungsrechtliche Herleitung der politischen Chancengleichheit
- 2.2.1 Politische Chancengleichheit als individuelles und kollektives Recht
- 2.2.2 Der Wandel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur politischen Chancengleichheit
- 2.2.3 Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
- 2.2.4 Folgen für das Parteienfinanzierungsrecht
- Dritter Teil: Die politische Chancengleichheit im Parteienwettbewerb
- 3.1 Vier verfassungsrechtliche Status der politischen Parteien
- 3.2 Die Chancengleichheit der Parteien
- 3.2.1 Chancengleichheit und Freiheit
- 3.2.2 Chancengleichheit und Transparenz
- 3.2.3 Chancengleichheit und innerparteiliche Demokratie
- 3.3 Die besondere Staatsnähe der Parteien
- 3.4 Das Problem der Entscheidung in eigener Sache
- 3.4.1 Sachverständigen-Kommissionen als Schlichter
- 3.4.2 Parteienwettbewerb und übermäßige Staatsfinanzierung
- Vierter Teil: Verfassungsrechtliche Voraussetzungen für die Finanzautonomie der Parteien
- 4.1 Aufgabenwahrnehmung als primäre Voraussetzung für die Finanz-autonomie der Parteien
- 4.2 Einschränkung der Finanzautonomie durch Sanktionen des Parteiengesetzes
- 4.3 Einschränkung der Finanzautonomie durch Entscheide des Bundesverfassungsgerichts
- 4.4 Die gehemmte Schlichtungsfunktion des Bundesverfassungsgerichts in Fragen der Parteienfinanzierung
- Fünfter Teil: Die Selbstfinanzierung politischer Parteien
- 5.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen der Selbstfinanzierung politischer Parteien
- 5.2 Der parteiengesetzliche Einnahmebegriff
- 5.3 Einnahmetitel gemäß Parteiengesetz
- 5.3.1 Mitgliedsbeiträge
- 5.3.2 Mandatsträgerbeiträge
- 5.3.3 Unternehmenstätigkeiten und Beteiligungen
- 5.3.4 Einnahmen aus der allgemeinen Tätigkeit der Parteien und Sponsoring
- 5.3.5 Sonstige Einnahmen
- Sechster Teil: Das Parteispendenrecht
- 6.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen des Parteispendenrechts
- 6.2 Der parteienrechtliche Spendenbegriff
- 6.2.1 Aufwandsspenden
- 6.2.2 Direktspenden
- 6.3 Chancengleichheit und Parteispendenrecht
- 6.4 Parteiengesetzliche Vorschriften in Bezug auf die Spendenhöhe
- 6.4.1 Publikationspflicht von Spenden und sonstigen Einnahmen über 10 000 €
- 6.4.2 Publikationspflicht von Spenden über 50 000 €
- 6.4.3 Bargeld- und Auslandsspenden
- 6.4.4 Anonyme Spenden
- 6.4.5 Eine Anhebung der Publizitätspflichten und Bagatellgrenzen ist geboten
- 6.5 Parteiengesetzliche Spendenannahmeverbote
- 6.5.1 Spenden öffentlich-rechtlicher Körperschaften
- 6.5.2 Spenden von Parlamentsfraktionen
- 6.5.3 Spenden gemeinnütziger Organisationen
- 6.5.4 Spenden aus dem Ausland
- 6.5.5 Spendenweiterleitung durch Berufsverbände
- 6.5.6 Spenden von Unternehmen, die teilweise in öffentlicher Hand sind
- 6.5.7 Spenden ohne feststellbare Herkunft und weitergeleitete Spenden Dritter
- 6.5.8 Gegenleistungsspenden
- 6.5.9 Spendenwerbung Dritter auf Provisionsbasis
- Siebter Teil: Die staatliche Teilfinanzierung politischer Parteien
- 7.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen der staatlichen Parteienfinanzierung
- 7.1.1 Chancengleichheit und staatliche Teilfinanzierung
- 7.1.2 Chancengleichheit und die Parteienfinanzierung auf kommunaler Ebene
- 7.2 Bedingungen zur Teilnahme an der staatlichen Teilfinanzierung
- 7.2.1 Kriterien für die Anerkennung des Parteistatus
- 7.2.2 Wahlerfolgsbezogene Hürden
- 7.2.3 Sonstige Regelungen und Ausnahmen zur Teilnahme an der staatlichen Teilfinanzierung
- 7.3 Bemessung und Höhe wahlerfolgsbezogener Teilfinanzierung
- 7.4 Bemessung und Höhe zuwendungsbezogener Teilfinanzierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Chancengleichheit der Parteienfinanzierung im Kontext des politischen Wettbewerbs. Sie analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen der politischen Chancengleichheit und die Bedeutung der Finanzautonomie für Parteien im deutschen Parteiensystem. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Einnahmequellen politischer Parteien, darunter Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge, Unternehmenstätigkeiten und Parteispenden.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der politischen Chancengleichheit
- Finanzautonomie der politischen Parteien
- Chancengleichheit im Parteienwettbewerb
- Selbstfinanzierung politischer Parteien
- Parteispendenrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit stellt das Parteienfinanzierungsrecht und seine Bedeutung für den politischen Wettbewerb dar. Er definiert den Begriff der Parteienfinanzierung und skizziert den Gang der Untersuchung.
Der zweite Teil behandelt die verfassungsrechtliche Herleitung der politischen Chancengleichheit. Er analysiert die Bedeutung der politischen Chancengleichheit als individuelles und kollektives Recht und beleuchtet den Wandel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Der dritte Teil untersucht die politische Chancengleichheit im Parteienwettbewerb. Er betrachtet die verschiedenen Status der politischen Parteien im Verfassungsrecht und analysiert die Bedeutung von Freiheit, Transparenz und innerparteilicher Demokratie für die Chancengleichheit.
Der vierte Teil beschäftigt sich mit den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Finanzautonomie der Parteien. Er analysiert die Rolle der Aufgabenwahrnehmung der Parteien und die Einschränkungen der Finanzautonomie durch das Parteiengesetz und das Bundesverfassungsgericht.
Der fünfte Teil befasst sich mit der Selbstfinanzierung politischer Parteien. Er untersucht die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Selbstfinanzierung und analysiert die verschiedenen Einnahmetitel gemäß Parteiengesetz.
Der sechste Teil behandelt das Parteispendenrecht. Er analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Parteispendenrechts, den Spendenbegriff und die parteiengesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Spendenhöhe und Spendenannahmeverbote.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit befasst sich mit zentralen Themen der Parteienfinanzierung und der politischen Chancengleichheit. Die Arbeit analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen der politischen Chancengleichheit, die Finanzautonomie der Parteien, das Parteispendenrecht und die Selbstfinanzierung politischer Parteien. Die Arbeit betrachtet dabei auch die Bedeutung von Transparenz, innerparteilicher Demokratie und dem Einfluss von Unternehmen und Spenden auf den politischen Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Chancengleichheit bei der Parteienfinanzierung wichtig?
Sie ist elementar für die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie, da finanzielle Ungleichgewichte zu ungerechtfertigten politischen Vorteilen führen können.
Wie wird politische Chancengleichheit verfassungsrechtlich hergeleitet?
Sie ergibt sich aus dem Status der Parteien als verfassungsrechtlich notwendige Bestandteile der Willensbildung und wird sowohl als individuelles als auch kollektives Recht betrachtet.
Was sind die Haupteinnahmequellen politischer Parteien in Deutschland?
Dazu gehören Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge, Parteispenden, staatliche Teilfinanzierung und Einnahmen aus Unternehmenstätigkeiten.
Ab welcher Höhe müssen Parteispenden veröffentlicht werden?
Spenden über 10.000 € unterliegen der Publikationspflicht im Rechenschaftsbericht, während Spenden über 50.000 € dem Bundestagspräsidenten sofort gemeldet werden müssen.
Welche Spendenannahmeverbote gibt es laut Parteiengesetz?
Verboten sind unter anderem Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, anonyme Spenden über 500 € und Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland (mit Ausnahmen).
Was ist das Problem der „Entscheidung in eigener Sache“?
Es beschreibt das Dilemma, dass die Parteien im Bundestag selbst über die Regeln und die Höhe ihrer eigenen staatlichen Finanzierung entscheiden.
- Citation du texte
- Dominik Konrad (Auteur), 2015, Die Chancengleichheit der Parteienfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305140