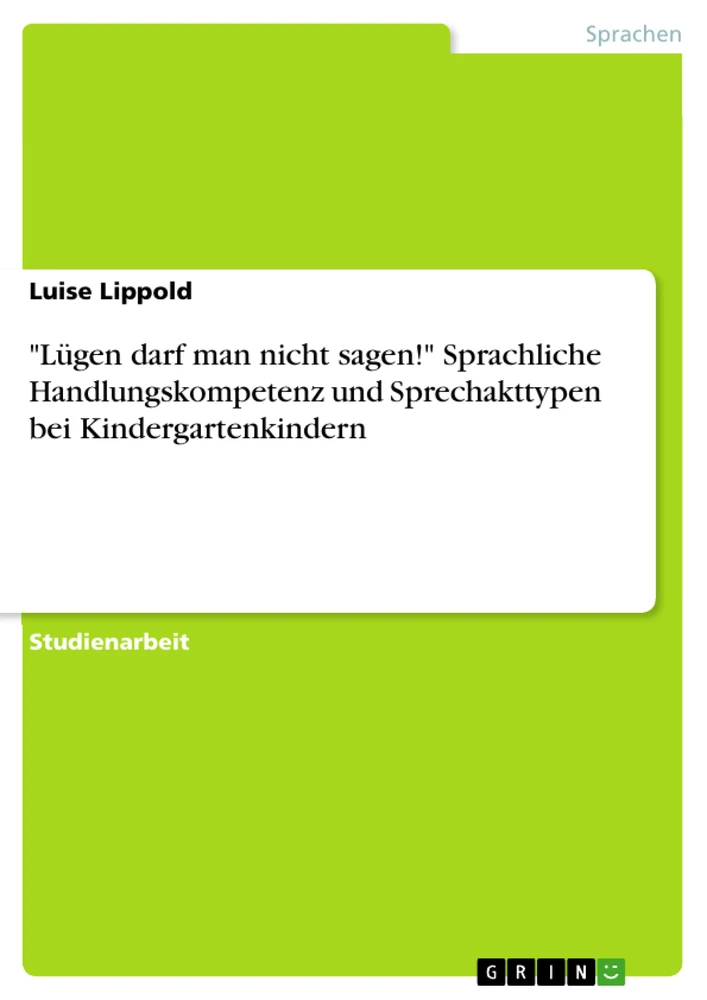Ziel dieser Arbeit soll es sein, das Thema „Sprachliche Handlungskompetenz und Sprechakttypen bei Kindergartenkindern“ in den Fokus zu setzen. Exemplarisch sollen diese Theorieaspekte an dem im Anhang befindlichen Transkript des Youtube-Videos „Lügen darf man nicht sagen“ verdeutlicht werden.
Darüber hinaus möchte ich in einem kurzen abschließenden Exkurs Phänomene pragmatischer Störungen bei Kindern in den ersten Entwicklungsjahren theoretisch untersuchen. Meinen Ausführungen soll nun ein Abriss zum Spracherwerb und der Sprachentwicklung, vor allem in Verbindung mit der Pragmatik, vorangehen.
Betrachtet man einen Raum in dem sich Kindergartenkinder aufhalten, so dürfte man einer Vielzahl unterschiedlichster Kommunikationsformen und -situationen begegnen. Die Jungen und Mädchen in einer Kindergartengruppe können in einem Moment heftig um Spielsachen streiten, im nächsten Moment über ein mögliches Friedensangebot diskutieren und im wieder nächsten Augenblick lebhaft eine erzählte Geschichte weiterführen. In der sprachlichen Interaktion zwischen ihnen finden komplizierte Kommunikationsabläufe statt, die für Erwachsene in ihrer Komplexität manchmal nur schwer zu durchdringen sind.
Bereits Säuglinge treten mit ihrem sozialen Umfeld in Kontakt. Durch Schreien, Brabbeln, Töne, Mimik, Gestik und andere Verhaltensweisen machen sie auf sich aufmerksam und vertreten so ihre noch überschaubaren Interessengebiete. In ihrer voranschreitenden Entwicklung nehmen sie sich ihrer Lautsprache an, wodurch sie mehr und mehr kommunikative Kompetenzen erlangen und auch Äußerungen und Sichtweisen von anderen reflektieren können. Mit wachsendem Wortschatz gelingt es den Mädchen und Jungen, das eigene Denken zu organisieren. Sprache erfüllt hier nicht nur kommunikative, kognitive und affektive sondern auch epistemologische Funktionen. Darüber hinaus vollziehen sich die sprachlichen Äußerungen und einzelnen Sprachakte der Kinder auch immer als Handlung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Spracherwerb und Sprachentwicklung
- 3. Sprachliche Handlungskompetenz von Kindern
- 4. Die Sprechakttheorie
- 5. Sprechakttypen bei Kindern am Beispiel einer empirischen Untersuchung
- 6. Exkurs: Pragmatische Störungen
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit fokussiert sich auf die sprachliche Handlungskompetenz und Sprechakttypen bei Kindergartenkindern. Sie verknüpft theoretische Aspekte der Sprechakttheorie mit empirischen Beobachtungen, die exemplarisch an einem Transkript verdeutlicht werden. Ein Exkurs beleuchtet pragmatische Störungen in der frühkindlichen Entwicklung.
- Spracherwerb und Sprachentwicklung im frühen Kindesalter
- Sprachliche Handlungskompetenz von Kindergartenkindern
- Sprechakttheorie und deren Anwendung auf kindliche Äußerungen
- Empirische Untersuchung von Sprechakttypen bei Kindern
- Pragmatische Störungen in der frühkindlichen Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die vielfältigen Kommunikationsformen in Kindergartenräumen und hebt die Komplexität der frühkindlichen Interaktion hervor. Sie führt in die Thematik der sprachlichen Handlungskompetenz ein und kündigt den Fokus der Arbeit auf die Verbindung von Theorie und empirischer Untersuchung an. Der Bezug zur Pragmatik als theoretischem Rahmen wird bereits hier hergestellt, um die Handlungsdimension sprachlicher Äußerungen zu betonen. Die Arbeit verspricht eine exemplarische Veranschaulichung theoretischer Aspekte anhand eines Transkripts und einen Exkurs zu pragmatischen Störungen.
2. Spracherwerb und Sprachentwicklung: Dieses Kapitel untersucht den Spracherwerbsprozess bei Kindern, beginnend mit der perzeptiven Fähigkeit von Säuglingen, Sprache wahrzunehmen und zu verarbeiten. Es beschreibt die Entwicklung von der Lautproduktion zum Wortschatzerwerb und der zunehmenden Komplexität von Satzstrukturen. Der Spracherwerb wird als Selektionsprozess im Lautrepertoire verstanden, wobei die Fähigkeit zur Sprachproduktion langsamer entwickelt wird als das Sprachverständnis. Der Kapitel beleuchtet auch die pragmatischen Aspekte der Sprachentwicklung, inklusive Deixis und Sprechakte, und betont die Wechselwirkung zwischen Pragmatikerwerb und Grammatikerwerb. Die Bedeutung der sozialen Interaktion und der Rolle der Familie im Spracherwerbsprozess wird ebenfalls hervorgehoben. Das Kapitel stellt den Zusammenhang zwischen kognitiver, sozialer und sprachlicher Entwicklung dar, wobei die Kommunikation als essentieller Faktor für die kindliche Entwicklung herausgestellt wird.
3. Sprachliche Handlungskompetenz von Kindern: [Ersatztext - Der Originaltext bietet hier keine detaillierten Informationen. Dieser Abschnitt würde im vollständigen Text die Entwicklung der sprachlichen Handlungskompetenz im Kontext der frühkindlichen Sprachentwicklung beschreiben und theoretische Grundlagen für die Analyse der im Folgenden behandelten empirischen Daten legen. Es würde wahrscheinlich die verschiedenen Aspekte der kommunikativen Kompetenz von Kindern beleuchten, wie z.B. die Fähigkeit, Sprechakte zu bilden und zu verstehen, die Berücksichtigung des Kontextes, die Anpassung der Sprache an den Gesprächspartner etc.]
4. Die Sprechakttheorie: [Ersatztext - Der Originaltext bietet hier keine detaillierten Informationen. Dieser Abschnitt würde die relevanten theoretischen Grundlagen der Sprechakttheorie vorstellen, die für die Analyse der kindlichen Sprechakte in der empirischen Untersuchung verwendet werden. Dies könnte z.B. die Unterscheidung zwischen illokutionärer Kraft und perlokutionärer Wirkung oder die Klassifizierung verschiedener Sprechakttypen umfassen. ]
5. Sprechakttypen bei Kindern am Beispiel einer empirischen Untersuchung: [Ersatztext - Der Originaltext bietet hier keine detaillierten Informationen. Dieses Kapitel würde die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Sprechakttypen bei Kindern vorstellen. Es würde wahrscheinlich die Methodik der Untersuchung beschreiben (z.B. die Art der Datenerhebung und -analyse), die untersuchten Sprechakttypen und die Ergebnisse der Analyse präsentieren. Die Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Sprechakttheorie und der kindlichen Sprachentwicklung wäre ein wichtiger Bestandteil dieses Kapitels.]
6. Exkurs: Pragmatische Störungen: [Ersatztext - Der Originaltext bietet hier keine detaillierten Informationen. Dieser Exkurs würde verschiedene Arten von pragmatischen Störungen bei Kindern thematisieren und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation beschreiben. Es würde wahrscheinlich theoretische Konzepte und mögliche Ursachen für diese Störungen vorstellen. ]
Schlüsselwörter
Sprachliche Handlungskompetenz, Sprechakttypen, Kindergartenkinder, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Pragmatik, Empirische Untersuchung, Pragmatische Störungen, Frühkindliche Kommunikation
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Sprachliche Handlungskompetenz von Kindergartenkindern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Handlungskompetenz und die Sprechakttypen von Kindergartenkindern. Sie verbindet theoretische Aspekte der Sprechakttheorie mit empirischen Beobachtungen, die anhand eines Transkripts veranschaulicht werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung von Theorie und Praxis und der Berücksichtigung pragmatischer Störungen in der frühkindlichen Entwicklung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Spracherwerb und die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter, die sprachliche Handlungskompetenz von Kindergartenkindern, die Sprechakttheorie und deren Anwendung auf kindliche Äußerungen, eine empirische Untersuchung von Sprechakttypen bei Kindern sowie pragmatische Störungen in der frühkindlichen Sprachentwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und beschreibt die Komplexität frühkindlicher Interaktion. Kapitel 2 (Spracherwerb und Sprachentwicklung) untersucht den Spracherwerbsprozess von der Wahrnehmung bis zur komplexen Satzbildung. Kapitel 3 (Sprachliche Handlungskompetenz von Kindern) beschreibt die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. Kapitel 4 (Die Sprechakttheorie) legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 5 (Sprechakttypen bei Kindern am Beispiel einer empirischen Untersuchung) präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Kapitel 6 (Exkurs: Pragmatische Störungen) behandelt pragmatische Störungen bei Kindern. Kapitel 7 (Schlussbetrachtung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methode wurde in der empirischen Untersuchung angewendet?
Der Text enthält keine detaillierten Informationen zur Methodik der empirischen Untersuchung. Diese Details wären im vollständigen Text zu finden und würden die Art der Datenerhebung und -analyse sowie die untersuchten Sprechakttypen umfassen.
Welche Ergebnisse wurden in der empirischen Untersuchung erzielt?
Der Text bietet keine detaillierten Informationen über die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Diese Ergebnisse und deren Interpretation im Kontext der Sprechakttheorie und der kindlichen Sprachentwicklung werden im vollständigen Text vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachliche Handlungskompetenz, Sprechakttypen, Kindergartenkinder, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Pragmatik, Empirische Untersuchung, Pragmatische Störungen, Frühkindliche Kommunikation.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit Spracherwerb, Sprachentwicklung und der pragmatischen Kompetenz von Kindern beschäftigt. Sie ist auf den Kontext der frühkindlichen Bildung ausgerichtet.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht in diesem FAQ enthalten. Weitere Informationen zur Beschaffung des vollständigen Textes sind nicht verfügbar.
- Citation du texte
- Luise Lippold (Auteur), 2015, "Lügen darf man nicht sagen!" Sprachliche Handlungskompetenz und Sprechakttypen bei Kindergartenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305125