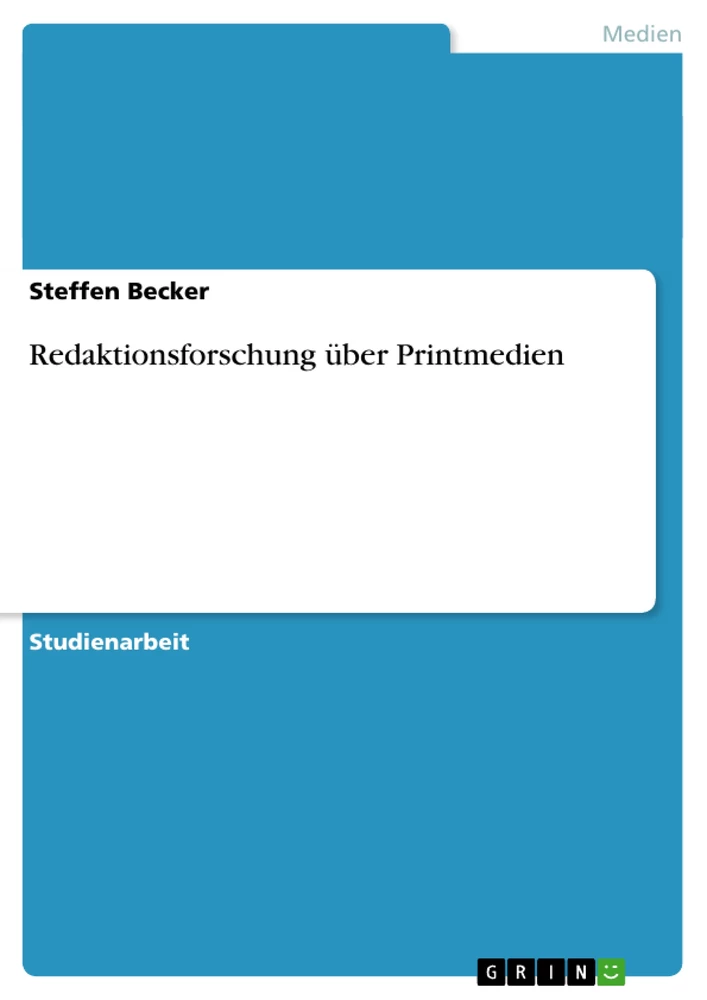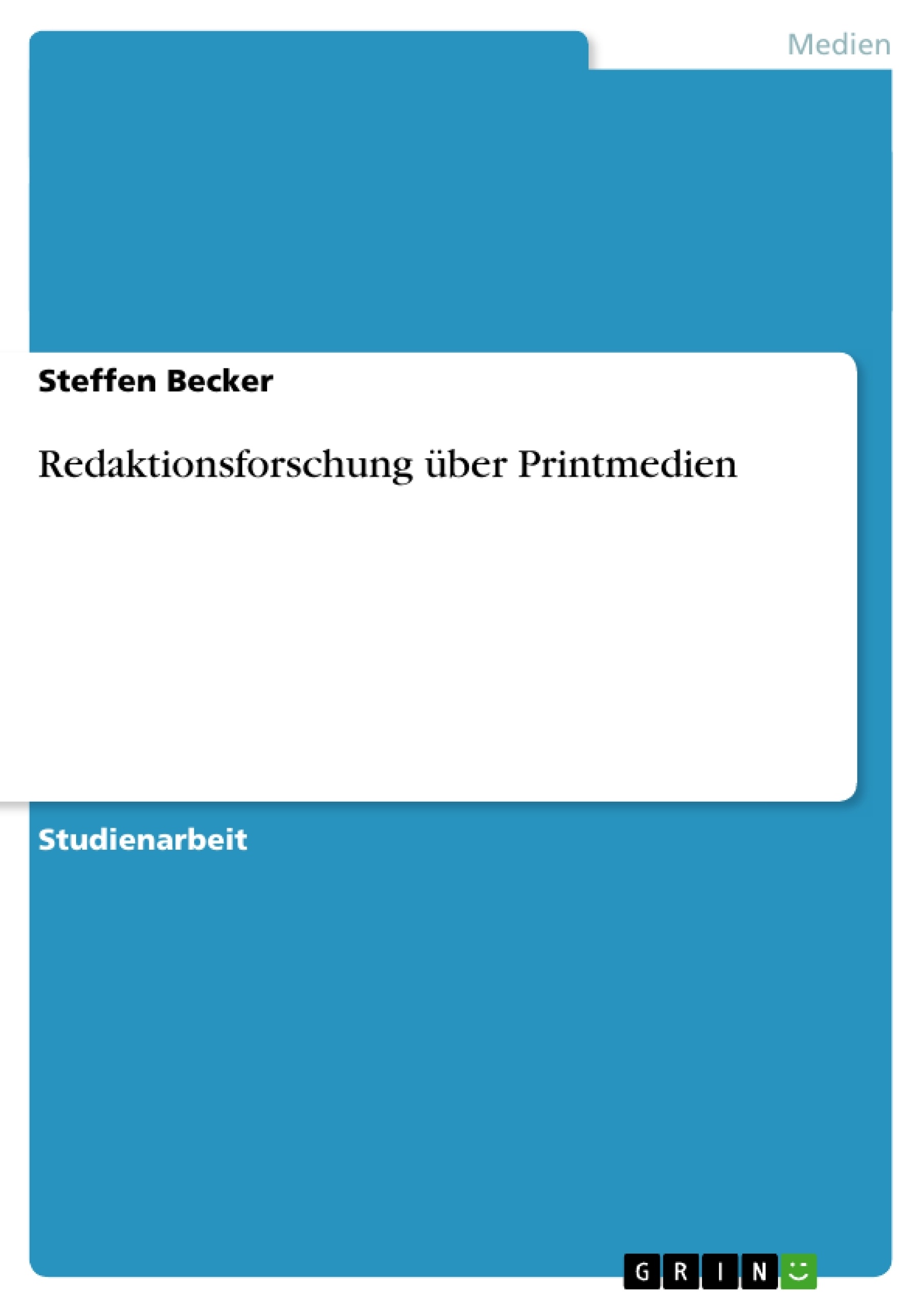Für die Süddeutsche Zeitung arbeiten hunderte fest angestellter Redakteure
und ein Vielfaches an freien Mitarbeitern. Jeden Tag füllen
sie, aufgeteilt in Ressorts wie Politik, Wirtschaft, Feuilleton, Sport,
Lokales, Medien, Wissenschaft oder Reise an die 60 Seiten1. Zahlreiche
eigenständige wöchentliche Beilagen (SZ Extra, SZ-Magazin, SZ
Wochenende) und Sonderseiten ergänzen dieses Angebot. Gut 40
Korrespondenten und mehrere Dutzend vor Ort angesiedelte Autoren
beobachten unterstützt von freien Mitarbeiter das deutsche und internationale
Geschehen. Insgesamt stehen fast 10.000 Journalisten auf den Gehalts- und Honorarlisten der Süddeutschen Zeitung. Wie
bringt dieser riesige Apparat mit seinen unzähligen Verzweigungen es
fertig, fast jeden Tag ein neues Produkt, die aktuelle SZ-Ausgabe, zu
produzieren? Eine Frage, die von der Kommunikationswissenschaft
lange Zeit kaum und auch heute im Vergleich zu anderen Forschungsfeldern
eher stiefmütterlich behandelt wurde bzw. wird. Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die bisherigen Versuche,
die „Black box“ (Print-)Redaktion auszuleuchten, ihre Mechanismen
offen zu legen. In Frage-Antwort-Form werden die wichtigsten
Aspekte der Redaktionsforschung vorgestellt. Dazu gehört die geschichtliche
Entwicklung der Redaktion und deren Analyse, die Auswirkungen
auf die Themenagenda, die Folgen des technischen Fortschritts
in der jüngeren Vergangenheit sowie aktuelle Konzepte in der
deutschen Presselandschaft zur Umstrukturierung der Redaktionen.
Als Grundlage für diese Betrachtungen erfolgt zu Beginn eine genaue
Darstellung des Systems Redaktion bzw. dessen Funktionsweise.
Diese stützt sich im wesentlichen auf die Arbeiten von Manfred
Rühl und Ulrich Hienzsch. Rühl benutzte bei seiner Pionierstudie über
die Nürnberger Nachrichten den funktional-strukturellen Ansatzes
Niklas Luhmanns, Hienzsch wiederum bediente sich der Theorie der
Kybernetik. 1 62 Seiten am 8.7.2003
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie funktionieren Redaktionen?
- Die Redaktion in der Systemtheorie
- Und wie funktioniert das auf der praktischen Ebene? - Das Entscheidungshandeln
- Die Redaktion in der Theorie der Kybernetik
- Wie ist die Redaktion modernen Typs entstanden?
- Warum hat sich die Ressortaufteilung in Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Lokales durchgesetzt?
- Was bedeutet diese Aufteilung für die Themenbehandlung?
- Wie kann dieser Zustand überwunden werden? – Neue Formen der Redaktionsorganisation
- Was lernen wir aus all dem? - Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Funktionsweise von Redaktionen und analysiert die Entwicklung der modernen Redaktionsstruktur. Die Arbeit untersucht die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft und beleuchtet die Auswirkungen der Systemtheorie und der Kybernetik auf die Redaktionsforschung.
- Die Funktionsweise von Redaktionen im Kontext der Systemtheorie
- Die Entstehung der modernen Redaktionsstruktur
- Die Bedeutung der Ressortaufteilung für die Themenbehandlung
- Die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Redaktionsorganisation
- Neue Konzepte zur Umstrukturierung von Redaktionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der Redaktionsforschung dar und erläutert den theoretischen Ansatz der Studie.
- Wie funktionieren Redaktionen?: Das Kapitel analysiert die Funktionsweise von Redaktionen anhand der Systemtheorie und der Kybernetik.
- Wie ist die Redaktion modernen Typs entstanden?: Das Kapitel untersucht die historische Entwicklung der Redaktionsstruktur.
- Warum hat sich die Ressortaufteilung in Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Lokales durchgesetzt?: Das Kapitel analysiert die Gründe für die Ressortaufteilung und ihre Auswirkungen auf die Themenbehandlung.
- Was bedeutet diese Aufteilung für die Themenbehandlung?: Das Kapitel untersucht die Folgen der Ressortaufteilung für die Berichterstattung.
- Wie kann dieser Zustand überwunden werden? – Neue Formen der Redaktionsorganisation: Das Kapitel stellt neue Konzepte zur Umstrukturierung von Redaktionen vor.
Schlüsselwörter
Redaktionsforschung, Systemtheorie, Kybernetik, Journalismus, Redaktionsstruktur, Ressortaufteilung, Themenagenda, technische Entwicklung, Umstrukturierung.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Redaktionsforschung?
Sie untersucht die inneren Mechanismen und Entscheidungsprozesse in Zeitungsredaktionen, oft bezeichnet als die „Black Box“ des Journalismus.
Wie wird eine Redaktion systemtheoretisch betrachtet?
In Anlehnung an Niklas Luhmann wird die Redaktion als ein soziales System analysiert, das durch spezifische Selektionsentscheidungen Komplexität reduziert.
Warum gibt es die Ressortaufteilung (Politik, Sport, etc.)?
Die Ressortstruktur entstand historisch zur Arbeitserleichterung und Spezialisierung, prägt aber heute massiv, welche Themen wie gewichtet werden.
Was bedeutet "Kybernetik" in der Redaktionsforschung?
Dieser Ansatz betrachtet die Redaktion als ein selbststeuerndes Regelsystem, das auf Rückkopplungen der Umwelt und des Marktes reagiert.
Wie viele Journalisten arbeiten für eine große Zeitung wie die SZ?
Inklusive fester Redakteure, Korrespondenten und freier Mitarbeiter können fast 10.000 Personen an der Produktion beteiligt sein.
- Arbeit zitieren
- Steffen Becker (Autor:in), 2003, Redaktionsforschung über Printmedien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30479