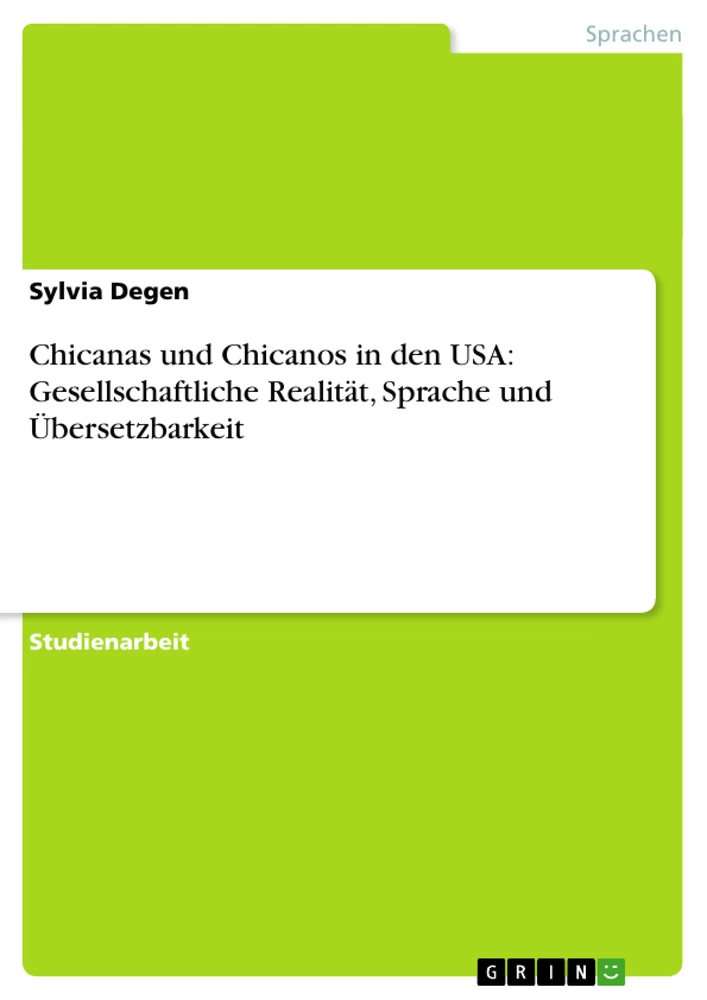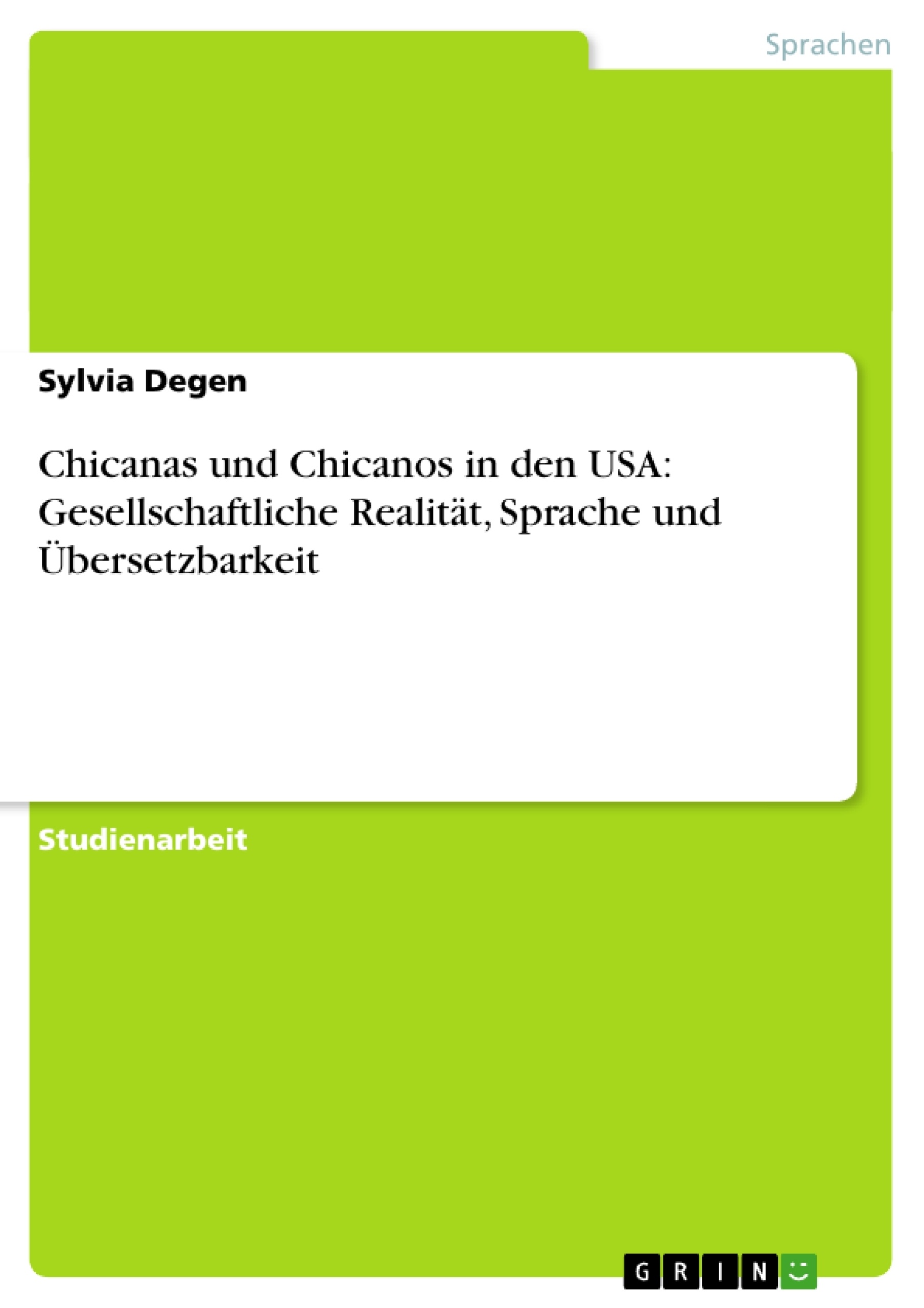Meine Untersuchung ist in den sogenannten ”Borderlands“ der USA, dem Gebiet nahe der mexikanischen Grenze, angesiedelt. Ich werde die dortige spezifische gesellschaftliche Situation in einen geschichtlichen Kontext setzen, wobei der Schwerpunkt bei den Chicanos/-as, Menschen mexikanischer Herkunft, liegen wird. Um die Auswirkungen der gesellschaftlichen Realitäten auf die Sprache aufzuzeigen, werde ich ein Kapitel der Chicano/-a-Literatur und deren Spezifik widmen, um mich schließlich den daraus resultierenden übersetzungsrelevanten Fragen zuzuwenden.
Die vorliegende Arbeit will den Anspruch an uns (zukünftige) Übersetzer/-innen formulieren, gesellschaftliche Realitäten wahrzunehmen und in den Kontext der Tätigkeit des Übersetzens zu stellen. Denn die Realität findet in der Sprache ihren Ausdruck und um diesem auch in der Übersetzung möglichst nahe zu kommen, ist eine gute Kenntnis der Umstände, in denen der Ausgangstext (AT) entstand, unerlässlich.
Gerade das Beispiel der Chicano/-a-Literatur zeigt auf, dass die Grundlage für eine gute Übersetzung das Hinterfragen eines statischen Kulturbegriffs sein muss. Stereotypen, die besagen, dass "der Engländer" gerne Tee trinkt oder "der Spanier" unpünktlich ist, können getrost über Bord geworfen werden!
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Historische Kontextualisierung
- 2.1 Mexiko im 19. Jahrhundert
- 2.1.1 Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg
- 2.2 Der "Tortilla Curtain": Die US-mexikanische Grenze heute
- 2.3 Der Begriff Chicano/-a und das "Chicano Movimiento"
- 2.4 Kleine Anmerkung zur Sprachstatistik
- 3 Die Chicano/-a-Literatur
- 3.1 Kontextualisierung: Sprachpolitik der USA
- 3.2 Chicano/-a- Literatur als Teil der “Post-National Narratives”
- 3.3 Die Sprache als Grundlage der Chicano/-a-Literatur
- 4 Zur Übersetzungsproblematik von Chicano/-a-Literatur
- 4.1 Beibehalten der Bilingualität durch das Belassen der spanischen Textteile des Originals
- 4.2 Übertragung in gebrochenes Deutsch
- 5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die gesellschaftliche Situation von Chicanos/as in den USA, den Einfluss dieser Realität auf ihre Sprache und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Übersetzung ihrer Literatur. Die Arbeit betont die enge Verknüpfung von Sprache und Kultur und hinterfragt traditionelle Kulturbegriffe im Kontext der Globalisierung und Migration.
- Die historische Kontextualisierung der Chicano/a-Gemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und die US-mexikanische Grenze.
- Die Analyse der Chicano/a-Literatur als Ausdruck kultureller Identität und sprachlicher Besonderheiten.
- Die Untersuchung der Übersetzungsprobleme, die sich aus der bilingualen Natur der Chicano/a-Literatur ergeben.
- Die Rolle der Übersetzung im Kontext kultureller Identität und des Hinterfragens traditioneller Kulturbegriffe.
- Die Bedeutung der Berücksichtigung gesellschaftlicher Realitäten für eine adäquate Übersetzung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit: Die Einleitung erläutert die enge Verbindung von Sprache und Kultur und kritisiert vereinfachte Kulturbegriffe, die Kultur mit Nation gleichsetzen. Sie führt in das Thema der Arbeit ein: die Untersuchung der gesellschaftlichen Situation von Chicanos/as in den USA, ihrer Sprache und der daraus resultierenden Übersetzungsprobleme. Die Autorin betont die Rolle des Übersetzers als aktiven Protagonisten in einem Prozess der kulturellen Neuformierung und kündigt die Struktur der Arbeit an, die von der historischen Kontextualisierung über die Analyse der Chicano/a-Literatur bis hin zu den Übersetzungsproblemen reicht. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, gesellschaftliche Realitäten für eine angemessene Übersetzung zu berücksichtigen.
2 Historische Kontextualisierung: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick, beginnend mit der mexikanischen Unabhängigkeit und der föderalen Struktur des Landes. Es beschreibt die politische Instabilität des 19. Jahrhunderts in Mexiko, geprägt von Unabhängigkeitskriegen, Revolten und Kämpfen zwischen Liberalen und Konservativen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg (1846-1848), der durch die Gebietsansprüche der USA und die Aufstände amerikanischer Siedler in Texas ausgelöst wurde. Der Krieg führte zum Verlust mexikanischen Territoriums an die USA und legte den Grundstein für die heutige Situation an der US-mexikanischen Grenze und die Entstehung der Chicano/a-Gemeinschaft.
3 Die Chicano/-a-Literatur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Chicano/a-Literatur als Ausdruck der kulturellen Identität und der sprachlichen Besonderheiten dieser Gemeinschaft. Es analysiert die Chicano/a-Literatur im Kontext der Sprachpolitik der USA und als Teil der „Post-National Narratives“. Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle der Sprache als Grundlage der Chicano/a-Literatur, die oft auf Bilingualität (Spanisch und Englisch) basiert und die sprachlichen und kulturellen Erfahrungen der Gemeinschaft widerspiegelt. Die Kapitel analysiert, wie die Literatur die gesellschaftlichen Herausforderungen und die Identität der Chicanos/as verarbeitet und ausdrückt.
4 Zur Übersetzungsproblematik von Chicano/-a-Literatur: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Herausforderungen, die sich bei der Übersetzung von Chicano/a-Literatur stellen. Es diskutiert die Frage, ob die Bilingualität des Originals (Spanisch und Englisch) beibehalten oder in eine andere Form, z.B. gebrochenes Deutsch, übertragen werden soll. Die unterschiedlichen Strategien werden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile analysiert. Das Kapitel verdeutlicht die Komplexität des Übersetzungsprozesses, wenn kulturelle und sprachliche Eigenheiten berücksichtigt werden müssen.
Schlüsselwörter
Chicanos/as, US-mexikanische Grenze, Mexikanisch-Amerikanischer Krieg, Chicano-Literatur, Bilingualität, Übersetzungsproblematik, kulturelle Identität, Sprachpolitik, gesellschaftliche Realität, Post-National Narratives.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Übersetzungsprobleme in der Chicano/a-Literatur
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die gesellschaftliche Situation von Chicanos/as in den USA, den Einfluss dieser Realität auf ihre Sprache und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Übersetzung ihrer Literatur. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der engen Verknüpfung von Sprache und Kultur und der Hinterfragung traditioneller Kulturbegriffe im Kontext von Globalisierung und Migration.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Kontextualisierung der Chicano/a-Gemeinschaft, insbesondere den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg (1846-1848) und dessen Folgen für das heutige Verhältnis an der US-mexikanischen Grenze. Die Entstehung des Begriffs „Chicano/a“ und die Bedeutung der „Chicano Movimiento“ werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird die Chicano/a-Literatur analysiert?
Die Chicano/a-Literatur wird als Ausdruck kultureller Identität und sprachlicher Besonderheiten analysiert. Die Arbeit untersucht sie im Kontext der Sprachpolitik der USA und als Teil der „Post-National Narratives“. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der oft bilingualen (Spanisch und Englisch) Sprache als Grundlage dieser Literaturform.
Welche Übersetzungsprobleme werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen bei der Übersetzung von Chicano/a-Literatur. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Bilingualität des Originals beibehalten oder in eine andere Form, z.B. gebrochenes Deutsch, übertragen werden sollte. Die verschiedenen Strategien werden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile bewertet.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Arbeit?
Die Sprache spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit betont die enge Verbindung von Sprache und Kultur und analysiert, wie die sprachlichen Besonderheiten der Chicano/a-Literatur die kulturelle Identität widerspiegeln und die Übersetzungsproblematik beeinflussen. Die Sprachpolitik der USA wird als wichtiger Kontextfaktor betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chicanos/as, US-mexikanische Grenze, Mexikanisch-Amerikanischer Krieg, Chicano-Literatur, Bilingualität, Übersetzungsproblematik, kulturelle Identität, Sprachpolitik, gesellschaftliche Realität, Post-National Narratives.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Kontextualisierung, ein Kapitel zur Chicano/a-Literatur, ein Kapitel zu den Übersetzungsproblemen und abschließend Schlussfolgerungen und einen Ausblick. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher Realität, Sprache und kultureller Identität von Chicanos/as darzustellen und die Herausforderungen für die Übersetzung ihrer Literatur aufzuzeigen. Sie plädiert für eine Übersetzungspraxis, die die gesellschaftlichen und kulturellen Realitäten berücksichtigt.
- Quote paper
- Sylvia Degen (Author), 2004, Chicanas und Chicanos in den USA: Gesellschaftliche Realität, Sprache und Übersetzbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30313