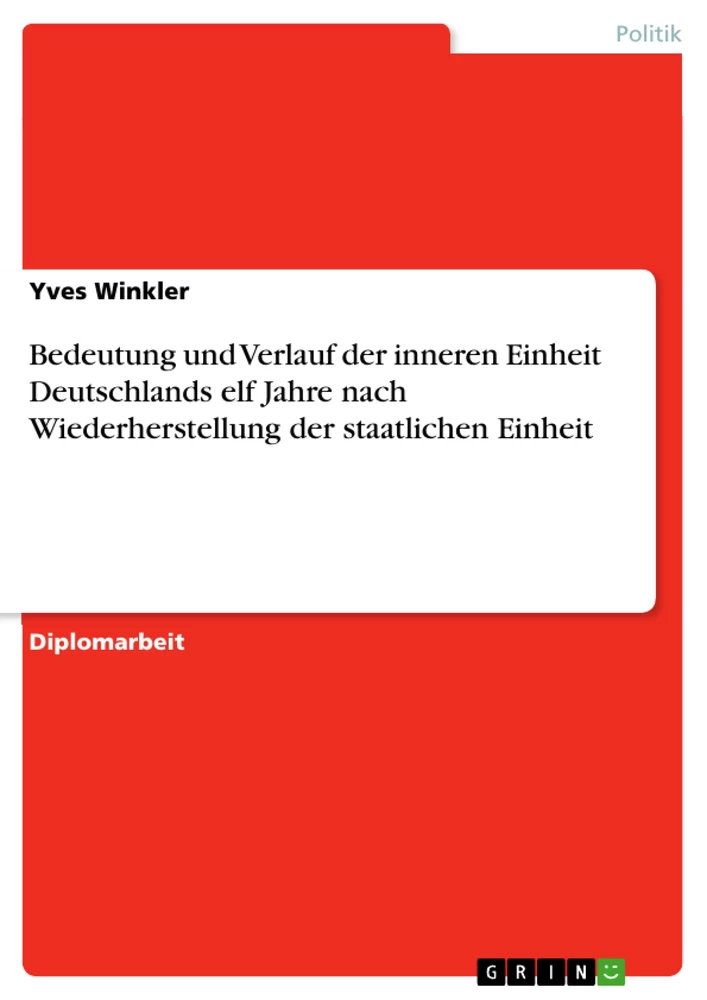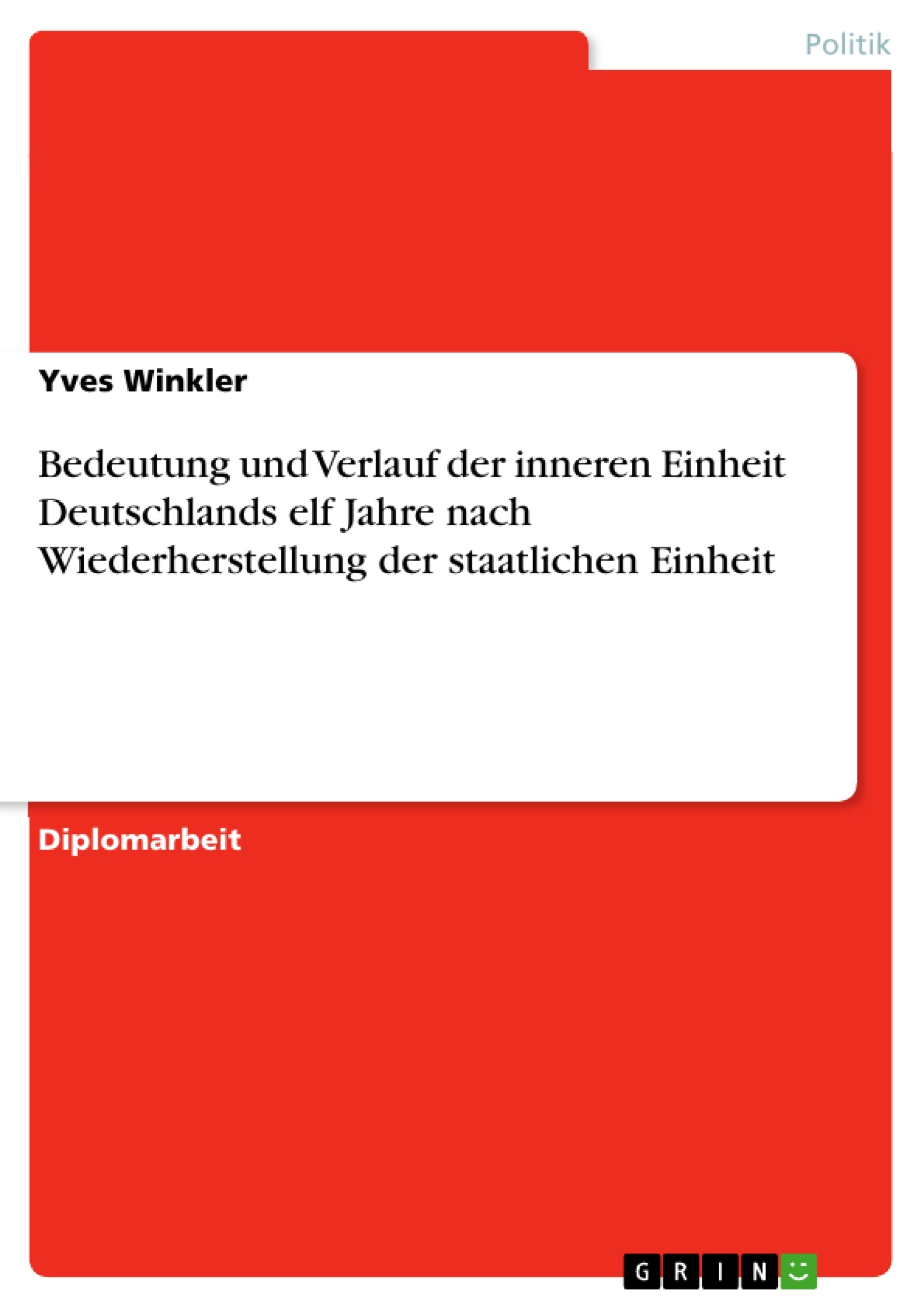Der Begriff innere Einheit erfreut sich seit Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands einer Hochkonjunktur in der öffentlichen Diskussion. Spätestens seitdem klar wurde, dass teilungsbedingte Probleme wohl doch nicht innerhalb weniger Jahre gelöst werden können, stellen insbesondere die politischen Akteure die Herstellung der inneren Einheit als vordringliches Ziel heraus.
Die vorliegende Arbeit versucht, der Bedeutung des Begriffs innere Einheit auf den Grund zu gehen. Dabei wird ein zweidimensionales Begriffsverständnis angewandt. Die Herstellung der inneren Einheit bedeutet demnach erstens die Überwindung eines kollektiven Benachteiligungsempfindens der Ostdeutschen gegenüber den Westdeutschen, welches als Bürger-zweiter-Klasse-Empfinden operationalisiert werden kann. Zweitens ist mit innerer Einheit die Überwindung der Präferenz für unterschiedliche Demokratiemodelle in beiden Teilen Deutschlands gemeint.
Umfrageergebnisse lassen die Annahme zu, dass Demokratie als Prinzip zwar in beiden Teilen Deutschlands eine gleichermaßen hohe Zustimmung erfährt und über Mindestanforderungen an Demokratie (z.B. Meinungsfreiheit, Demonstrationsrecht usw.) ebenfalls Einigkeit besteht, die Ostdeutschen aber anders als ihre westdeutschen Landsleute weitere, über dieses Maß hinausgehende Anforderungen an Demokratie stellen die in der Bundesrepublik nicht verwirklicht sind (etwa Recht auf Arbeit, Wohnung usw.), und somit ein anderes Demokratiemodell befürworten, als das in der Bundesrepublik implementierte.
Die Notwendigkeit einer gemeinsamen politischen Kultur wird vor allem in den zu bewältigenden Zukunftsaufgaben gesehen, vor denen Deutschland steht. Würde sich etwa herausstellen, dass ein Großteil der Bevölkerung mit dem Ziel der Herstellung möglichst großer materieller Gleichheit eher ein stärkeres Eingreifen des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft wünscht, so wäre dies gerade in einer Zeit problematisch, in der unter dem Gesichtspunkt eines sich verstärkenden internationalen Wettbewerbs der Rückzug staatlicher Maßnahmen aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens diskutiert wird.
Im vorliegenden Buch überprüft der Autor anhand von Umfrageergebnissen beide Dimensionen der inneren Einheit und kommt zum Schluss, dass in Ostdeutschland eine sich vom Westen abgrenzende Identitätsbildung stattgefunden hat und außerdem ein anderes Demokratieverständnis besteht, welches zumindest Grundelemente eines demokratischen Sozialismus präferiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemaufriß
- 1.1. Datenlage
- 1.2. Aufbau der Arbeit
- 1.3. Literaturüberblick
- I. Theoretischer Bezugsrahmen und Begriffsbestimmungen
- 2. Politische Transition in den Neuen Bundesländern
- 2.1. Phasen des politischen Wandels: Ein Transitionsmodell
- 2.2. Politische Struktur und politische Kultur im Transitionsprozeß
- 2.3. Politische Kultur in den neuen Bundesländern: Zur Ausgangslage 1990
- 3. Legitimität, Stabilität und politische Unterstützung
- 3.1. Zum Begriff der Legitimität
- 3.2. Zum Begriff der Stabilität
- 3.3. Zum Verhältnis von Legitimität und Stabilität in demokratisch verfaßten Systemen
- 3.4. Politische Unterstützung
- 3.4.1. Spezifische Unterstützung
- 3.4.2. Diffuse Unterstützung
- 3.5. Zusammenfassung und Hypothesen zur politischen Unterstützung in Ostdeutschland
- 4. Der Begriff der Inneren Einheit und seine Dimensionen
- 4.1. Innere Einheit als Modell
- 4.2. Sozialisation und Situation: zwei grundlegende Erklärungsansätze mangelnder innerer Einheit
- 4.3. Verstärkte Selbstidentifikation und kollektives Benachteiligungsgefühl der Ostdeutschen
- 4.3.1. Persönliche Erfahrungen mit dem neuen System: Die Erfahrungshypothese
- 4.3.2. Praktische, politische und charakterliche Diskriminierung der Ostdeutschen: Die Kompensationshypothese
- 4.3.3 Sozioökonomische Aspekte: keine materielle Einheit
- 4.4. Einstellungen zur Demokratie im vereinten Deutschland
- 4.4.1. Objektebenen von Demokratie
- 4.4.2. Normative Modelle der Demokratie
- 4.4.3. Einordnung der bundesdeutschen Demokratie
- 5. Hypothesen zu Stand und Verlauf der Inneren Einheit
- II. Stand und Verlauf der Inneren Einheit
- 6. Entwicklung des Bürger-Zweiter-Klasse-Empfindens seit 1990
- 6.1. Das Phänomen Bürger-zweiter-Klasse, Wirtschaftserwartungen und tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung
- 6.2. Das Phänomen Bürger-zweiter-Klasse und politische Unzufriedenheit
- 6.3. Das Phänomen Bürger-zweiter-Klasse und Externalisierung von Problemen im Einigungsprozeß
- 7. Ursachen des Bürger-Zweiter-Klasse-Empfindens
- 7.1. Erfahrungshypothese
- 7.2. Kompensationshypothese
- 7.3. Sozioökonomische Aspekte
- 8. Einstellungen zur Demokratie im vereinten Deutschland
- 8.1. Demokratie als Prinzip
- 8.2. Normative Prinzipien der Demokratie
- 8.3. Die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland
- 8.4. Die Performanz der Demokratie im vereinten Deutschland
- III. Zusammenfassung und Ausblick: Ein Staat - Zwei Politische Kulturen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stand und den Verlauf der „inneren Einheit“ Deutschlands elf Jahre nach der Wiedervereinigung. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die die Integration der neuen Bundesländer in die bundesdeutsche Gesellschaft und das politische System beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der politischen Kultur im Osten und den Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf das Empfinden der Ostdeutschen.
- Politische Transition in den neuen Bundesländern
- Legitimität und Stabilität des politischen Systems im vereinten Deutschland
- Das Phänomen des „Bürger-Zweiter-Klasse“-Empfindens
- Einstellungen zur Demokratie im Osten und Westen Deutschlands
- Sozioökonomische Disparitäten und ihre Auswirkungen auf die innere Einheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Problemaufriß: Die Einleitung skizziert die Bedeutung des Begriffs „innere Einheit“ in der öffentlichen Diskussion nach der Wiedervereinigung und die Herausforderungen bei der Lösung teilungsbedingter Probleme. Sie hebt den deutschen Vereinigungsprozess als Sonderfall im Kontext postkommunistischer Transformationen hervor, betont das schnelle Tempo des Systemwechsels und den Rückgriff auf das Modell der Bundesrepublik. Die Einleitung weist auf die Komplexität des Themas hin und legt den Fokus der Arbeit auf die Analyse der Faktoren, welche die innere Einheit beeinflussen.
2. Politische Transition in den Neuen Bundesländern: Dieses Kapitel beschreibt die politischen Veränderungen in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Es analysiert die Phasen des politischen Wandels anhand eines Transitionsmodells, untersucht die politische Struktur und Kultur im Transformationsprozess und beleuchtet die Ausgangslage im Jahr 1990. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Herausforderungen der Integration und des Einflusses der Vergangenheit auf die Gegenwart.
3. Legitimität, Stabilität und politische Unterstützung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konzepten der Legitimität, Stabilität und politischen Unterstützung im Kontext des vereinten Deutschlands. Es definiert die Begriffe und analysiert ihr Verhältnis in demokratischen Systemen. Es untersucht die spezifische und diffuse Unterstützung des politischen Systems und entwickelt Hypothesen zur politischen Unterstützung in Ostdeutschland. Die Analyse bietet einen wichtigen Rahmen für die Bewertung des Erfolgs der Integration.
4. Der Begriff der Inneren Einheit und seine Dimensionen: Das Kapitel analysiert den Begriff der inneren Einheit und seine verschiedenen Dimensionen. Es präsentiert ein Modell der inneren Einheit und diskutiert grundlegende Erklärungsansätze für mangelnde innere Einheit. Es untersucht das Gefühl der Benachteiligung bei Ostdeutschen, berücksichtigt persönliche Erfahrungen, Diskriminierung und sozioökonomische Aspekte. Der Abschnitt über Einstellungen zur Demokratie im vereinten Deutschland liefert wichtige Erkenntnisse über die Akzeptanz des politischen Systems.
6. Entwicklung des Bürger-Zweiter-Klasse-Empfindens seit 1990: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Gefühls, ein Bürger zweiter Klasse zu sein, seit der Wiedervereinigung. Es analysiert die Zusammenhänge zwischen diesem Empfinden, wirtschaftlichen Erwartungen und der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung, politischer Unzufriedenheit und der Externalisierung von Problemen im Einigungsprozess. Es liefert empirische Belege für die anhaltende Kluft zwischen Ost und West.
7. Ursachen des Bürger-Zweiter-Klasse-Empfindens: Kapitel sieben konzentriert sich auf die Ursachen des „Bürger-Zweiter-Klasse“-Empfindens. Es untersucht die Erfahrungshypothese (persönliche Erfahrungen mit dem neuen System), die Kompensationshypothese (Diskriminierung) und sozioökonomische Aspekte. Es bietet eine multikausale Erklärung für das anhaltende Problem der inneren Einheit.
8. Einstellungen zur Demokratie im vereinten Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Einstellungen der Bevölkerung im vereinten Deutschland zur Demokratie. Es untersucht Demokratie als Prinzip, normative Prinzipien der Demokratie und die Demokratie der Bundesrepublik. Es analysiert die Performanz der Demokratie im vereinten Deutschland und liefert wichtige Erkenntnisse über die Akzeptanz und Zufriedenheit mit dem politischen System.
Schlüsselwörter
Innere Einheit, Deutsche Einheit, Politische Transition, Neue Bundesländer, Ostdeutschland, Westdeutschland, Legitimität, Stabilität, Politische Unterstützung, Bürger-Zweiter-Klasse-Empfinden, Sozioökonomische Disparitäten, Demokratie, Politische Kultur, Integration, Transformation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Stand und Verlauf der Inneren Einheit Deutschlands
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Stand und Verlauf der „inneren Einheit“ Deutschlands elf Jahre nach der Wiedervereinigung. Sie analysiert die Faktoren, die die Integration der neuen Bundesländer in die bundesdeutsche Gesellschaft und das politische System beeinflussen, beleuchtet die Entwicklung der politischen Kultur im Osten und den Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf das Empfinden der Ostdeutschen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Politische Transition in den neuen Bundesländern, Legitimität und Stabilität des politischen Systems im vereinten Deutschland, das Phänomen des „Bürger-Zweiter-Klasse“-Empfindens, Einstellungen zur Demokratie im Osten und Westen Deutschlands sowie sozioökonomische Disparitäten und deren Auswirkungen auf die innere Einheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Einleitung und Problemaufriss, einen theoretischen Bezugsrahmen mit Begriffsbestimmungen und Analysen zur politischen Transition, Legitimität, Stabilität und politischer Unterstützung sowie dem Begriff der Inneren Einheit und seinen Dimensionen. Der zweite Teil untersucht den Stand und Verlauf der Inneren Einheit anhand der Entwicklung des „Bürger-Zweiter-Klasse“-Empfindens und seinen Ursachen. Der dritte Teil fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und analytische Methode. Sie basiert auf der Auswertung von Literatur und wissenschaftlichen Erkenntnissen, um die komplexen Zusammenhänge zwischen politischen, sozialen und ökonomischen Faktoren und der Inneren Einheit zu untersuchen.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und analysiert?
Zentrale Begriffe sind: Innere Einheit, Politische Transition, Legitimität, Stabilität, Politische Unterstützung, Bürger-Zweiter-Klasse-Empfinden, Sozioökonomische Disparitäten, Demokratie und Politische Kultur.
Welche Hypothesen werden aufgestellt und untersucht?
Die Arbeit entwickelt Hypothesen zur politischen Unterstützung in Ostdeutschland und zu den Ursachen des „Bürger-Zweiter-Klasse“-Empfindens. Diese Hypothesen werden im Verlauf der Arbeit anhand empirischer Daten und theoretischer Überlegungen überprüft.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zur Entwicklung des „Bürger-Zweiter-Klasse“-Empfindens seit 1990, zu den Ursachen dieses Empfindens (Erfahrungshypothese, Kompensationshypothese, sozioökonomische Aspekte) und zu den Einstellungen zur Demokratie im vereinten Deutschland. Sie analysiert den Einfluss sozioökonomischer Disparitäten auf die innere Einheit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im dritten Teil präsentiert und geben einen Ausblick auf die Herausforderungen der weiteren Integration und des Erreichens einer umfassenden Inneren Einheit in Deutschland.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten, Politiker und alle, die sich für die deutsche Geschichte, die politische Entwicklung nach der Wiedervereinigung und die Herausforderungen der Integration interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Inhaltsverzeichnis und die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt der Arbeit. Zusätzliche Informationen können in der zitierten Literatur gefunden werden.
- Citation du texte
- Yves Winkler (Auteur), 2002, Bedeutung und Verlauf der inneren Einheit Deutschlands elf Jahre nach Wiederherstellung der staatlichen Einheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3021