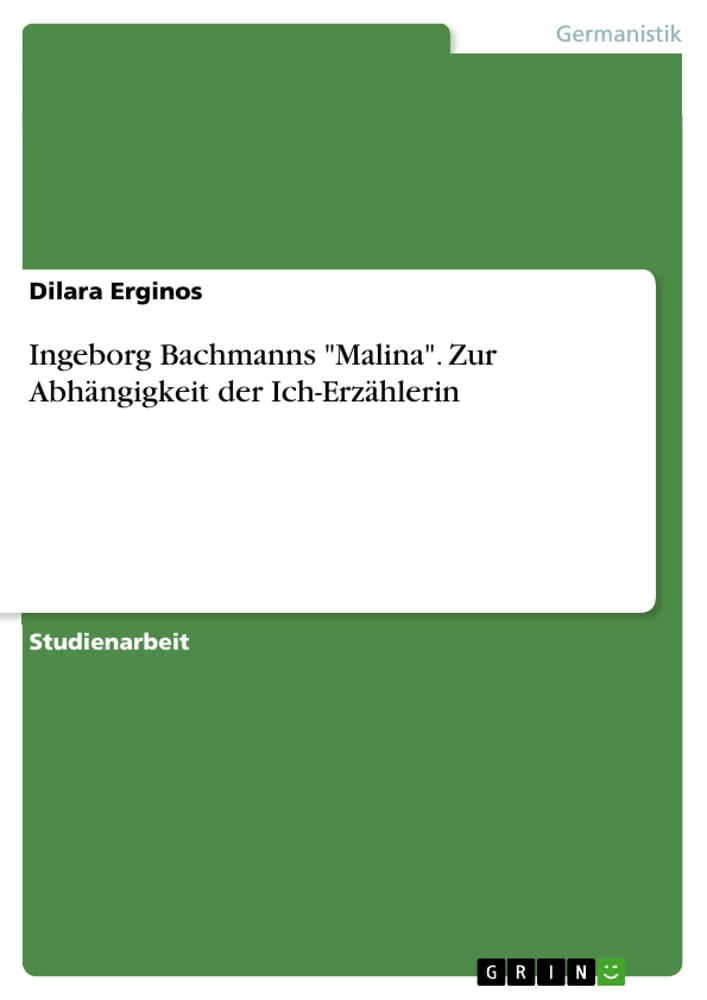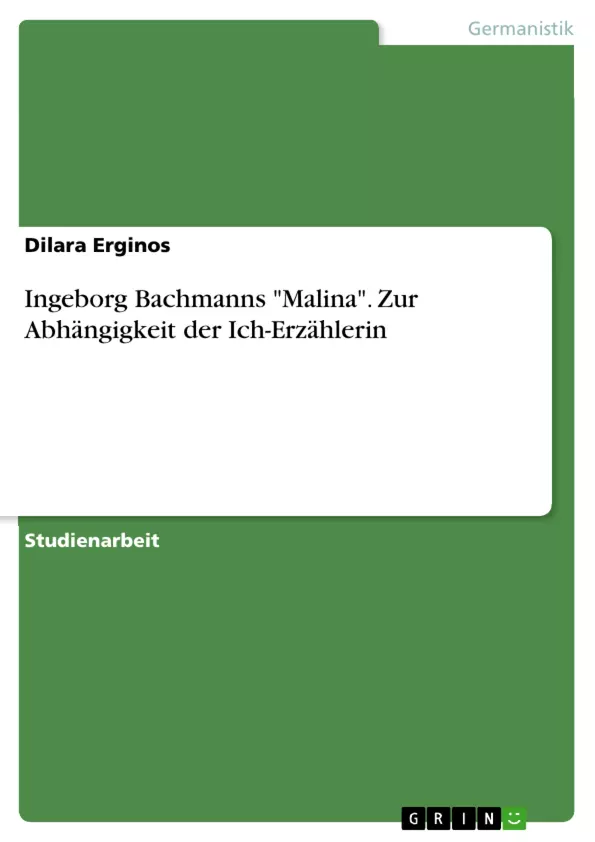Als Ingeborg Bachmann 1971 den Roman "Malina" als ersten Teil der mehrteiligen Romanreihe "Todesarten-Projekt" veröffentlichte, erntete dieser zunächst zahlreiche Kritik.
Günter Blöcker beispielsweise kritisierte eine „klischeehafte Grundkonstellation“ und interpretierte den Roman sogar autobiographisch. Seiner Meinung nach sei die Protagonistin „ziemlich unverschlüsselt die Autorin in Person“. Bachmann selbst bezeichnete ihren Roman in einem Gespräch mit Veit Möller 1971 zwar als eine „geistige, imaginäre Biographie“, was jedoch nicht bedeutet, dass der Roman tatsächlich als Autobiographie zu verstehen ist.
Des Weiteren wurde der Roman nach seiner Veröffentlichung oft auf eine banale Dreiecks-/Liebesgeschichte reduziert, oder aber die Ich-Erzählerin als hysterische Frau gesehen, die an einem Rollenbild der Frau des 19. Jahrhunderts festhält.
Das in "Malina" vermittelte Frauenbild und das Verhalten der Ich-Erzählerin wurde in der feministischen Forschungsliteratur der 80er-Jahre eingehend untersucht und sehr unterschiedlich bewertet. Bis heute wird der Roman "Malina" im Hinblick auf seine Fortschrittlichkeit kontrovers diskutiert.
Die vorliegende Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, auf welche Weise die Ich- Erzählerin, welche die Protagonistin darstellt, sich in Malina abhängig macht.
Hierfür sollen zuerst die Figurenkonstellation und im Anschluss hieran die Abhängigkeit der Protagonistin von ihrem wohnlichen Umfeld einerseits und ihre emotionale, beziehungsweise körperliche Abhängigkeit von ihrem festen Freund Ivan andererseits näher betrachtet werden.
Da sich die Beziehung zu Ivan als ambivalent erweist, werden sowohl ihre heilende Wirkung als auch ihre verhängnisvolle Seite und die Trennung von Ivan separat behandelt.
Die Figur Malina stellt den nächsten Punkt der Arbeit dar, bevor zuletzt auf das Verschwinden der Ich-Erzählerin in der Wand am Ende des Romans eingegangen und ein abschließendes Fazit zur Abhängigkeit der Ich-Erzählerin in "Malina" gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Figurenkonstellation des Romans
- Die Ungargasse als Rückzugsort
- Die ambivalente Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan
- Ivan als Heilmittel
- Abhängig von Ivan
- Die Trennung von Ivan und ihre Auswirkungen auf die Ich-Erzählerin
- Malina als männliche, rationale Seite der Ich-Erzählerin
- Es war (Selbst-)Mord?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Abhängigkeit der Ich-Erzählerin in Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“. Analysiert werden die verschiedenen Formen der Abhängigkeit, ihre Ursachen und ihre Auswirkungen auf die Protagonistin. Der Fokus liegt auf der Beziehung der Ich-Erzählerin zu ihrem Wohnumfeld, ihrem Partner Ivan und ihrem Mitbewohner Malina.
- Die räumliche und emotionale Abhängigkeit der Ich-Erzählerin
- Die ambivalente Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan
- Malina als Alter Ego und dessen Einfluss auf die Ich-Erzählerin
- Die Rolle der Abhängigkeit im Kontext der weiblichen Selbstfindung
- Die Interpretation des Romanausgangs und dessen Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die kontroverse Rezeptionsgeschichte von Ingeborg Bachmanns Roman "Malina" und benennt die Forschungslücke, die diese Arbeit schließen will: die Analyse der Abhängigkeitsstrukturen der Ich-Erzählerin. Die Arbeit fokussiert sich auf die Beziehung der Protagonistin zu ihrem Wohnumfeld (Ungargasse), ihrem Freund Ivan und der Figur Malina, um die verschiedenen Facetten ihrer Abhängigkeit zu beleuchten.
Die Figurenkonstellation des Romans: Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Figuren des Romans, insbesondere die namenlose Ich-Erzählerin, Ivan und Malina. Es wird die Problematik der Handlungsbeschreibung in einem Psychogramm wie "Malina" erörtert und die Bedeutung der Figuren im Kontext der Charakterisierung der Ich-Erzählerin hervorgehoben. Die anfängliche Präsentation der Figuren als eigenständige Individuen bereitet den Weg für die spätere Deutung Malinas als Teil der Ich-Erzählerin selbst.
Die Ungargasse als Rückzugsort: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Ungargasse als zentralen Ort und Sinnbild für die Ich-Erzählerin. Ihre intensive Bindung an die Gasse wird als Ausdruck einer ungesunden Abhängigkeit interpretiert, die ihre Bewegungsfreiheit und ihr Verhältnis zur Außenwelt beeinträchtigt. Die Ungargasse wird als untrennbar mit Ivans Präsenz verknüpft dargestellt, was ihre Abhängigkeit von der Beziehung unterstreicht.
Die ambivalente Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan: Dieses Kapitel untersucht die komplexe Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan. Es werden sowohl die heilende als auch die verhängnisvolle Seite der Beziehung differenziert dargestellt. Die Analyse beleuchtet die Selbstaufgabe der Ich-Erzählerin und ihre Abhängigkeit von Ivan, die sich in verschiedenen Aspekten ihres Verhaltens und ihrer Sprache zeigt, einschließlich ihrer vergleichsweise symbiotischen Telefonate. Ivans herablassendes Verhalten und die Diskrepanz in den Erwartungen an die Beziehung werden ebenfalls erörtert.
Malina als männliche, rationale Seite der Ich-Erzählerin: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Figur Malina, die als männliches Alter Ego der Ich-Erzählerin interpretiert wird. Malina verkörpert Rationalität und Organisation im Gegensatz zur Emotionalität der Ich-Erzählerin. Die Analyse untersucht, inwiefern die Ich-Erzählerin von Malinas Eigenschaften abhängig ist und wie Malina ihr bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit und der Trennung von Ivan hilft.
Es war (Selbst-)Mord?: Dieses Kapitel diskutiert den Romanausgang und die vielschichtigen Deutungsmöglichkeiten des Schlusssatzes "Es war Mord". Es werden verschiedene Interpretationen des Verschwindens der Ich-Erzählerin in der Wand betrachtet, von Selbstmord bis hin zur Metapher für die gesellschaftlichen Zwänge, denen Frauen ausgesetzt sind. Die Analyse berücksichtigt die ambivalenten Aspekte des Schlusses und die Frage nach der Verantwortung für das Geschehen.
Schlüsselwörter
Ingeborg Bachmann, Malina, Abhängigkeit, Frauenbild, Selbstfindung, Alter Ego, Ivan, Malina, Psychogramm, Identität, Patriarchat, Selbstmord, Existentialismus.
Häufig gestellte Fragen zu Ingeborg Bachmanns "Malina"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Abhängigkeitsstrukturen der Ich-Erzählerin in Ingeborg Bachmanns Roman "Malina". Der Fokus liegt auf den verschiedenen Formen der Abhängigkeit, ihren Ursachen und Auswirkungen auf die Protagonistin, insbesondere in Bezug auf ihr Wohnumfeld (Ungargasse), ihren Partner Ivan und die Figur Malina.
Welche Themen werden im Roman untersucht?
Die Arbeit untersucht die räumliche und emotionale Abhängigkeit der Ich-Erzählerin, die ambivalente Beziehung zu Ivan, Malina als Alter Ego und dessen Einfluss, die Rolle der Abhängigkeit im Kontext der weiblichen Selbstfindung, und interpretiert den Romanausgang und dessen Bedeutung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung (Einführung in die Rezeptionsgeschichte und Forschungslücke), Die Figurenkonstellation des Romans (Beschreibung der Hauptfiguren), Die Ungargasse als Rückzugsort (Analyse der Bedeutung des Wohnortes), Die ambivalente Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan (Untersuchung der Beziehung zwischen Ich-Erzählerin und Ivan), Malina als männliche, rationale Seite der Ich-Erzählerin (Interpretation von Malina als Alter Ego), Es war (Selbst-)Mord? (Diskussion des Romanausgangs), Fazit (Zusammenfassung der Ergebnisse).
Wie wird die Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan dargestellt?
Die Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Ivan wird als ambivalent beschrieben. Es werden sowohl positive Aspekte (Ivan als Heilmittel) als auch negative Aspekte (Abhängigkeit, Selbstaufgabe, herablassendes Verhalten) der Beziehung herausgearbeitet. Die Analyse beleuchtet die symbiotische Natur ihrer Kommunikation und die Diskrepanz in den Erwartungen an die Beziehung.
Welche Rolle spielt die Figur Malina im Roman?
Malina wird als männliches Alter Ego der Ich-Erzählerin interpretiert, das Rationalität und Organisation verkörpert im Gegensatz zur Emotionalität der Ich-Erzählerin. Malina hilft der Ich-Erzählerin bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit und der Trennung von Ivan.
Wie wird der Romanausgang interpretiert?
Der Romanausgang und der Satz "Es war Mord" werden vielschichtig interpretiert. Es werden verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen, vom Selbstmord bis hin zur Metapher für gesellschaftliche Zwänge, denen Frauen ausgesetzt sind. Die Ambivalenz des Schlusses und die Frage nach der Verantwortung werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Roman und die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ingeborg Bachmann, Malina, Abhängigkeit, Frauenbild, Selbstfindung, Alter Ego, Ivan, Malina, Psychogramm, Identität, Patriarchat, Selbstmord, Existentialismus.
Welche Forschungslücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke einer umfassenden Analyse der Abhängigkeitsstrukturen der Ich-Erzählerin in Ingeborg Bachmanns Roman "Malina".
- Citar trabajo
- Dilara Erginos (Autor), 2015, Ingeborg Bachmanns "Malina". Zur Abhängigkeit der Ich-Erzählerin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302126