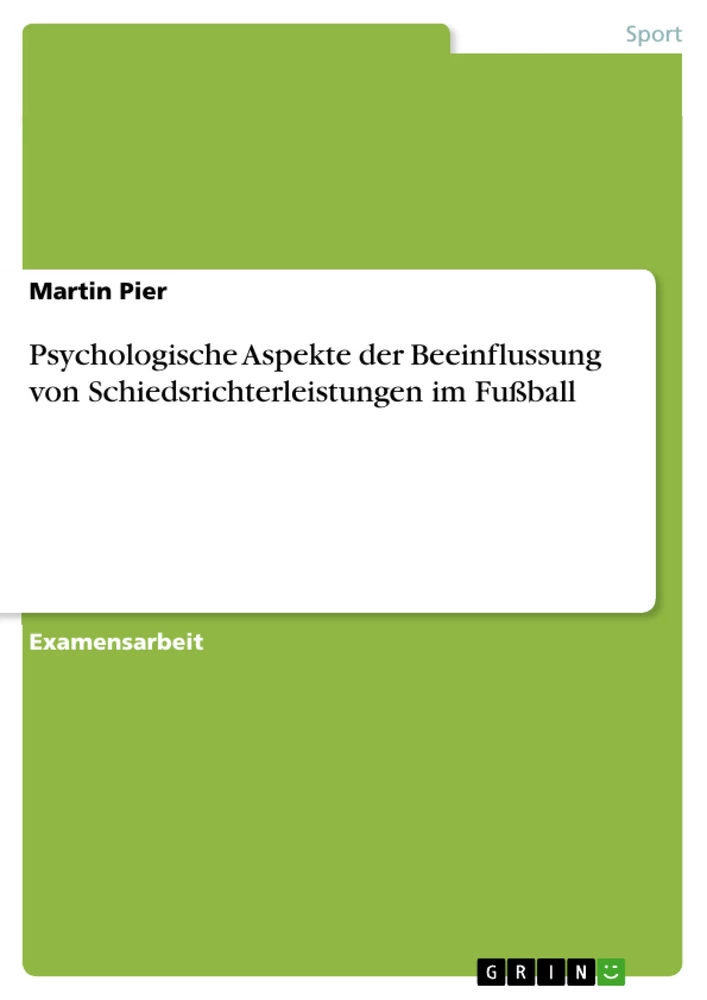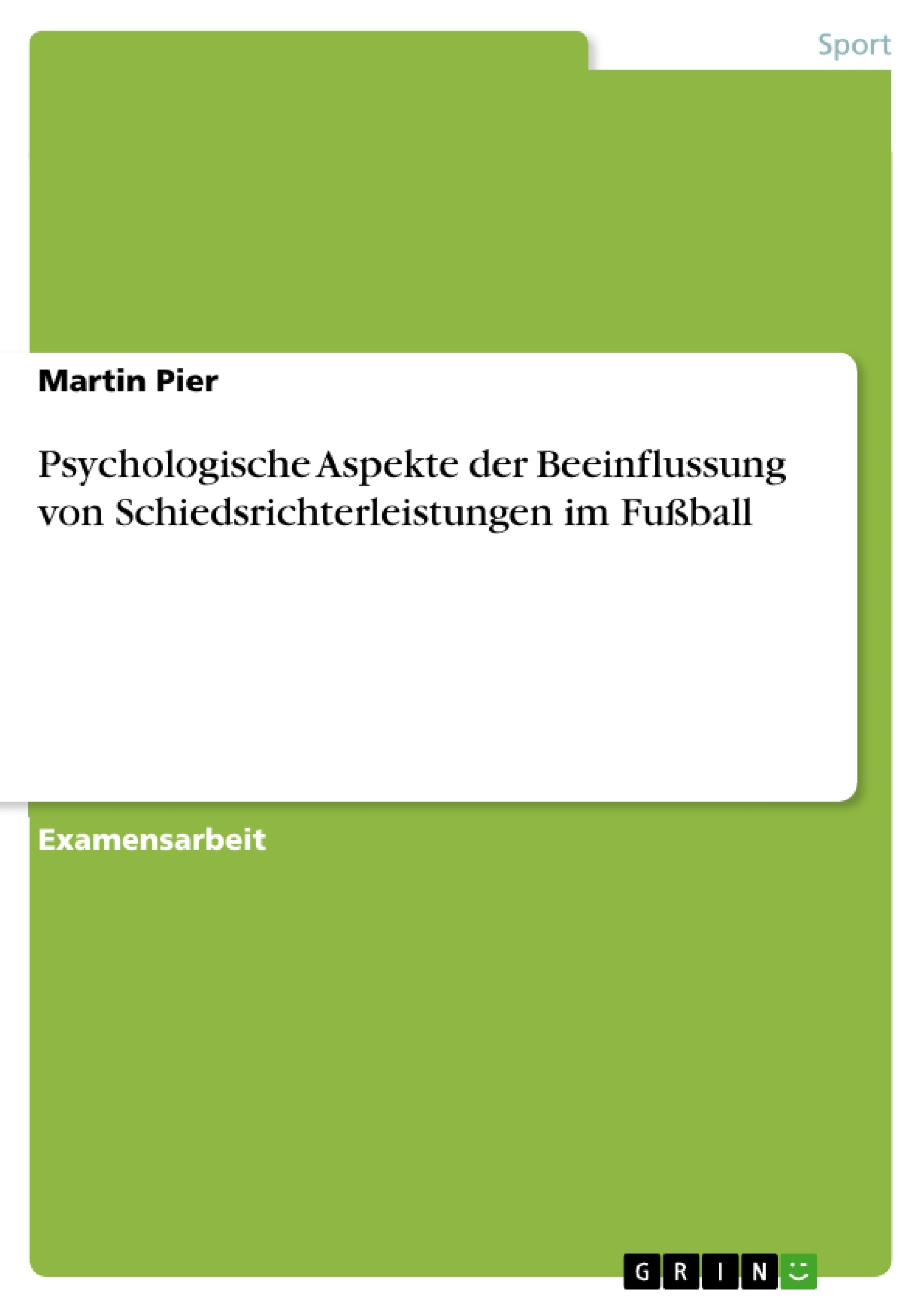In nahezu allen wettkampfmäßig betriebenen Sportarten agieren Schiedsrichter, um einen regelkonformen Ablauf der Sportveranstaltungen zu gewährleisten. Ihre Entscheidungen und Urteile beruhen dabei auf dem jeweils gültigen Regelwerk. Die Spielregeln und Regularien sind ihrerseits mehr oder weniger eindeutig formuliert, damit eine korrekte Anwendung prinzipiell möglich ist (vgl. Haase in Druck).
Die theoretische Zielsetzung lässt sich allerdings nicht immer problemlos realisieren. Nahezu regelmäßig stehen Schiedsrichter im öffentlichen Interesse, meistens in der Kritik. Ihr Image ist eindeutig geprägt und vor-belastet. Sie werden des öfteren für Niederlagen verantwortlich gemacht oder gar mit absichtlichen Fehlurteilen konfrontiert.
Unmutsäußerungen zu Schiedsrichterentscheidungen gehören in den lokalen und überregionalen Printmedien heute zum sportpolitischen Alltag. Die Sportpsychologie beobachtet einen derartig „external – variabel“ ausgerichteten „self – serving – bias“ (vgl. Weiner et al. 1971, in Möller 1994) in der Argumentation der „Verlierer“ schon seit geraumer Zeit. Dabei haben neuere Fußballuntersuchungen aufgezeigt, dass die weitaus größte Anzahl der dynamischen Spielvorgänge trotz schwierigster Rahmenbedingungen richtig erkannt und beurteilt wird(1) . Andererseits lassen sich nachweisbare Fehlentscheidungen keineswegs immer als Einzelfälle deklarieren. Insbesondere jene Sportarten, in denen Menschen als Schiedsrichter fungieren, offenbaren gelegentliche Unzulänglichkeiten in der Wahrnehmung und Beurteilung durch das „Messinstrument“ Mensch.
[...]
______
1 Fußballschiedsrichter treffen im Durchschnitt zwischen 157 bis 236 spielspezifische Entscheidungen in einer Partie (vgl. Teipel, Kemper & Heinemann 1999, S. 94f).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit
- 2.1 Anforderungen und Qualifikationen
- 2.1.1 Physische Anforderungen
- 2.1.2 Psychische Anforderungen
- 2.2 Stressoren der Schiedsrichtertätigkeit
- 2.3 Wahrnehmung und daraus resultierende Konfliktbildung
- 2.4 Differenzierte Schiedsrichtertypen
- 2.5 Regulationsfunktionen durch Schiedsrichter
- 3. Der Social Cognition – Ansatz als Rahmenmodell
- 3.1 Wahrnehmung
- 3.2 Kategorisierung
- 3.3 Gedächtnisorganisation
- 3.4 Urteilen und Entscheiden
- 3.5 Priming
- 3.6 Stereotypenbildung
- 4. Hypothesen
- 5. Methode
- 5.1 Überblick und Versuchsplan
- 5.2 Stichprobe
- 5.3 Variablen
- 5.4 Realisierung
- 6. Ergebnisse
- 7. Diskussion
- 7.1 Diskussion der Ergebnisse
- 7.2 Psychologische Aspekte der Schiedsrichterschulung
- 7.2.1 Psychologische Schiedsrichterschulung (nach Heisterkamp 1982)
- 7.2.2 Wahrnehmungs- und Entscheidungstraining für Fußballschiedsrichter (nach Plessner & Raab 2000)
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die psychologischen Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit im Sport. Ziel ist es, die Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern zu analysieren und daraus Handlungsempfehlungen für eine optimierte Schiedsrichterschulung abzuleiten. Die Arbeit beleuchtet dabei den Einfluss von Stress, Wahrnehmung, und kognitiven Prozessen auf die Urteilsbildung.
- Anforderungen und Qualifikationen von Schiedsrichtern
- Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung (Stress, Wahrnehmung, Vorinformationen)
- Anwendung des Social Cognition Ansatzes auf die Schiedsrichtertätigkeit
- Empirische Untersuchung zu Urteilsverzerrungen durch Priming
- Entwicklung eines verbesserten Ausbildungskonzeptes für Schiedsrichter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schiedsrichtertätigkeit ein und hebt die Problematik von Fehlentscheidungen und öffentlichem Druck hervor. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage, die sich mit dem Einfluss von Vorinformationen auf die Urteilsbildung von Schiedsrichtern befasst. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas im Kontext der Kommerzialisierung des Leistungssports und des damit verbundenen Drucks auf Schiedsrichter.
2. Allgemeine Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit aus sportpsychologischer Perspektive. Es werden Anforderungen und Qualifikationen an Schiedsrichter, die sie beeinflussenden Faktoren (Stressoren), die Problematik unterschiedlicher Wahrnehmungen und die daraus resultierende Konfliktbildung, verschiedene Schiedsrichtertypen und deren Regulationsfunktionen im Spielverlauf erörtert. Diese Analyse bildet die Grundlage für die spätere Diskussion der Ergebnisse und die Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen.
Schlüsselwörter
Schiedsrichter, Sportpsychologie, Wahrnehmung, Urteilsbildung, Entscheidungsfindung, Stress, Social Cognition Ansatz, Priming, Urteilsverzerrung, Schiedsrichterschulung, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Psychologische Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit im Sport
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die psychologischen Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit im Sport, insbesondere die Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für eine optimierte Schiedsrichterschulung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss von Stress, Wahrnehmung und kognitiven Prozessen auf die Urteilsbildung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Anforderungen und Qualifikationen von Schiedsrichtern, Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung (Stress, Wahrnehmung, Vorinformationen), die Anwendung des Social Cognition Ansatzes auf die Schiedsrichtertätigkeit, eine empirische Untersuchung zu Urteilsverzerrungen durch Priming und die Entwicklung eines verbesserten Ausbildungskonzeptes für Schiedsrichter. Allgemeine Aspekte der Schiedsrichtertätigkeit wie Stressoren, Wahrnehmungskonflikte und verschiedene Schiedsrichtertypen werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt den verwendeten Versuchsplan, die Stichprobe, die Variablen und die konkrete Realisierung der empirischen Untersuchung. Details zur Methodik sind im Kapitel 5 ("Methode") ausführlich dargestellt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel 6 präsentiert. Eine detaillierte Diskussion der Ergebnisse und deren Interpretation findet sich im Kapitel 7.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 7) beinhaltet Schlussfolgerungen für die Praxis, insbesondere für die psychologische Schiedsrichterschulung. Es werden bestehende Ausbildungskonzepte (z.B. nach Heisterkamp 1982 und Plessner & Raab 2000) diskutiert und Verbesserungsvorschläge unterbreitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schiedsrichter, Sportpsychologie, Wahrnehmung, Urteilsbildung, Entscheidungsfindung, Stress, Social Cognition Ansatz, Priming, Urteilsverzerrung, Schiedsrichterschulung, Empirische Untersuchung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den allgemeinen Aspekten der Schiedsrichtertätigkeit, dem Social Cognition Ansatz, den Hypothesen, der Methode, den Ergebnissen, der Diskussion (inklusive Aspekten der Schiedsrichterschulung), und einer Zusammenfassung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im Dokument.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit dem Einfluss von Vorinformationen auf die Urteilsbildung von Schiedsrichtern.
Welche Relevanz hat die Arbeit?
Die Arbeit ist relevant im Kontext der Kommerzialisierung des Leistungssports und des damit verbundenen Drucks auf Schiedsrichter. Sie trägt zum Verständnis der psychologischen Faktoren bei, die die Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern beeinflussen und bietet Ansatzpunkte für die Verbesserung der Schiedsrichterschulung.
- Quote paper
- Martin Pier (Author), 2000, Psychologische Aspekte der Beeinflussung von Schiedsrichterleistungen im Fußball, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3016