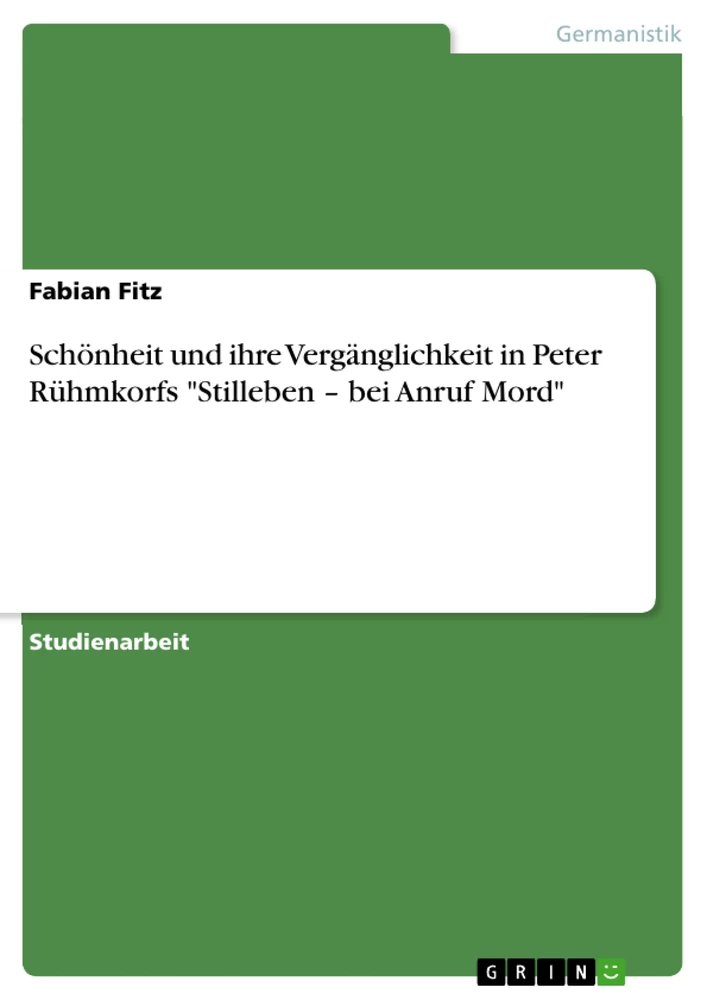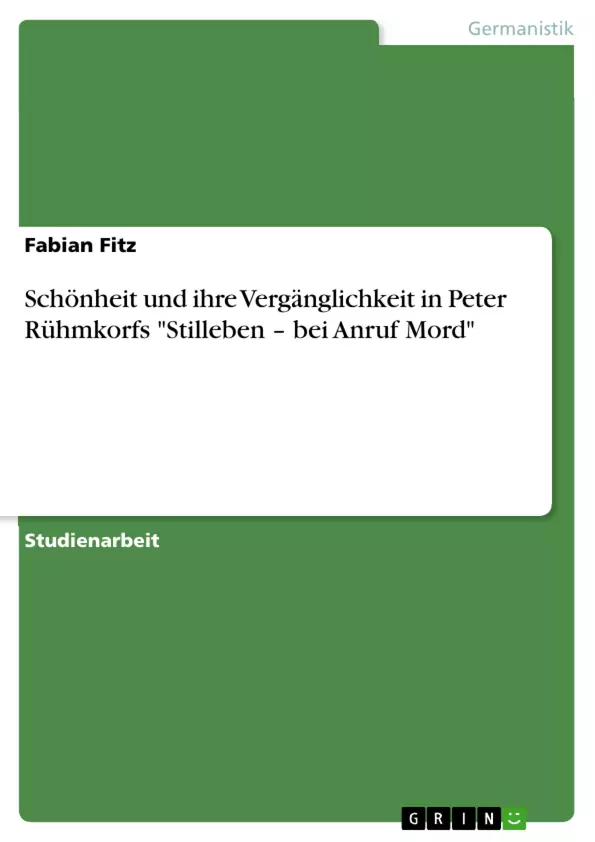Die Forschungsliteratur vermittelt auf den ersten Blick zahlreich den Eindruck, als sei Peter Rühmkorf ein Dichter, der seine Kunst hauptsächlich funktionalisiere und vordergründig Kunst mit politischen Inhalten und Botschaften mache. Er gilt als „engagierter Aufklärer“, der sich mit seiner Lyrik und seinen Essays in die Gesellschaft einmischen wolle und auch die Funktion und den Nutzen von Kunst darin sehe, Veränderungen hervorzurufen.
Dies legt den Schluss nahe, dass vor allem das gesellschaftskritische Moment in Peter Rühmkorfs Lyrik entscheidend sei. Dabei wird jedoch vergessen, dass Rühmkorf immer auch Künstler ist, der eben Kunst machen will, und zwar um ihrer Ästhetik willen.
Weder die ausschließliche Betrachtung der einen Seite, des Künstlers der Kunst nutzen will um Inhalte zu transportieren, noch die ausschließliche Betrachtung der Seite des Künstlers, der Kunst nur um der Kunst willen macht, l´art pour l´art, würde Peter Rühmkorf gerecht werden. „Seine Lyrik wird gewissermaßen gleichzeitig von zwei Autoren verfasst: dem 'rationalen' Aufklärer und dem 'irrationalen' Poeten. Sie produzieren gemeinsam erkenntnistheoretische Schriften, und sie machen Kunst, fasst es Sabine Brunner zusammen. Und auch Rühmkorf selbst ist diese Zweiheit bewusst, die zur Bedingung seines Schreibens wird.
„Warum denn bitte, bliebe der Unbefangenheit zu fragen, warum denn solle, müsse, dürfe, könne Kunst nicht? Warum sollte dem zeitgenössischen Poeten grundsätzlich vorenthalten bleiben, was Dichtkunst vieler Zeiten, vieler Länder zu gegebener Stunde für sich in Anspruch nahm: das Recht, sich kräftig einzumischen in die alltägliche Belange.“
Die engagierte Kunst, das Einmischen in gesellschaftlich gegenwärtige Diskurse und das Bilden von Diskursen selbst, sieht Rühmkorf als als ein 'Recht' der Kunst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Mohn-Symbolik
- Die Konservierung des Schönen
- Rauschhaftigkeit und Kunstproduktion
- Die Thematik der Zeit
- Zeit und Geschwindigkeit
- Augenblick und Plötzlichkeit
- Dichtkunst und Bildende Kunst
- Stilleben und Vanitas-Stilleben
- Bezug zur Bildenden Kunst
- Kunst als Überlebenskunst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Schönheit und Vergänglichkeit in Peter Rühmkorfs Gedicht „Stilleben - bei Anruf Mord“. Sie hinterfragt die gängige Interpretation Rühmkorfs als rein gesellschaftskritischen Dichters und beleuchtet den ästhetischen Aspekt seines Schaffens. Die Analyse fokussiert auf die Interaktion von Kunst und Realität, die Rolle der Zeit und die Bedeutung der Mohn-Symbolik.
- Die Verbindung von Ästhetik und gesellschaftlicher Kritik in Rühmkorfs Werk
- Die Mohnblüte als Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit
- Die Auseinandersetzung mit dem Thema Zeit und deren Einfluss auf Kunst
- Der Bezug zur Bildenden Kunst, insbesondere zum Vanitas-Stilleben
- Kunst als Reflexion des künstlerischen Prozesses und der eigenen Vergänglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die gängige Wahrnehmung Rühmkorfs als hauptsächlich gesellschaftskritischen Dichters dar und argumentiert für eine umfassendere Betrachtung, die auch den ästhetischen Aspekt seines Schaffens berücksichtigt. Sie betont die Zweiheit von „rationalem Aufklärer“ und „irrationalem Poeten“ in Rühmkorfs Werk und kündigt die Analyse der Mohn-Symbolik, der Zeitthematik und des Bezugs zur Bildenden Kunst im Gedicht „Stilleben - bei Anruf Mord“ an. Die Arbeit möchte die Selbstreflexivität des Gedichts herausarbeiten und die Verknüpfung von Schönheit und Vergänglichkeit untersuchen, ohne dabei den Realitätsbezug zu vernachlässigen.
Die Mohn-Symbolik: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Symbolik der Mohnblüte im Gedicht. Die Mohnblüte, in ihrer ephemeren Schönheit, repräsentiert die Vergänglichkeit sowohl der Natur als auch der Kunst. Die Analyse betrachtet, wie Rühmkorf durch die Beschreibung des schnell vergehenden Schönen die Grenzen der künstlerischen Darstellung der Realität und die eigene Vergänglichkeit als Künstler reflektiert. Die Konservierung des Schönen durch die Kunst wird als Versuch interpretiert, dem Verfall der Zeit zu widerstehen, ein Kampf der letztlich vergeblich ist, jedoch die Essenz der Kunst beleuchtet.
Die Thematik der Zeit: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Zeit und ihrer verschiedenen Aspekte (Geschwindigkeit, Augenblick, Plötzlichkeit) in Rühmkorfs Gedicht. Die flüchtige Schönheit des Mohns wird als Metapher für die vergängliche Natur des Augenblicks verwendet. Die Analyse beleuchtet, wie Rühmkorf den Versuch unternimmt, diesen flüchtigen Moment künstlerisch festzuhalten, die zeitliche Dimension der Kunstproduktion und -rezeption thematisiert und die Grenzen dieser Festlegung untersucht. Die Untersuchung der Zeitthematik verdeutlicht die Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit, sowohl des Künstlers als auch des Werkes.
Dichtkunst und Bildende Kunst: Dieses Kapitel untersucht den expliziten Bezug des Gedichts zur Bildenden Kunst, insbesondere zum Stilleben und zum barocken Vanitas-Motiv. Der Titel und die Bildlichkeit des Gedichts lassen einen direkten Vergleich zwischen der Malerei und der Poesie zu. Rühmkorf überträgt den Prozess des malerischen Festhaltens der Schönheit auf die dichterische Arbeit. Die Analyse betrachtet das Gedicht als eine Art poetisches Vanitas-Stilleben, wobei die Reflexion über die Möglichkeiten von Lyrik die traditionellen Todessymbole ersetzt. Der Vergleich verdeutlicht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Kunstformen in ihrer Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit.
Kunst als Überlebenskunst: Dieses Kapitel interpretiert Rühmkorfs Gedicht als eine Reflexion über die Funktion und den Zweck von Kunst. Es analysiert, wie Rühmkorf die Kunst als eine Form des Umgangs mit der Vergänglichkeit und dem Tod darstellt. Die Arbeit beleuchtet den selbstreflexiven Charakter des Gedichts, indem der kreative Prozess selbst zum Thema wird und die Grenzen künstlerischer Darstellung reflektiert werden. Die Interpretation veranschaulicht, wie Rühmkorf die Kunst als Mittel der Selbstvergewisserung und als Möglichkeit des "Überlebens" im Angesicht der Vergänglichkeit darstellt.
Schlüsselwörter
Peter Rühmkorf, Stilleben - bei Anruf Mord, Schönheit, Vergänglichkeit, Mohnblüte, Zeit, Kunst, Bildende Kunst, Vanitas, Selbstreflexivität, Lyrik, Ästhetik, Gesellschaftskritik, Ironie, Parodie.
Häufig gestellte Fragen zu Peter Rühmkorfs "Stilleben - bei Anruf Mord"
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert Peter Rühmkorfs Gedicht "Stilleben - bei Anruf Mord", mit einem Fokus auf die Darstellung von Schönheit und Vergänglichkeit. Sie geht über die gängige Interpretation Rühmkorfs als rein gesellschaftskritischen Dichters hinaus und beleuchtet den ästhetischen Aspekt seines Schaffens. Die Analyse konzentriert sich auf die Interaktion von Kunst und Realität, die Rolle der Zeit und die Bedeutung der Mohn-Symbolik.
Welche Themen werden im Gedicht behandelt?
Das Gedicht behandelt zentrale Themen wie Schönheit und Vergänglichkeit, die Rolle der Zeit (Geschwindigkeit, Augenblick, Plötzlichkeit), den Bezug zur Bildenden Kunst (insbesondere Stilleben und Vanitas), und die Selbstreflexivität des künstlerischen Prozesses. Es untersucht, wie Rühmkorf die Kunst als Mittel des Umgangs mit der Vergänglichkeit und dem Tod darstellt.
Welche Bedeutung hat die Mohnblüte im Gedicht?
Die Mohnblüte fungiert als zentrales Symbol für die ephemeren Schönheit und Vergänglichkeit der Natur und der Kunst. Sie repräsentiert den schnell vergehenden Moment, den Versuch, das Schöne durch die Kunst zu konservieren, und letztlich die Auseinandersetzung mit dem Verfall der Zeit und der eigenen Vergänglichkeit als Künstler.
Wie wird die Thematik der Zeit im Gedicht behandelt?
Die Zeit wird in ihren verschiedenen Aspekten (Geschwindigkeit, Augenblick, Plötzlichkeit) analysiert. Die flüchtige Schönheit des Mohns dient als Metapher für den vergänglichen Augenblick. Das Gedicht thematisiert den Versuch, diesen flüchtigen Moment künstlerisch festzuhalten, die zeitliche Dimension der Kunstproduktion und -rezeption, und die Grenzen dieser Festlegung. Die Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit (des Künstlers und des Werkes) wird deutlich.
Welchen Bezug hat das Gedicht zur Bildenden Kunst?
Das Gedicht weist einen expliziten Bezug zur Bildenden Kunst auf, insbesondere zu Stilleben und dem barocken Vanitas-Motiv. Der Titel und die Bildlichkeit des Gedichts ermöglichen einen direkten Vergleich zwischen Malerei und Poesie. Das Gedicht wird als eine Art poetisches Vanitas-Stilleben interpretiert, wobei die Reflexion über die Möglichkeiten der Lyrik die traditionellen Todessymbole ersetzt. Der Vergleich verdeutlicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Auseinandersetzung beider Kunstformen mit der Vergänglichkeit.
Wie wird Kunst im Gedicht interpretiert?
Das Gedicht interpretiert Kunst als eine Form des Umgangs mit der Vergänglichkeit und dem Tod. Es analysiert die Kunst als Reflexion des künstlerischen Prozesses und der eigenen Vergänglichkeit. Die Kunst wird als Mittel der Selbstvergewisserung und als Möglichkeit des "Überlebens" im Angesicht der Vergänglichkeit dargestellt. Der selbstreflexive Charakter des Gedichts wird hervorgehoben, da der kreative Prozess selbst zum Thema wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Gedicht?
Schlüsselwörter sind: Peter Rühmkorf, Stilleben - bei Anruf Mord, Schönheit, Vergänglichkeit, Mohnblüte, Zeit, Kunst, Bildende Kunst, Vanitas, Selbstreflexivität, Lyrik, Ästhetik, Gesellschaftskritik, Ironie, Parodie.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Mohn-Symbolik, zur Thematik der Zeit, zu Dichtkunst und Bildender Kunst, zu Kunst als Überlebenskunst und ein Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Analyse?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Schönheit und Vergänglichkeit in Rühmkorfs Gedicht. Sie hinterfragt die gängige Interpretation Rühmkorfs als rein gesellschaftskritischen Dichters und beleuchtet den ästhetischen Aspekt seines Schaffens. Die Analyse fokussiert auf die Interaktion von Kunst und Realität, die Rolle der Zeit und die Bedeutung der Mohn-Symbolik. Die Selbstreflexivität des Gedichts und die Verknüpfung von Schönheit und Vergänglichkeit werden untersucht, ohne den Realitätsbezug zu vernachlässigen.
- Quote paper
- Fabian Fitz (Author), 2013, Schönheit und ihre Vergänglichkeit in Peter Rühmkorfs "Stilleben – bei Anruf Mord", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301156