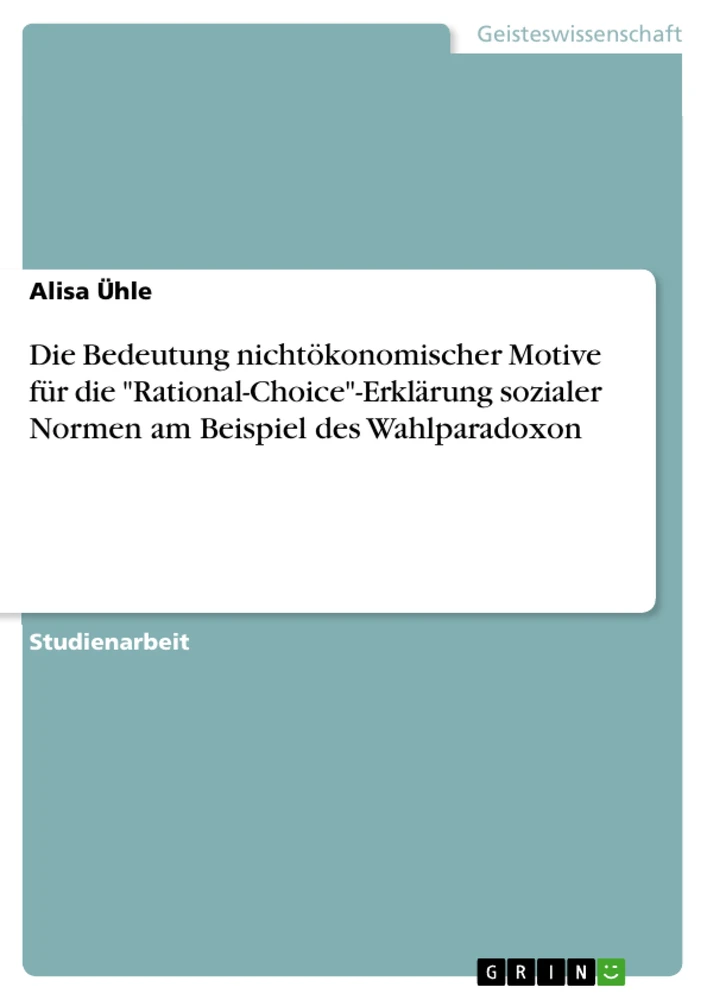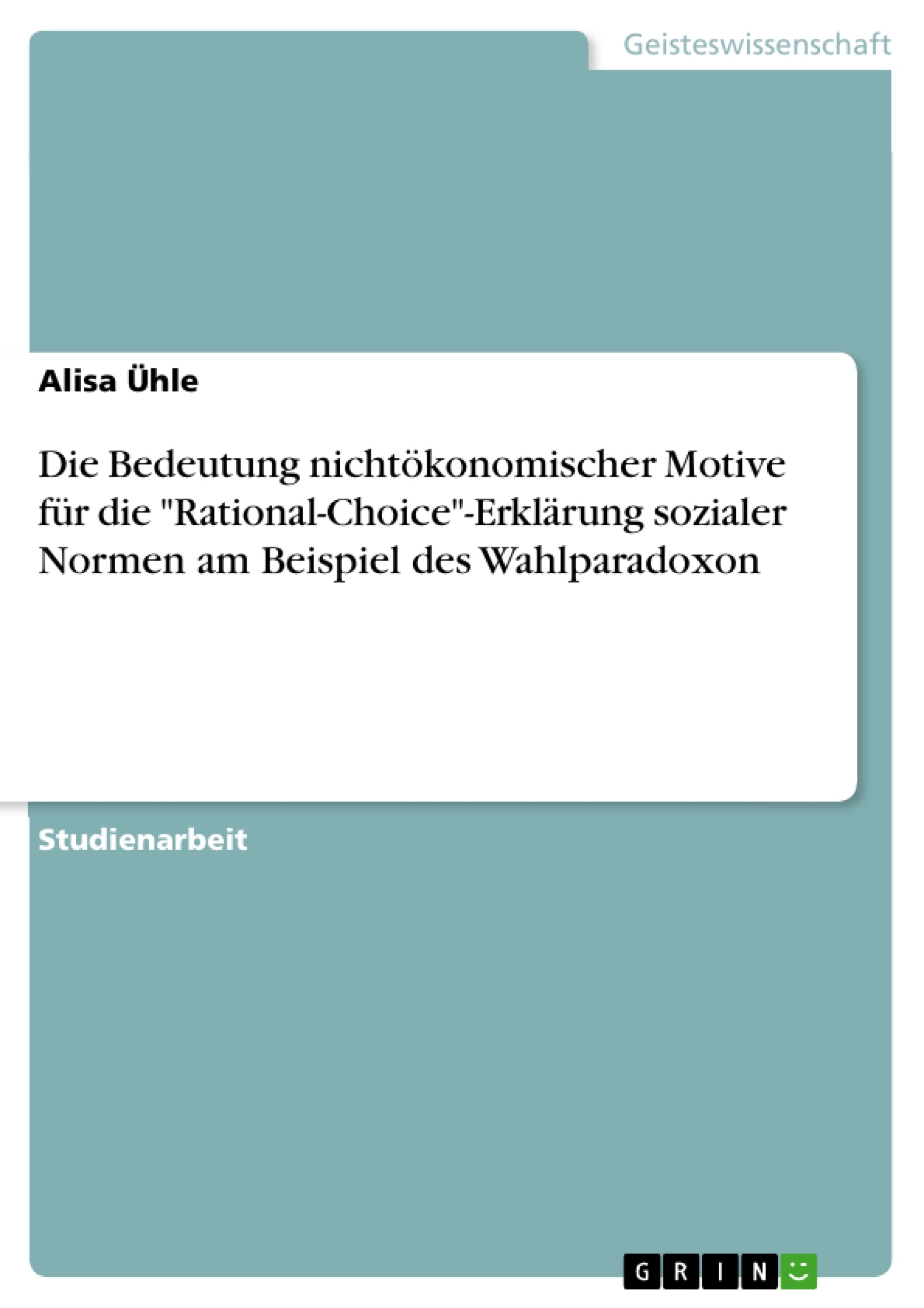Es handelt sich hier um eine Hausarbeit, die sich mit der Frage auseinandersetzt, ob Normen immer als Wirkung externen Effekte entstehen. Es wird versucht, diese Frage am Beispiel des Wahlparadoxon zu beantworten.
„Informelle soziale Normen mit Sanktionen gehören zweifellos zu den wichtigen Bausteinen der sozialen Ordnung“. Normen werden als Grundvoraussetzung für die Entstehung einer gesellschaftlichen Ordnung renommiert. Doch „obwohl Normen so wichtig für die Generierung sozialer Ordnung sind, wurde das Problem der Entstehung sozialer Normen[…]“ von den Sozialwissenschaftlern in ihren Auseinandersetzungen lange vernachlässigt. „Karl- Dieter Opp gehört zu den Autoren, die auf dieses Defizit frühzeitig aufmerksam machten und entscheidende Beiträge zur Erklärung sozialer Normen vorlegten, die in einer Anwendung der individualistischen Theorie rationalen Handelns besteht“.
Ziel der folgenden Seminararbeit ist es, die Entstehung sozialer Normen mithilfe der Rational-Choice-Theorie begreiflich zu machen. Dabei sollen Normen als Wirkung externer Effekte dargelegt, sowie das sogenannte Norm- und Metanormspiel zur Verdeutlichung betrachtet werden. Des Weiteren sollen folgende Fragen geklärt werden: Funktioniert der Mechanismus der Rational-Choice-Erklärung bei jeder Normentstehung? Oder stehen Normen nicht im Disput zum ökonomischen Ansatz? Denn Normen sind Dinge, die die Interessenverwirklichung und Nutzenmaximierung des Einzelnen eher verhindern. Warum sagt die Ökonomie trotzdem, dass es so etwas wie Normen gibt? Gibt es Normen, die auch ohne ökonomisches Nutzenkalkül entstehen und ist der Ansatz schlüssig, bei einem ökonomischen Nutzenmaximierer zu erwarten, dass Normen entstehen, die sozial sind?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Norm
- Externalitäten
- Normen als Wirkung externer Effekte?
- Die Internalisierung von Normen
- Die Sanktionierung abweichenden Verhaltens und das Gefangenendilemma
- Das Normspiel
- Das Metanormspiel
- Das Wahlparadoxon - Warum gehen Menschen wählen?
- Wahlparadoxon Lösungsansätze
- Antony Downs- Modifikation der Präferenzen
- Richard Niemi- Relativierung der Kosten
- Riker und Ordeshook- Überschätzung der Einflusswahrscheinlichkeit
- Ferejohn und Fiorina- Die Minimierung maximal möglichen Bedauerns
- Alternative Lösung zur Erklärung der Wahlbeteiligung - Die Theorie des expressiven Wählens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entstehung sozialer Normen unter Anwendung der Rational-Choice-Theorie. Sie beleuchtet Normen als Reaktion auf externe Effekte und analysiert das Norm- und Metanormspiel zur Veranschaulichung. Die Arbeit hinterfragt die Anwendbarkeit der Rational-Choice-Erklärung auf alle Normentstehungsprozesse und betrachtet die Rolle nicht-ökonomischer Motive. Das Wahlparadoxon dient als Fallbeispiel zur Überprüfung der Theorie.
- Rational-Choice-Theorie und Normentstehung
- Normen als Reaktion auf externe Effekte (Externalitäten)
- Rolle nicht-ökonomischer Motive bei der Normeinhaltung
- Das Norm- und Metanormspiel
- Analyse des Wahlparadoxons
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Normentstehung ein und betont die lange Vernachlässigung dieses Problems in der Sozialwissenschaft. Sie hebt die Bedeutung von Karl-Dieter Opp für die Erklärung sozialer Normen hervor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die Entstehung sozialer Normen mithilfe der Rational-Choice-Theorie zu erklären, wobei Normen als Wirkung externer Effekte dargestellt und das Norm- und Metanormspiel betrachtet werden sollen. Die Arbeit hinterfragt die Anwendbarkeit des ökonomischen Ansatzes auf alle Normentstehungsprozesse und untersucht die Rolle nicht-ökonomischer Motive, insbesondere am Beispiel des Wahlparadoxons.
Definition Norm: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs „Norm“. Es betont die Vielfältigkeit von Normdefinitionen und wählt für die Zwecke der Arbeit eine pragmatische Definition: Normen als Sollenserwartungen im Gegensatz zu faktischen Erwartungen. Die Gültigkeit sozialer Normen wird als sozialer Tatbestand im Sinne Max Webers definiert, wobei die Sanktionierung bei Nichteinhaltung eine zentrale Rolle spielt. Die Gültigkeit von Normen wird als Kollektivgut charakterisiert.
Externalitäten: Dieses Kapitel erläutert den wichtigen Begriff der „Externalitäten“ im Kontext der Normentstehung. Externalitäten werden als Konsequenzen von Handlungen definiert, die sowohl Kosten als auch Nutzen für andere Personen oder Institutionen verursachen können. Negative Externalitäten entstehen, wenn Handlungen Kosten für Andere verursachen, während positive Externalitäten Nutzen stiften. Der Text illustriert den Sachverhalt mithilfe eines Beispiels mit zwei Personen, die dieselbe knappe Ressource nutzen wollen, wobei für die Person, die die Ressource nicht erhält, eine negative Externalität entsteht. Die Bedeutung von Externalitäten als externe Effekte wird hervorgehoben und der Übergang zur Entstehung sozialer Normen vorbereitet.
Normen als Wirkung externer Effekte?: Dieses Kapitel untersucht die Frage, ob Normen als Wirkung externer Effekte entstehen. Es postuliert, dass Normen nur dann entstehen, wenn die Handlungen von Gruppenmitgliedern Probleme für (einen Teil der) Mitglieder verursachen. Eine wohlfahrtssteigernde Wirkung wird Normen zugeschrieben. Die Norm reguliert das Verhalten der Individuen so, dass negative Externalitäten vermieden werden.
Schlüsselwörter
Rational-Choice-Theorie, soziale Normen, Externalitäten, Normspiel, Metanormspiel, Wahlparadoxon, nicht-ökonomische Motive, Sanktionierung, Kollektivgut, individuelle Nutzenmaximierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Normentstehung und Rational-Choice-Theorie
Was ist das zentrale Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entstehung sozialer Normen unter Anwendung der Rational-Choice-Theorie. Sie analysiert Normen als Reaktion auf externe Effekte (Externalitäten) und beleuchtet das Norm- und Metanormspiel. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob die Rational-Choice-Theorie alle Normentstehungsprozesse erklären kann und welche Rolle nicht-ökonomische Motive spielen. Das Wahlparadoxon dient als Fallbeispiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition Norm, Externalitäten, Normen als Wirkung externer Effekte?, Die Internalisierung von Normen, Die Sanktionierung abweichenden Verhaltens und das Gefangenendilemma, Das Normspiel, Das Metanormspiel, Das Wahlparadoxon - Warum gehen Menschen wählen?, Wahlparadoxon Lösungsansätze (inkl. Downs, Niemi, Riker & Ordeshook, Ferejohn & Fiorina), Alternative Lösung zur Erklärung der Wahlbeteiligung - Die Theorie des expressiven Wählens, Fazit.
Wie wird der Begriff „Norm“ definiert?
Die Arbeit verwendet eine pragmatische Definition von Normen als Sollenserwartungen im Gegensatz zu faktischen Erwartungen. Die Gültigkeit sozialer Normen wird als sozialer Tatbestand im Sinne Max Webers definiert, wobei die Sanktionierung bei Nichteinhaltung zentral ist. Die Gültigkeit von Normen wird als Kollektivgut charakterisiert.
Welche Rolle spielen Externalitäten?
Externalitäten werden als Konsequenzen von Handlungen definiert, die Kosten oder Nutzen für andere verursachen. Die Arbeit argumentiert, dass Normen entstehen, um negative Externalitäten zu vermeiden und das Wohlfahrt zu steigern. Ein Beispiel mit zwei Personen, die um eine knappe Ressource konkurrieren, veranschaulicht dies.
Wie wird das Wahlparadoxon behandelt?
Das Wahlparadoxon dient als Fallbeispiel, um die Anwendbarkeit der Rational-Choice-Theorie zu überprüfen. Die Arbeit diskutiert verschiedene Lösungsansätze, darunter die Modifikation der Präferenzen (Downs), die Relativierung der Kosten (Niemi), die Überschätzung der Einflusswahrscheinlichkeit (Riker & Ordeshook) und die Minimierung maximal möglichen Bedauerns (Ferejohn & Fiorina). Zusätzlich wird die Theorie des expressiven Wählens als alternative Erklärung betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Rational-Choice-Theorie, soziale Normen, Externalitäten, Normspiel, Metanormspiel, Wahlparadoxon, nicht-ökonomische Motive, Sanktionierung, Kollektivgut, individuelle Nutzenmaximierung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung sozialer Normen mithilfe der Rational-Choice-Theorie zu erklären. Sie untersucht Normen als Reaktion auf externe Effekte und analysiert das Norm- und Metanormspiel. Die Anwendbarkeit des ökonomischen Ansatzes und die Rolle nicht-ökonomischer Motive werden kritisch hinterfragt.
- Citar trabajo
- Alisa Ühle (Autor), 2014, Die Bedeutung nichtökonomischer Motive für die "Rational-Choice"-Erklärung sozialer Normen am Beispiel des Wahlparadoxon, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301079