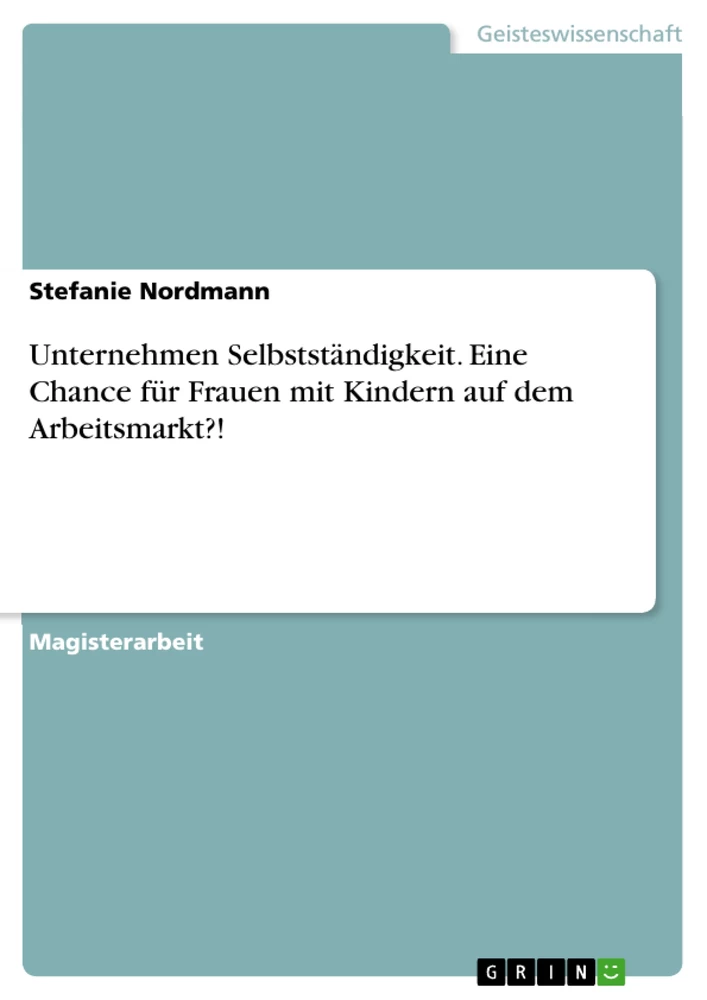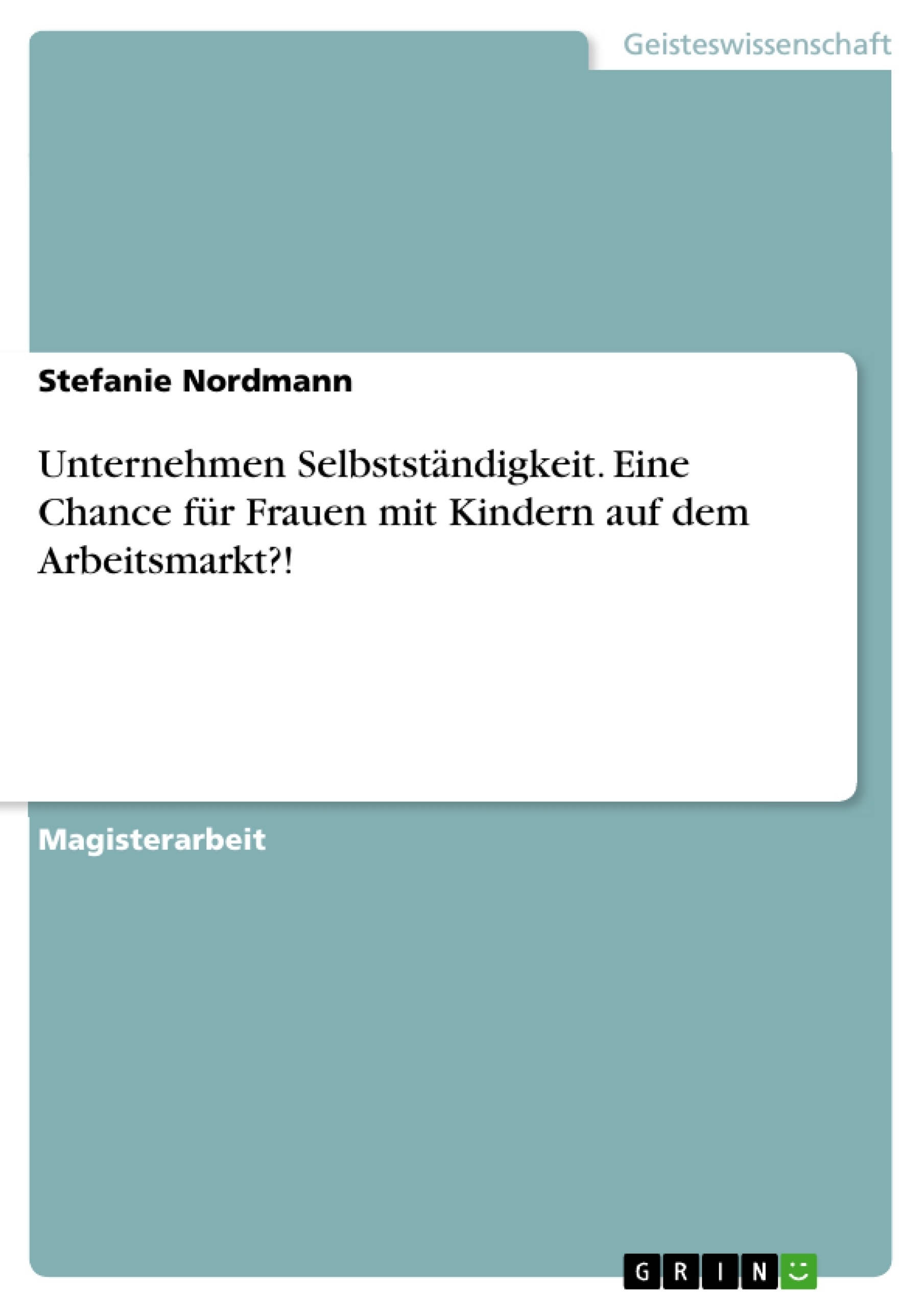Auch heute sind es noch immer Frauen, die vorrangig die Verantwortung für die Kindeserziehung tragen, während Männern die Rolle des „Ernährers“ zugeschrieben wird. Durch diesen Umstand, der wohl aus den vermeintlich biologischen Unterschieden und den daraus folgenden naturalisierten Geschlechterkonstruktionen resultiert, ergeben sich in der Berufswelt, die sich an einem männlichen Normalarbeitsverhältnis orientiert, Benachteiligungen für Frauen.
Sie erfahren Zuschreibungen von Eigenschaften, Werten und Normen, die eine verminderte Leistungsfähigkeit suggerieren, und es wird angenommen, sie könnten bedingt aus familiären Gründen im Betrieb ausfallen. Einerseits herrscht noch immer die soziobiologische Vorstellung vom ‚weiblichen Geschlechtswesen’, die wiederum die Benachteiligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt rechtfertigt und damit fortlaufend reproduziert. Andererseits wird den Frauen dann genau diese Zuständigkeit vorgehalten, z.B. sie seien eben dadurch nicht voll einsatz- und arbeitsfähig, flexibel etc. Aufgrund dieser Zuschreibungen haben es Frauen weitaus schwerer als Männer, sich in der Berufswelt zu bewähren und zu etablieren. Indikatoren dafür sind bspw. unterschiedliche Einkommen von Männern und Frauen für die gleiche Arbeit, das zeigt sich aber auch an der Anzahl von Führungspositionen, die durch Frauen bzw. Männer besetzt sind und an entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen, an denen Frauen in geringerem Maße partizipieren. Frauen sind im Allgemeinen benachteiligt. Sie sind also gewissermaßen gefangen in ihrem als weiblich markierten Körper, der damit verbundenen Idee vom ‚weiblichen Wesen’ und der daran gebundenen Zuständigkeit für die „Familienarbeit“.
Im Zuge der Recherche entwickelte ich die Hypothese, dass der Weg in die Selbstständigkeit eine Strategie ist, um geschlechtsspezifische Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu überwinden und Arbeits- und Familienleben besser zu vereinbaren; dass die Selbstständigkeit somit als ein weibliches Empowerment verstanden werden kann. Aus diesem Grunde bilden selbstständige Frauen, die in Berlin bzw. Brandenburg ihren Lebensmittelpunkt haben und zum Existenzgründungszeitpunkt schwanger waren oder Kinder im Alter von 0-6 Jahren hatten, den Untersuchungsgegenstand. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Bedeutung und die Beweggründe für eine Selbstständigkeit und die ganz persönliche Sicht dieser Mütter auf Probleme der Vereinbarkeit ihrer beruflichen Tätigkeit mit ihrer Familie. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Problemstellung
- 1.1 Forschungsmotiv und Erkenntnisinteresse
- 1.2 Ziel der Arbeit und Forschungsfragen
- 1.3 Vorgehen in der Arbeit
- 2 Geschlecht und Arbeitsmarkt
- 2.1 Die Bedeutung von „Gender“
- 2.2 Arbeit und Familie
- 2.2.1 Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
- 2.2.2 Die geschlechtsspezifische Segregation auf dem Arbeitsmarkt
- 2.2.3 Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- 2.3 Selbstständigkeit
- 2.3.1 Definition
- 2.3.2 Tendenzen
- 2.3.2.1 Quantitative Aspekte
- 2.3.2.2 Bildung
- 2.3.2.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede
- 2.3.2.4 Alter
- 2.3.2.5 Selbstständigkeit von MigrantInnen
- 2.3.2.6 Selbstständigkeit und Familienstand
- 2.3.2.7 Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern
- 2.3.2.8 Förderung der Kultur der Selbstständigkeit
- 3 Theoretischer Zugang
- 3.1 Das Konzept des Arbeitskraftunternehmers (AKU)
- 3.1.1 Der Ausgangstext
- 3.1.2 Erweiterung und Differenzierung des Konzepts vom Arbeitskraftunternehmer
- 3.1.3 Kritik am Konzept des Arbeitskraftunternehmers (AKU)
- 3.2 Das Motivationsmodell von Maslow
- 3.3 Zwischenfazit
- 4 Methodisches Vorgehen
- 4.1 Thesen
- 4.2 Analyserahmen
- 4.3 Qualitatives leitfadengestütztes Interview
- 4.4 Der Interviewleitfaden als Instrument qualitativer Befragungen
- 4.5 Auswahl der Interviewpartnerinnen
- 4.5.1 Selbstständige Frauen
- 4.5.2 Alter der Kinder zum Existenzgründungszeitpunkt 0-6
- 4.6 Zugang zum Forschungsfeld
- 4.7 Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Cropley
- 5 Auswertung und Interpretation der empirischen Forschungsergebnisse
- 5.1 Vorstellung der Interviewpartnerinnen
- 5.2 Motive für die Selbstständigkeit: „Karriere, Selbstverwirklichung oder Broterwerb?“
- 5.3 Bedingungen für die Selbstständigkeit
- 5.3.1 Vorbilder
- 5.3.2 Existenzgründungskurse
- 5.3.3 Finanzierung
- 5.4 AKU
- 5.4.1 Eigenschaft des AKU: Selbstkontrolle
- 5.4.1.1 Berufszufriedenheit = Spaß bei der Arbeit
- 5.4.1.2 Freude über Lob
- 5.4.1.3 Optimierungsprozesse
- 5.4.2 Eigenschaft des AKU: Selbstökonomisierung
- 5.4.2.1 Autonomiebestreben
- 5.4.2.2 Produktion der eigenen Arbeitskraft
- 5.4.2.2.1 Berufliche Netzwerke
- 5.4.2.2.2 Entwicklung von Fähigkeiten
- 5.4.2.3 Vermarktung der eigenen Arbeitskraft
- 5.4.2.3.1 Inszenierung persönlicher Qualifikationen und Erfahrungen
- 5.4.2.3.2 Unternehmerisches Denken und Handeln
- 5.4.2.3.3 Schwierigkeiten und Probleme/ Vorurteile und Diskriminierungen
- 5.4.2.3.4 Bewältigungsstrategien
- 5.4.2.3.5 Verantwortungsbewusstsein
- 5.4.3 Eigenschaft des AKU: Selbstrationalisierung
- 5.4.3.1 Praxis
- 5.4.3.1.1 Vereinbarkeit der Selbstständigkeit mit der Kinderbetreuung oder „Private und berufliche Zielvorstellungen: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
- 5.4.3.1.2 Hausarbeits-Rationalität
- 5.4.3.2 Arbeitszeiten und Freizeiten
- 5.5 Ratschläge an andere Frauen, die sich selbstständig machen wollen
- 5.6 Wünsche und Verbesserungsvorschläge
- 5.6.1 Verbesserungsvorschläge für Selbstständige
- 5.6.2 Wünsche zur Verbesserung der Rolle der Frau
- 5.6.3 Verbesserungsvorschläge für ein familienfreundliches Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der Selbstständigkeit für Frauen mit Kindern auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Motive, Bedingungen und Erfahrungen selbstständiger Frauen mit Kindern zu erforschen und diese im Kontext bestehender sozioökonomischer Strukturen zu analysieren.
- Motive für die Selbstständigkeit von Frauen mit Kindern
- Herausforderungen und Chancen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Selbstständigkeit
- Die Rolle des Konzepts des Arbeitskraftunternehmers (AKU) im Kontext der Selbstständigkeit von Frauen mit Kindern
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Selbstständigkeit
- Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Förderung weiblicher Selbstständigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung in die Problemstellung: Dieses Kapitel legt die Forschungsfrage und das Erkenntnisinteresse der Arbeit dar. Es beschreibt die Relevanz der Thematik der weiblichen Selbstständigkeit im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und skizziert den methodischen Ansatz der Studie. Das Kapitel begründet die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Selbstständigkeit als alternative Karriereform für Frauen mit Kindern und benennt die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen.
2 Geschlecht und Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Segregation auf dem Arbeitsmarkt. Es beleuchtet die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und diskutiert die Bedeutung des Gender-Konzepts für das Verständnis dieser Problematik. Der Abschnitt über Selbstständigkeit beleuchtet die quantitativen und qualitativen Aspekte der Selbstständigkeit in Deutschland, inklusive geschlechtsspezifischer Unterschiede und Tendenzen in Bezug auf Alter, Migrationshintergrund und Familienstand. Besondere Aufmerksamkeit wird der Förderung der Selbstständigkeit gewidmet.
3 Theoretischer Zugang: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erörtert. Es wird das Konzept des Arbeitskraftunternehmers (AKU) detailliert vorgestellt, erweitert und kritisch diskutiert. Zusätzlich wird das Motivationsmodell von Maslow einbezogen, um die individuellen Motive für die Selbstständigkeit besser zu verstehen. Der Vergleich und die Gegenüberstellung beider Modelle bilden die Grundlage für die spätere empirische Analyse.
4 Methodisches Vorgehen: Das Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der qualitativen Studie. Es erläutert die Wahl des qualitativen leitfadengestützten Interviews als Forschungsmethode und die Auswahl der Interviewpartnerinnen. Die Kriterien für die Auswahl der Interviewpartnerinnen (selbstständige Frauen mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren) werden detailliert dargelegt. Das Kapitel beschreibt außerdem die qualitative Inhaltsanalyse nach Cropley, die zur Auswertung der Interviews verwendet wurde.
5 Auswertung und Interpretation der empirischen Forschungsergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews mit selbstständigen Frauen. Es werden die individuellen Geschichten der Interviewpartnerinnen vorgestellt und ihre Motive für die Selbstständigkeit analysiert. Die Ergebnisse werden im Kontext des AKU-Konzepts und des Maslowschen Motivationsmodells interpretiert. Die Analyse fokussiert auf die Aspekte Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schwierigkeiten, Probleme, Bewältigungsstrategien und Verbesserungsvorschläge werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Selbstständigkeit, Frauen, Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Arbeitsmarkt, Gender, Arbeitskraftunternehmer (AKU), Qualitative Forschung, Motivationsmodell von Maslow, Existenzgründung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Selbstständige Frauen mit Kindern
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der Selbstständigkeit für Frauen mit Kindern auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Sie erforscht die Motive, Bedingungen und Erfahrungen selbstständiger Frauen mit Kindern und analysiert diese im Kontext bestehender sozioökonomischer Strukturen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Motive für die Selbstständigkeit von Frauen mit Kindern, die Herausforderungen und Chancen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Selbstständigkeit, die Rolle des Konzepts des Arbeitskraftunternehmers (AKU), geschlechtsspezifische Unterschiede in der Selbstständigkeit und die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Förderung weiblicher Selbstständigkeit.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Es wurden leitfadengestützte Interviews mit selbstständigen Frauen durchgeführt. Die Auswertung der Interviews erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Cropley.
Welche Interviewpartnerinnen wurden ausgewählt?
Die Interviewpartnerinnen waren selbstständige Frauen mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren zum Zeitpunkt der Existenzgründung.
Welches theoretische Konzept wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Konzept des Arbeitskraftunternehmers (AKU) und das Motivationsmodell von Maslow. Das AKU-Konzept wird detailliert vorgestellt, erweitert und kritisch diskutiert. Das Maslowsche Motivationsmodell hilft, die individuellen Motive für die Selbstständigkeit zu verstehen.
Welche Aspekte des AKU-Konzepts werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Aspekte Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei selbstständigen Frauen mit Kindern.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Interviews, inklusive der individuellen Geschichten der Interviewpartnerinnen und ihrer Motive für die Selbstständigkeit. Die Ergebnisse werden im Kontext des AKU-Konzepts und des Maslowschen Motivationsmodells interpretiert. Schwierigkeiten, Probleme, Bewältigungsstrategien und Verbesserungsvorschläge werden diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung in die Problemstellung, 2. Geschlecht und Arbeitsmarkt, 3. Theoretischer Zugang, 4. Methodisches Vorgehen und 5. Auswertung und Interpretation der empirischen Forschungsergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstständigkeit, Frauen, Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Arbeitsmarkt, Gender, Arbeitskraftunternehmer (AKU), Qualitative Forschung, Motivationsmodell von Maslow, Existenzgründung.
Wo finde ich einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Inhalte jedes Kapitels und deren jeweilige Schwerpunkte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit den Themen Selbstständigkeit, Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gender und Arbeitsmarkt befassen. Sie bietet zudem wertvolle Einblicke für politische Entscheidungsträger und Organisationen, die sich für die Förderung weiblicher Selbstständigkeit engagieren.
- Quote paper
- Stefanie Nordmann (Author), 2008, Unternehmen Selbstständigkeit. Eine Chance für Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300063