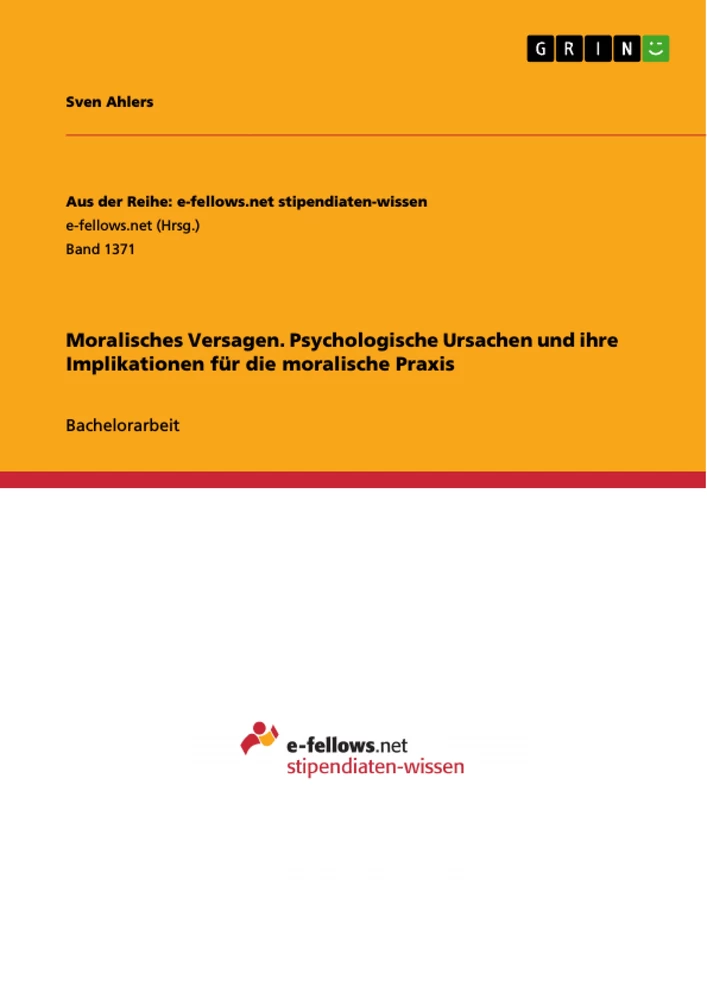Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen des moralischen Versagens, welches definiert wird, als das Scheitern eines Individuums gemäß seiner bewusst gehaltenen moralischen Überzeugungen zu handeln.
Dazu greift die vorliegende Arbeit auf die Ergebnisse eines Forschungsfelds zurück, das in den vergangenen Jahrzehnten das Interesse unterschiedlicher Disziplinen auf sich zog. So beschäftigen sich u.a. Evolutions-biologen, Kognitionswissenschaftler, Neurowissenschaftler, Sozialpsychologen und vermehrt auch Philosophen mit den Ursprüngen und Mechanismen moralischen Denkens und Handelns – der Moralpsychologie.
Im Folgenden wird versucht einen systematischen Überblick über die, für die Untersuchung moralischen Verhaltens, relevante moralpsychologische Forschung zu geben. Dazu wird das komplexe Konstrukt ‚moralisches Verhalten‘ gemäß moralpsychologischer Forschungsschwerpunkte in vier Themenabschnitte unterteilt.
Als Ausgangspunkt wird die Bedeutung mentaler Prozesse für moralisches Handeln diskutiert. Dazu wird in Abschnitt 2 zunächst der entwicklungspsychologische Ansatz Lawrence Kohlbergs mit seinem Fokus auf bewusstem moralischem Denken vorgestellt. Kohlbergs Arbeit wird dann in Abschnitt 3 mit der Arbeit Jonathan Haidts konfrontiert, die einen gegensätzlichen Fokus auf unbewusste moralische Intuitionen legt. Anschließend wird darauf aufbauend in Abschnitt 4 die Verbindung zwischen moralischen Überzeugungen und moralischem Verhalten näher betrachtet. Auf Basis der neurowissenschaftlichen Arbeiten Antonio Damasios und seiner Kollegen wird dazu die Natur moralischer Motivation untersucht, wobei insbesondere auf die Rolle moralischer Emotionen eingegangen wird. Unter Einbezug klassischer sozialpsychologischer Studien wird in Abschnitt 5 abschließend der Einfluss moralischer Situationen auf moralisches Verhalten untersucht und die Verbindung zu den vorherigen Ergebnissen diskutiert.
In jedem der genannten Abschnitte werden Ursachen moralischen Versagens gesondert identifiziert und im Anschluss Vorschläge diskutiert, wie sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten moralischen Versagens mindern lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Moralisches Denken
- 2.1 Der kognitiv-entwicklungspsychologische Ansatz
- 2.2 Moralisches Versagen und moralische Praxis
- 3. Moralische Intuitionen
- 3.1 Social Intuitionist Model
- 3.2 Funktionsweise moralischer Intuitionen
- 3.2.1 Heuristiken
- 3.2.2 Priming
- 3.2.3 Diskussion
- 3.3 Moralisches Versagen
- 3.4 Implikationen für die moralische Praxis
- 4. Moralische Motivation
- 4.1 Studien über VMPFC-Patienten
- 4.2 Funktionsweise moralischer Emotionen
- 4.2.1 Moralischer Ekel
- 4.2.2 Kulturabhängigkeit moralischer Emotionen
- 4.2.3 Diskussion
- 4.3 Moralisches Versagen
- 4.4 Implikationen für die moralische Praxis
- 5. Moralische Situationen
- 5.1 Psychologischer Situationismus
- 5.2 Moralisches Versagen und moralische Praxis
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des moralischen Versagens, definiert als das Scheitern, gemäß der eigenen moralischen Überzeugungen zu handeln. Ziel ist es, die psychologischen Ursachen dieses Versagens zu identifizieren und Implikationen für die moralische Praxis abzuleiten. Die Arbeit stützt sich auf Erkenntnisse der Moralpsychologie aus verschiedenen Disziplinen.
- Der kognitiv-entwicklungspsychologische Ansatz (Kohlberg) und die Rolle bewussten moralischen Denkens
- Der Einfluss unbewusster moralischer Intuitionen (Haidt) und deren Funktionsweise
- Die Bedeutung moralischer Motivation und Emotionen
- Der Einfluss von moralischen Situationen und der psychologische Situationismus
- Identifizierung von Ursachen moralischen Versagens und Vorschläge zur Verminderung dessen Wahrscheinlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Fall des Reserve-Polizeibataillons 101 und das Massaker von Józefów 1942 als Ausgangspunkt für die Untersuchung moralischen Versagens. Sie führt den Begriff des moralischen Versagens ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der sich auf die Moralpsychologie stützt und verschiedene Aspekte moralischen Denkens und Handelns beleuchtet, um die Ursachen moralischen Versagens zu verstehen und Möglichkeiten zu deren Verminderung aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung mentaler Prozesse, moralischer Intuitionen, Motivation, Emotionen und dem Einfluss moralischer Situationen.
2. Moralisches Denken: Dieses Kapitel beginnt mit der Einführung des kognitiv-entwicklungspsychologischen Ansatzes von Lawrence Kohlberg. Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Entwicklung wird detailliert beschrieben, wobei die präkonventionelle, konventionelle und postkonventionelle Ebene unterschieden werden. Der Zusammenhang zwischen moralischem Denken und Handeln wird diskutiert, wobei Kohlbergs Annahme einer positiven Korrelation zwischen höherer Moralstufe und moralischem Handeln im Fokus steht. Das Kapitel legt die Grundlage für die weitere Betrachtung unbewusster Einflüsse auf moralisches Verhalten.
3. Moralische Intuitionen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Social Intuitionist Model von Jonathan Haidt, das den Fokus auf unbewusste moralische Intuitionen lenkt, im Gegensatz zu Kohlbergs Betonung des bewussten moralischen Denkens. Die Funktionsweise moralischer Intuitionen wird anhand von Heuristiken, Priming und anderen Mechanismen erläutert. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Interaktion zwischen bewussten und unbewussten Prozessen im moralischen Urteil und Handeln und deren Relevanz für moralisches Versagen.
4. Moralische Motivation: Dieses Kapitel erörtert den Zusammenhang zwischen moralischen Überzeugungen und moralischem Verhalten unter Einbezug neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der Arbeiten Antonio Damasios. Die Rolle moralischer Emotionen, wie beispielsweise moralischen Ekels, und deren kulturelle Abhängigkeit werden ausführlich analysiert. Die Diskussion beleuchtet die Funktionsweise moralischer Motivation und zeigt auf, wie Defizite in diesem Bereich zu moralischem Versagen führen können.
5. Moralische Situationen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss moralischer Situationen auf moralisches Verhalten, unter Einbezug des psychologischen Situationismus. Es wird analysiert, wie situative Faktoren das moralische Handeln beeinflussen können und wie diese Einflussnahme zu moralischem Versagen beitragen kann. Die Diskussion verbindet die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel mit dem Einfluss situativer Gegebenheiten und zeigt die Interaktion verschiedener Faktoren auf, welche zu moralischem Versagen führen.
Schlüsselwörter
Moralisches Versagen, Moralpsychologie, Kohlberg, Haidt, Moralische Intuitionen, Moralische Motivation, Moralische Emotionen, Psychologischer Situationismus, Bewusstes moralisches Denken, Unbewusste moralische Prozesse.
Häufig gestellte Fragen zu: Moralpsychologische Analyse des moralischen Versagens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des moralischen Versagens – das Scheitern, gemäß der eigenen moralischen Überzeugungen zu handeln. Sie analysiert die psychologischen Ursachen dieses Versagens und leitet daraus Implikationen für die moralische Praxis ab.
Welche Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Erkenntnisse der Moralpsychologie und integriert verschiedene Perspektiven: den kognitiv-entwicklungspsychologischen Ansatz (Kohlberg), das Social Intuitionist Model (Haidt), die Rolle moralischer Emotionen und Motivation sowie den Einfluss von moralischen Situationen (psychologischer Situationismus).
Was ist Kohlbergs Beitrag zur Analyse?
Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Entwicklung wird verwendet, um das bewusste moralische Denken zu analysieren. Es wird untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Höhe der moralischen Stufe und moralischem Handeln besteht.
Welche Rolle spielen moralische Intuitionen?
Das Social Intuitionist Model von Haidt betont die Bedeutung unbewusster moralischer Intuitionen neben dem bewussten moralischen Denken. Die Funktionsweise dieser Intuitionen (Heuristiken, Priming etc.) wird im Detail untersucht.
Wie werden moralische Motivation und Emotionen berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Rolle moralischer Emotionen (z.B. moralischer Ekel) und deren kulturelle Abhängigkeit. Defizite in der moralischen Motivation werden als mögliche Ursachen für moralisches Versagen identifiziert.
Welchen Einfluss haben moralische Situationen?
Der psychologische Situationismus wird herangezogen, um den Einfluss situativer Faktoren auf das moralische Handeln zu untersuchen. Es wird gezeigt, wie situative Gegebenheiten zu moralischem Versagen beitragen können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Moralisches Denken, Moralische Intuitionen, Moralische Motivation, Moralische Situationen und Zusammenfassung. Jedes Kapitel beleuchtet einen spezifischen Aspekt des moralischen Versagens.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Moralisches Versagen, Moralpsychologie, Kohlberg, Haidt, Moralische Intuitionen, Moralische Motivation, Moralische Emotionen, Psychologischer Situationismus, Bewusstes moralisches Denken, Unbewusste moralische Prozesse.
Wie wird das moralische Versagen in der Einleitung eingeführt?
Die Einleitung nutzt das Beispiel des Reserve-Polizeibataillons 101 und das Massaker von Józefów 1942 als Ausgangspunkt für die Untersuchung von moralischem Versagen. Es wird ein Forschungsansatz skizziert, der verschiedene Aspekte des moralischen Denkens und Handelns beleuchtet.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die zentralen Inhalte jedes Kapitels zusammen und beschreibt den jeweiligen Fokus und die wichtigsten Ergebnisse. Sie gibt einen Überblick über die gesamte Argumentationslinie der Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die psychologischen Ursachen des moralischen Versagens zu identifizieren und daraus Implikationen für die moralische Praxis abzuleiten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis mentaler Prozesse und deren Einfluss auf moralisches Handeln.
- Quote paper
- Sven Ahlers (Author), 2013, Moralisches Versagen. Psychologische Ursachen und ihre Implikationen für die moralische Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299971